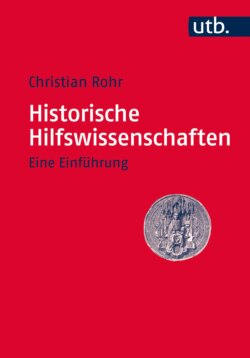Читать книгу Historische Hilfswissenschaften - Christian Rohr - Страница 20
3.4 Editionstechnik
ОглавлениеDie gedruckte Herausgabe (Edition) von historischen Schriftquellen stellt mitunter eine wissenschaftliche Herausforderung dar, besonders wenn das „Original“ nicht mehr erhalten ist, sondern nur noch Abschriften. Hier gibt es zwei Möglichkeiten der Textgestaltung: Entweder man orientiert sich an der besten handschriftlichen Version (der Leithandschrift) und gibt diese originalgetreu wieder. Das bedeutet, dass genau die Orthographie der Vorlage im Druck gewählt wird, egal wie die Vorlagen dieser Version ausgesehen haben mögen. Oder man versucht mit Konjekturen („Vermutungen“) den ursprünglichen Text zu rekonstruieren. Gerade bei lateinischen Texten der Antike und des früheren [<<24] Mittelalters kann letztere Variante zielführender sein, weil sie dem Charakter des Autors eher gerecht wird. Der Editor geht bei seinen Konjekturen den Weg der fortschreitenden Abschreibfehler retour, indem er für bestimmte Schriften häufige Fehler annimmt, wenn der überlieferte Text unrichtig erscheint. Experimente haben gezeigt, dass die Typologie von Abschreibfehlern erstaunliche Konstanzen bis in die heutige Zeit aufweisen.
In einer Textedition ist es üblich, in einer ausführlichen Einleitung die Überlieferung darzulegen, d. h. alle oder zumindest alle wichtigen Handschriften bzw. Urkundenabschriften bezüglich ihrer Qualität für die Texterstellung zu analysieren. Aufgrund philologischer Beobachtungen lässt sich auch ein Stemma (Stammbaum) rekonstruieren, wie die Versionen voneinander abhängig sind, also welche Handschrift eine Kopie einer anderen darstellt. Die einzelnen Handschriften, aber auch die Editionen werden dabei mit Siglen (Kürzeln) dargestellt.
In der Textedition selbst werden abweichende Textvarianten in den Handschriften und bisherigen Editionen durch Buchstabenfußnoten ausgewiesen. Dort finden sich auch Hinweise auf Streichungen, Ergänzungen, Anmerkungen, etc. im Text – ein Erscheinungsbild, das auch die Textentstehung beleuchtet. Vor allem seit dem Spätmittelalter sind auch die Konzepte für Urkunden, Protokolle etc. erhalten, in denen sich auf diese Weise der Diskussionsverlauf offenbart. Numerische Fußnoten dienen der sachlichen Kommentierung des Textes.