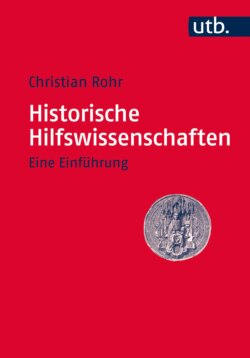Читать книгу Historische Hilfswissenschaften - Christian Rohr - Страница 22
3.5 Bildquellen und ihre Interpretation
ОглавлениеIm Gegensatz zu den schriftlichen Quellen, die ein Merkmal der Hochkulturen seit der Antike bilden, sind Bildquellen aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte überliefert. Ihre Interpretation ist meist noch deutlich komplexer als die der Schriftquellen.
Lange Zeit wurden Bildquellen in der historischen Forschung nicht als gleichwertig mit den schriftlichen Überlieferungen angesehen. Die Bildinterpretation lag daher zumeist in den Händen der Kunsthistoriker, die dem Bild allerdings andere Fragestellungen entgegenbrachten. Zudem ging es in der Kunstgeschichte häufig um ästhetische Kriterien, sodass künstlerisch weniger hochwertige Bilder unbeachtet blieben. Heute haben Bilder in der Geschichtswissenschaft eine prominente Stelle eingenommen, v. a. seit dem sogenannten „pictorial/visual turn“. Die Instrumentarien stammen aber nach wie vor zumeist aus der Kunstgeschichte. So wurde etwa der Ansatz von Erich Panofsky besonders in der Geschichtsdidaktik intensiv rezipiert, der zwischen der Bildbeschreibung (Ikonographie) und Bildinterpretation (Ikonologie) unterschied.
Demnach geht es in einem ersten Schritt um die Beschreibung der Bildinhalte: Was ist dargestellt? Was steht im Zentrum, was im Hintergrund? Welche Farben werden verwendet? Welche Details, z. B. an der Kleidung, sind erkennbar? Welche Attribute werden mit den dargestellten Personen verbunden? Heilige sind auf diese Weise an bestimmten Kennzeichen identifizierbar, die einen Bezug zu ihrem Leben oder ihrem Namen haben, z. B. Petrus mit den Himmelsschlüsseln oder die Evangelisten mit den Symbolen Löwe (Markus), Stier (Lukas), Mensch bzw. Engel (Matthäus) und Adler (Johannes). Bei Herrscherdarstellungen steht der Löwe für Stärke, der Hund für Treue, etc. Diese Stufe der Auswertung ist somit in erster Linie realienkundlichen Zugängen sowie der Rekonstruktion von Zuständen in der Vergangenheit dienlich. Bildquellen sind mitunter auch die einzige Möglichkeit, an bestimmte soziale Gruppen heran zu kommen, z. B. werden Behinderte und andere Randgruppen der mittelalterlichen Gesellschaft nicht selten im Zuge der Darstellung der „Werke der Barmherzigkeit“ dargestellt (etwa im Kreuzgang von Brixen in Südtirol).
Schon bei der Ikonographie ist zu bedenken, dass Bilder einen spezifischen Entstehungshintergrund haben. So geben etwa Darstellungen von Szenen aus der Bibel oder [<<26] Heiligenleben aus dem Mittelalter deutlich mehr Informationen über die Zeit, in der sie entstanden, als über die dargestellte Epoche. Die Protagonisten tragen Kleidung aus der Zeit der Abfassung des Bildes, im Hintergrund sind spätmittelalterliche Städte dargestellt – oft die ältesten Stadtansichten überhaupt! Nicht-religiöse Motive kommen erst ab dem 14. bzw. 15. Jahrhundert langsam auf: zunächst Herrscherporträts, ab der Wende zur Neuzeit auch bürgerliche und bäuerliche Genreszenen.
Zu fragen ist auch, ob z. B. eine naturalistische Darstellung von Menschen, Tieren oder Natur überhaupt erwartet werden kann. So fehlte den Künstlern im Mittelalter weitgehend das Gefühl für die Perspektive. Stimmen etwa die Handhaltungen bei der Darstellung von schreibenden Mönchen wirklich so, wie sie in den Handschriften als Miniatur dargestellt sind?
Bildquellen enthalten häufig auch Informationen über den Schöpfer des Bildes bzw. über deren Auftraggeber. Der Autor des Bildes gibt oft in erster Linie das wieder, was der Auftraggeber sehen bzw. darstellen will, gerade auch bei Porträts. Für den wirkungsgeschichtlichen Kontext ist auch von Bedeutung, wer das Bild überhaupt zu Gesicht bekam, wie es zur Zeit seiner Herstellung gesehen wurde und wie in späteren Zeiten. Ähnlich wie viele schriftliche Quellen hat auch das Bild eine Funktion als Kommunikationsmittel und war in liturgischer, didaktischer, sozialer, rechtlicher oder propagandistischer Funktion an bestimmte Adressaten gerichtet.
Bei der Ikonologie geht es um eine tiefer reichende Interpretation vor dem historischen, kunsthistorischen und geistigen Hintergrund. Was wissen wir über das Umfeld, d. h. was bedeutet es etwa, wenn in einer Zeit, in der es nur geistliche Themen in der Kunst gab, plötzlich ein Herrscher oder bäuerliche Szenen dargestellt werden? So ist es etwa kein Zufall, dass die Fotographie gerade im „bürgerlichen Zeitalter“, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ihren Aufstieg nahm, zumal das Fotoporträt gleichsam zu einem konstituierenden Faktor des Bürgertums wurde.
Warum werden bestimmte Themen in bestimmten Zeiten modern? So erfreute sich die Nibelungensage im Zeitalter des aufkommenden Deutschnationalismus großer Popularität, von der Oper bis hin zur Historienmalerei, die ein für alle Mal das Bild der blonden, blauäugigen Hünen in die Köpfe der Menschen brachte und schließlich vom Nationalsozialismus begeistert aufgenommen wurde.
Ein relativ neuer Ansatz ist die serielle Ikonologie, die eine größere Anzahl an Bildern auf bestimmte Motive hin untersucht. Welche Elemente dürfen etwa in der Abbildung einer Naturkatastrophe unter keinen Umständen fehlen? Auch die Analyse der Bilder auf Briefmarken fällt in diese Kategorie: Briefmarken in totalitären Regimes, z. B. im Nationalsozialismus oder im italienischen Faschismus, enthalten [<<27] sehr eindeutige politische Botschaften, aber auch in Demokratien spiegelt sich die offizielle Politik wider: Anhand der österreichischen Briefmarken zwischen 1945 und 2000 ist der Proporz der beiden Großparteien ÖVP und SPÖ leicht ablesbar. Themen wie der Widerstand gegen das NS-Regime oder Frauenfragen wurden lange Zeit nicht thematisiert. In Deutschland waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundespräsidenten auf Dauermarken zunächst omnipräsent, später waren es berühmte Frauen aus der deutschen Geschichte, jetzt sind es unverfängliche Blumen. Das Thema Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime tauchte mehr als 30 Jahre früher auf als in Österreich.
Die Tendenz oder Funktion eines Bildes ist heute oft nur mehr sehr schwer nachvollziehbar. So las man die berühmten Höhlenmalereien in Lascaux, Frankreich (ca. 15.000 v. Chr.) lange Zeit als Jagdbeschwörungen, als Dank für eine erfolgreiche Jagd oder eine Bitte um ebendiese. Man weiß heute aber aus archäologischen Funden aus dieser Zeit, dass die dargestellten Tiere, v. a. Rinder und Pferde, nicht oder nur am Rande gejagt wurden, die Jagdtiere der damaligen Zeit, v. a. Rentiere, aber fast nie dargestellt wurden. Wie sich die Malereien heute deuten lassen, muss somit weitgehend unklar bleiben.
Das Thema Repräsentation spielte zu allen Zeiten eine wichtige Rolle. Renaissance- und Barock-Paläste sind mit der Apotheose (Vergöttlichung) der Herrscher geschmückt. Kaiser Karl VI. befindet sich im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien ebenso im Himmel wie George Washington in der Kuppel des Kapitols in Washington. Häufig wird zu diesem Zweck auch an ältere Traditionen angeknüpft: So sind die Fußbodenmosaike vor dem Stadio Olimpico in Rom den schwarz-weißen Mosaiken der antik-römischen Hafenstadt Ostia nachempfunden, nur ließ Mussolini keine kämpfenden Gladiatoren, sondern moderne Soldaten mit Maschinengewehren, Kampfflugzeugen etc. darstellen. Dies gilt analog auch für gegenständliche Quellen. Das Mausoleum des Mustafa Kemal Pascha, genannt Atatürk, weist eine Promenade auf, die mit Löwen im Stil der antik-hethitischen Hochkultur geschmückt sind; damit rückte er den neuen türkischen Staat bewusst von den islamisch-osmanischen Kulturen davor ab. Auch Details können Repräsentation veranschaulichen. In der Kirche Santi Quattro Coronati in Rom sind der spätantike Kaiser Konstantin der Große und Papst Silvester dargestellt, wobei der Kaiser als Steigbügelhalter des Papstes fungiert. Im hochmittelalterlichen Streit, ob der Papst oder der Kaiser eine höhere Stellung innehabe, sollte der Hilfsdienst des Kaisers dessen Unterordnung unter den Papst deutlich machen.
Bilder dienten in vielen Epochen auch dazu, Kritik an den herrschenden Zuständen auszudrücken. Dies kann entweder (weitgehend) realistisch geschehen, etwa durch die [<<28] Darstellung des Grauens im Krieg, oder auch in überzeichneter Form als Karikatur. Dabei werden typische Merkmale einer Person, stereotype Zuschreibungen zu einer Personengruppe oder Zustände übertrieben, aber für den Betrachter klar verständlich dargestellt. Die Kritik einer Karikatur kann zu einem reflektierten Nachdenken über einen Sachverhalt anregen oder aber auch nur den/die Kritisierten in ein negatives Licht rücken.
Bildliche Darstellungen können aber auch als Abschreckung bzw. Sozialdisziplinierung fungieren. So wurde gerade im Hoch- und Spätmittelalter an vielen Kirchenportalen das Jüngste Gericht abgebildet: Christus ist dabei als Weltenrichter in der Mitte abgebildet, während zu seiner Rechten (aus der Sicht des Betrachters links) die Rechtschaffenen, Auserwählten den himmlischen Freuden entgegenblicken, während auf der anderen Seite drastische Höllendarstellungen zu sehen sind.
Beispiele:
Abb 1 Teppich von Bayeux (2. Hälfte 11. Jahrhundert), Ausschnitt, gewebter und bestickter Teppich
Beim Wandteppich von Bayeux handelt es sich um eine Stickerei auf Leinwand mit verschiedenfarbigem Wollgarn. Dieses Werk wurde sehr wahrscheinlich von einem angelsächsischen Atelier ausgeführt und zwar auf Wunsch von Odon de Conteville, Bischof von Bayeux sowie Halbbruder von Wilhelm dem Eroberer. Der über 70 Meter lange und 50 cm hohe Wandteppich schildert die Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer, beginnend im Jahr 1064 bis zur Entscheidungsschlacht von Hastings 1066. Der Ausschnitt zeigt in Comicstrip-artiger Form die Zubereitung eines Mahls sowie das Festmahl selbst. Von besonderem historischem Interesse sind die abgebildeten Kleidungsstücke, aber auch die zubereiteten Speisen. Besonders in den adeligen Schichten gehörte der Verzehr gebratenen Fleisches zu einem konstituierenden Element. Das Mahl selbst stiftete Solidarität und nahm daher bei jedem Fest oder bei Vertragsabschlüssen eine wichtige Funktion ein. [<<29]
Abb 2 Derick Baegert: Der Evangelist Lukas als Maler, im Hintergrund Darstellung einer Bürgerstube und einer Stadt (1485/1490), Tafelbild
Der Evangelist Lukas wurde von den Malern als Patron verehrt, war er doch der Legende nach der Erste, der ein Marienbild gemalt hatte. Darstellungen dieser Legende geben dem Künstler nicht nur die Möglichkeit, den Bereich gehobenen bürgerlichen Wohnens zu schildern, sondern auch Gelegenheit, Maler bei der Arbeit zu zeigen. Sowohl die Kleidung als auch das Interieur des Raumes entsprechen dem großbürgerlichen Milieu des ausgehenden 15. Jahrhunderts und nicht der biblischen Zeit. Auch die städtische Straßenszene, die durch das geöffnete Fenster sichtbar ist, weist vom Baustil in diese Zeit. Bilder wie dieses können daher in erster Linie als Quellen für das Leben in einer spätmittelalterlichen Stadt gelesen werden. [<<30]
Abb 3 Karikatur „Ego sum Papa“ – Ich bin der Papst (um 1500), Holzschnitt [<<31]
Die Karikatur zeigt den Papst Alexander VI. Er trägt die Tiara als das Zeichen des Hauptes der Christenheit. Über das grinsende, mit scharfen Hauern besetzte Maul ragt ein spitzer, gebogener Doppelschnabel. Seitlich vom Kopf stehen Schweinsohren ab. Darüber wachsen gebogene Widderhörner. Auf dem Oberkörper befindet sich ebenfalls eine Fratze mit scharfem Schnabel. Die Hände sind Klauen, an denen sich Krallen befinden. Statt des Krummstabes hält der Papst einen gebogenen Zweizack in der Hand, an dem eine Henkerschlinge befestigt ist. Die Karikatur stellt den Papst als Antichrist dar. Sie will den Papst als eine Person vor Augen führen, die Hass und Verachtung verdient. Deckt man die obere Hälfte des Bildes ab, ist der Papst ein frommer Kirchenmann, betrachtet man nur die obere Hälfte, ist er der Teufel in Person. Bilder wie dieses spiegeln deutlich den Hass wider, der am Vorabend der Reformation dem Papsttum bzw. den höchsten Kirchenvertretern entgegengebracht wurde.
Abb 4 Hyacinthe Rigaud: Ludwig XIV. in Feldherrnpose (1701), Tafelbild [<<32]
Die Bilder Hyacinthe Rigauds, des Hofporträtisten Ludwigs XIV. von Frankreich (1643–1715), zeigen den König stets in Herrscherpose, ob mit Herrschermantel oder wie hier als Feldherr. Dabei wird das Bild eines heldenhaften Heerführers konstruiert, das rein der Repräsentation des Sonnenkönigs dient, ihn gleichsam von den kämpfenden Massen im Hintergrund abhebt. Er allein steht im Zentrum. Bedenkt man, dass Ludwig XIV. gerade in seiner zweiten Regierungshälfte nicht mehr selbst in den Krieg zog, so wird deutlich, dass es hier nich um eine reale Szenerie gehen kann. Das Bild entspricht aber auch aufgrund des Wissens über seine um diese Zeit schon weit fortgeschrittene Entstellung durch eine Syphilis-Erkrankung mit Sicherheit nicht der Realität.
Abb 5 Johann Wilhelm Völker: Politischer Damenclub – Karikatur (1848), Federzeichnung
Die Revolutionen von 1789 und 1848 wurden in erster Linie von Männern getragen; die geforderten Bürgerrechte bezogen sich ebenfalls in erster Linie auf Männer. Nichtsdestotrotz regten sich sowohl während der Französischen Revolution als auch im Jahr 1848 immer mehr weibliche Stimmen, die politische Mitsprache für Frauen forderten. Die gegen eine politische Partizipation von Frauen gerichtete Zeichnung [<<33] arbeitet mit den typischen Mitteln der Karikatur. Stereotype Zuschreibungen an Personen(gruppen), in diesem Fall die politisch aktiven Frauen, werden überzeichnet dargestellt: Frauen seien zu keiner konstruktiven politischen Debatte fähig, sie verletzen ihre mütterlichen Pflichten, Wollknäuel und ein Buch mit dem Titel „Stunden der Andacht“ liegen achtlos am Boden, einige sehen die Veranstaltung als Kaffeekränzchen, Flugblätter mit Parolen wie „Kein Mann darf ohne die Frau ausgehen“, „Keine Schläge mehr“ oder „Jeder Man(n) muß heyratten“ werden in die Höhe gehalten.