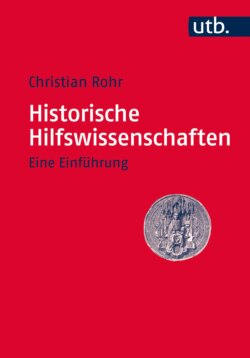Читать книгу Historische Hilfswissenschaften - Christian Rohr - Страница 24
3.6 Dingliche Quellen
ОглавлениеEin Überblick über die große Bandbreite von gegenständlichen Quellen, die als mögliche historische Quellen infrage kommen, kann und soll hier nicht geboten werden. Grundsätzlich kann je nach Fragestellung praktisch alles Dingliche, jede Realie, zur Quelle werden. Grundsätzlich lassen sich aber folgende Großgruppen unterscheiden:
Bauwerke und Reste davon geben Auskunft über frühere Wohnverhältnisse, über Formen der Repräsentation, etwa in Form von prunkvollen Schlössern, oder aber auch über die jeweiligen Geisteshaltungen der Zeit. Romanische Kirchen aus dem Hochmittelalter sind häufig in der Form von trutzigen Gottesburgen erbaut, während die grazilen gotischen Kichen aus dem Spätmittelalter mit ihren in der Regel meist sehr hohen Kirchtürmen den Blick in Richtung Himmel lenken, im Inneren aber mit ihren Lichtdurchstrahlten bunten Glasfenstern einen Vorgeschmack auf das himmlische Jerusalem geben sollen. Die katholischen Barockkirchen des 17. und 18. Jahrhunderts wiederum betonen mit ihrer Verspieltheit und dem umfassenden Kirchenschmuck ein Lebensgefühl, das von dem Bestreben geprägt war, in einem nicht nur religiösen Sinne das Jetzt zu feiern, gerade in Anbetracht von Kriegen und Seuchen. Die Kirchen der reformierten Kirchen hingegen weisen eine betonte Schlichtheit auf: Kirchenschmuck fehlt fast völlig, mit Ausnahme der Orgel. Die historische Bauforschung wird in erster Linie von kunst- und architekturgeschichtlichen Fragestellungen geprägt, die sich vermehrt auch naturwissenschaftlicher Methoden bedient, etwa bei der Verwendung der Radiokarbonmethode zur Datierung des verwendeten Bauholzes.
Menschliche und tierische Überreste bilden eine zweite Gruppe der „dinglichen“ Quellen. Besonders die Archäologie und die Anthropologie beschäftigen sich mit den Knochenfunden, doch sind die Ergebnisse auch aus historischer Sicht interessant: Sie geben Auskunft über die Besiedlungsgeschichte einer Region, besonders wenn schriftliche Quellen dazu weitgehend fehlen (etwa für das Frühmittelalter), sie lassen aber auch Rückschlüsse auf die Körpergröße der Menschen zu, ebenso auf deren Krankheiten und Verletzungen. Massengräber von Pesttoten lassen auf die Dimensionen der Seuche schließen, solche von Kriegstoten auf Gräueltaten, die mitunter in den schriftlichen Quellen verschwiegen oder verschleiert wurden. Tierknochen von (Haus-)Tieren deuten auf die entsprechenden Ernährungsgewohnheiten hin, zeigen aber auch, dass besonders die Großhaustiere wie Rinder, Pferde oder Schweine bis in die Frühe Neuzeit in der Regel deutlich kleiner waren als heute.
Dinge des täglichen Gebrauchs können noch in situ (an Ort und Stelle) oder an anderen Orten (z. B. Museen) in vollständig erhaltener oder fragmentarischer Form vorliegen. Dazu gehören etwa Mobiliar, Schmuck, Geschirr, liturgisches Gerät, Textilien, [<<35] Werkzeuge, technische Geräte etc. Da all diese Gegenstände bestimmten Stilen und Moden unterliegen, können sie in der Regel auch zeitlich näher eingegrenzt werden. Häufig stehen nicht allein der tägliche Gebrauch und der praktische Nutzen im Vordergrund, sondern es geht auch um die Konstitution der sozialen Klasse oder den Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls.
Auch die natürliche Umwelt kann im weitesten Sinne als „dingliche“ Quelle aufgefasst werden: Reste von Altstraßen oder einstigen Kanalprojekten wie der Fossa Carolina, einem Projekt Karls des Großen, das Flusssystem der Donau mit dem des Rheins zu verbinden, finden sich ebenso im Landschaftsprofil wie solche früherer Naturkatastrophen. Gerade innerhalb der Umweltgeschichte geht es darum, die Landschaft „zu lesen“. Damit ist gemeint, dass sich z. B. frühere landwirtschaftliche Nutzungsformen, etwa die Aufteilung von Feldern, mitunter noch heute ablesen lassen, insbesondere aus der Luft.
Der Bereich der dinglichen Quellen macht in besonderem Maße deutlich, dass der Begriff der „Historischen Hilfswissenschaften“ fließend und fachlich übergreifend ist. Im konkreten Fall bedürfen die zeitliche, räumliche und stilistische Einordnung sowie die Interpretation der Zusammenarbeit vieler Disziplinen, neben der Geschichtswissenschaft auch der Archäologie und ihrer naturwissenschaftlichen Nachbarwissenschaften, der Ethnologie, der Anthropologie, der Kunstgeschichte und anderer Disziplinen. Jede Einzeldisziplin fungiert dabei auch gleichzeitig als „Hilfswissenschaft“ für die Nachbardisziplinen, ohne dass damit irgendeine Wertigkeit ausgedrückt wird. In interdisziplinären Projekten geht es genau um diese Notwendigkeit, einander hilfswissenschaftliches Know-how zur Verfügung zu stellen: Zu einem archäologischen Fund können mitunter schriftliche Quellen eine viel präzisere Datierung ermöglichen, als dies die in der Archäologie gängigen, naturwissenschaftlichen Möglichkeiten imstande wären. Umgekehrt ist durch die Archäologie häufig eine genauere Lokalisierung möglich, als dies in der Regel anhand einer schriftlichen Quelle möglich wird. Kunstgeschichtliche Interpretationen von Alltagsgegenständen wären oft nicht ohne das historische Hintergrundwissen möglich und umgekehrt benötigt der Historiker die Expertise der Kunsthistoriker oder Ethnologen, um Gegenstände in ein zeitliches, künstlerisches und soziales Umfeld einordnen zu können.