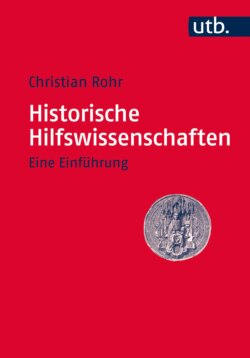Читать книгу Historische Hilfswissenschaften - Christian Rohr - Страница 14
3.3 Das Problem der Quellensprachen:
Mittel- und Neulatein, Volkssprachen
ОглавлениеDas Latein des Mittelalters und der Frühen Neuzeit unterscheidet sich in vielen Punkten vom klassischen Latein. Es sollen daher im Folgenden kurz einige Unterschiede aufgezeigt werden, die für die Lektüre mittelalterlicher Schriften vonnöten sind.
Schon in der Spätantike vollzog sich unter dem Einfluss der lateinischen Bibelübersetzungen, v. a. der sogenannten Vulgata, einer Übersetzung des Kirchenlehrers Hieronymus aus dem späten 4. Jahrhundert, und der Literatur der Kirchenväter eine Reihe von Weiterentwicklungen im lexikalischen und grammatikalischen Bereich. Dieses christlich geprägte Spätlatein ist die Basis des „Mittellateins“. Unter diesem Begriff ist die Gesamtheit der durchaus unterschiedlichen Ausprägungen der lateinischen Sprache im Mittelalter subsumiert. „Das Mittellatein“ gibt es also nicht – ein Umstand, aus dem auch das langjährige Fehlen einer umfassenden mittellateinischen Grammatik resultiert. Erst die neuen Publikationen von Mantello und Rigg bzw. von Stotz können diese Lücke auf Dauer befriedigend füllen.
Das Latein der Spätantike verfiel in der unruhigen Zeit der Merowingerherrschaft im Frankenreich zusehends. Allein der irisch-angelsächsische Bereich und einige Klöster am Kontinent bildeten „Bildungsinseln“. Erst Karl der Große ging daran, die lateinische Sprache auf der Basis des spätantiken Lateins zu restituieren, und rief deswegen die bedeutendsten Gelehrten der damaligen Zeit (Alkuin, Paulus Diaconus, Petrus von Pisa, Theodulf von Orléans und andere) an seinen Hof. Dabei wurde nicht nur eine neue Schrift, die Karolingische Minuskel, geschaffen, sondern auch eine „mittellateinische“ Kirchen- und Verwaltungssprache, die allerdings vom gemeinen Volk oft nicht mehr verstanden wurde. In dieser Zeit entwickelten sich in der Bevölkerung das Althochdeutsche und das Altfranzösische als eigenständige Sprachen heraus, während das Mittellatein vor allem in den Klöstern gesprochen wurde. Diese Mittelstellung zwischen gesprochener Sprache und vorwiegend schriftlich verwendeter Bildungssprache wurde durchaus treffend vom Mittellateiner Karl Langosch umschrieben, der das Mittellatein als „die Vatersprache des Mittelalters“ bezeichnete.
Ein erstes Problem bildet der Wortschatz des Mittellateins: Schon in der Bibelübersetzung des Hieronymus und bei den Kirchenvätern der Spätantike finden sich zahlreiche Neuschöpfungen von Wörtern. Sie werden im Mittelalter durch viele weitere Wörter ergänzt, die ihre Wurzel in den germanischen oder romanischen Sprachen haben: So stammt z. B. feudum = Lehen, aus dem Germanischen; faltstuol = althochdeutsch für Klappsessel, wird latinisiert zu faldistolium, das wiederum ins Französische aufgenommen und zum fauteuil wurde. Im Spätmittelalter, besonders durch die philosophische [<<20] Strömung der Scholastik, kamen zusätzlich Neuschöpfungen hinzu. Außerdem waren viele Wörter einem Bedeutungswandel unterworfen, z. B. comes, klassisch „Begleiter“, mittellateinisch „Graf“ u. v. a. m.
Aus der „Explosion“ mittellateinischer Wortschöpfungen resultiert das Problem eines Lexikons des Mittellateins: Das einzige ausführliche Lexikon von Du Cange stammt ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert und liegt heute in der Überarbeitung aus dem späten 19. Jahrhundert vor. Die Begriffe werden dabei nur lateinisch umschrieben. Das einzige modernere Handwörterbuch von Niermeyer führt jeweils eine englische und französische Übersetzung an, in der neuesten Ausgabe zusätzlich auch eine deutsche. Das „Mittellateinische Glossar“ von Habel und Gröbel taugt lediglich für einen ersten Einstieg; die gängigen lateinisch-deutschen Schulwörterbücher (Stowasser, Langenscheidt) berücksichtigen in ihren letzten Überarbeitungen erstmals einige wenige mittellateinische Texte. Die großen Unternehmungen zur Erstellung von mittellateinischen Lexika zeichnen sich vornehmlich dadurch aus, unvollständig zu sein, wobei die Fertigstellung – gerechnet nach dem derzeitigen Fortschreiten der Arbeiten – noch viele Jahrzehnte dauern könnte. Das von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegebene Mittellateinische Wörterbuch hat nach knapp 50 Jahren immerhin die Buchstaben A bis H bewältigt.
Ein weiteres Problem bildet die uneinheitliche Orthographie des Mittellateins: Buchstaben wurden besonders in merowingischer Zeit häufig vertauscht (e/i, o/u, b/v); ae wurde seit dem Hochmittelalter immer häufiger als e-caudata (ę – e mit einem Schwänzchen), ab dem 12. Jahrhundert fast ausschließlich als reines e geschrieben. Konsonanten wurden verdoppelt oder Doppelkonsonanten vereinfacht. Der Buchstabe h im Anlaut fiel nicht selten aus oder wurde neu hinzugefügt; ti wurde im Spätmittelalter auditiv als ci geschrieben.
In der Formenlehre treten nicht selten Vereinfachungen auf. Besonders Wörter der „schwierigen“ e-, i- und u-Deklination wurden gemieden oder in Wörter der a- und o-Deklination umgewandelt. Pronomina wechselten zum Teil ihre Funktion und Bedeutung: So wird ille zum Ersatz des im klassischen Latein fehlenden bestimmten Artikels verwendet – heute noch spürbar in den bestimmten Artikeln der romanischen Sprachen. Einige Präpositionen starben fast aus, andere wiederum, besonders de, wurden in vielfältiger Bedeutung verwendet.
Das Alt- und Mittelhochdeutsche ist hingegen sowohl lexikalisch als auch durch einführende Überblicksdarstellungen viel besser erschlossen. Das in vielen Auflagen erschienene Mittelhochdeutsche Wörterbuch von Matthias Lexer hilft in den meisten Fällen zuverlässig weiter. Für das Deutsch des Spätmittelalters, besonders aber auch [<<21] der Frühen Neuzeit existiert das immer wieder überarbeitete, vielbändige Lexikon der Gebrüder Grimm (die neben ihrer Märchen-Sammeltätigkeit vor allem Germanisten waren und zu den Mitbegründern der deutschen Philologie wurden). Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts löste das Mittelhochdeutsche die lateinische Sprache in den meisten Urkunden ab. Dieses Fachdeutsch ist zum Teil recht schwierig im Detail zu deuten. Eine erste Hilfe für das Verständnis stellt sich meist ein, wenn man versucht, die Texte laut zu lesen.