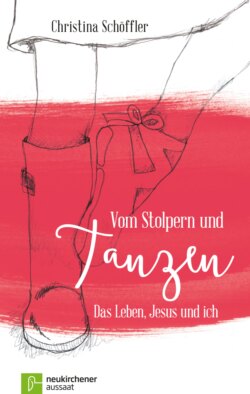Читать книгу Vom Stolpern und Tanzen - Christina Schöffler - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Wo ich herkomme
ОглавлениеEs gibt Geschichten, die sind so außergewöhnlich und atemberaubend, dass sie einfach erzählt werden müssen. Sie bringen uns zum Träumen und zum Staunen. Und es gibt Geschichten, die klingen ganz gewöhnlich und vertraut, und auch sie müssen erzählt werden. Sie können uns Mut machen, weil sie uns sagen, dass wir nicht alleine sind. Deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, dass jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden – sogar meine eigene.
Die amerikanische Schriftstellerin Flannery O’Connor soll einmal gesagt haben: „Wer seine Kindheit überlebt, hat genug Material für den Rest seines Lebens.“ In den nächsten Kapiteln will ich ein wenig davon erzählen, wo ich herkomme. Weil unsere Vergangenheit viel darüber aussagt, wie wir die Welt heute sehen. Warum wir mit manchen Dingen immer wieder kämpfen. Und warum wir lieben, was wir lieben.
Ich wuchs Anfang der 70er-Jahre in einem Schwarzwalddorf auf. Meine Erinnerungen malen das Bild einer guten und unbeschwerten Kindheit. Heute würde man vielleicht sagen: Ich hatte ein stabiles Umfeld. Da waren die zuverlässige Liebe meiner Eltern, eine warmherzige Oma und mein Onkel, die mit uns im gleichen Haus wohnten, und viele vertrauensvolle Beziehungen in unserem Ort. In dem kleinen Laden um die Ecke konnte ich meine Gummischlangen immer anschreiben lassen, und meine Mutter hat die Pfennigbeträge dann später bezahlt. Die Geschichten von Jesus waren mir so vertraut wie das abendliche Glockenläuten unserer Kirche, und ich wuchs mit der tiefen Zuversicht auf, dass Jesus immer da ist und mich lieb hat.
Manche Theologen bringen unsere frühkindlichen Vertrauenserfahrungen in Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, Gott zu vertrauen.2 Ich glaube, das ist wirklich so, und es ist der größte Schatz, den mir meine Eltern mitgegeben haben. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.
Meine erste Erinnerung ist, wie wir vor einem kleinen SchwarzWeiß-Fernseher mit Eis und Wunderkerzen die Mondlandung gefeiert haben. Ich sollte hinzufügen, dass mein Mann diese Geschichte stark anzweifelt. Gut, ich war erst drei Monate alt, aber es gibt ja auch begabte Kinder, die sich an so eindrückliche Erlebnisse erinnern können. (Eine andere Erklärung wäre, dass man im Schwarzwald die Ereignisse etwas später gefeiert hat, oder dass es die ersten Russen auf dem Mond waren.)
Die Kirche stand direkt neben meinem Elternhaus, und wir verbrachten viel Zeit dort. Wenn ich an den Kindergottesdienst denke, fällt mir sofort das ältere Fräulein ein (so nannte man die unverheirateten Frauen damals noch), das uns die Geschichten der Bibel erzählt hat. Ich erinnere mich an die Flanellbilder, an die harte Bank und vor allem an die wackelnde Zahnprothese unseres Fräuleins. Fasziniert starrte ich auf ihren Mund und wartete ständig auf den Moment, in dem das Gebiss auf den Kirchenboden aufschlagen würde. Leider ist das nie passiert.
Dann erinnere ich mich an die schwere Hand meiner Mutter, die jeden Abend auf meinem Kopf lag, um mich zu segnen. Davor kam ein kurzes Abendgebet, das vor allem aus drei Bitten meinerseits bestand: „Bitte, lieber Gott, lass unser Haus nicht abbrennen, lass Mama und Papa nicht sterben und lass keinen Ohrwusler in mein Ohr kommen. Amen.“ Ich hatte die kindliche Vorstellung, dass mir ein Ohrwurm ins Ohr kriechen, sich durch mein Trommelfell beißen und ich für den Rest des Lebens taub sein würde. Heute (also genau seit zwei Minuten, dank Wikipedia) weiß ich, dass diese Tiere deshalb Ohrwürmer genannt werden, weil sie früher pulverisiert als Mittel gegen Taubheit und andere Ohrenkrankheiten verabreicht wurden. Na toll. Hätten meine Eltern sich nicht einmal über diesen Wurm informieren können? Stattdessen hörten sie jahrelang meinem flehentlichen Abendgebet zu und ließen mich mit der Angst einschlafen, am Morgen völlig gehörlos aufzuwachen.
Ich wuchs zusammen mit meiner älteren Schwester auf, die ich liebte und zutiefst bewunderte. Zusammen mit anderen Kindern in unserer Nachbarschaft verbrachten wir viele Nachmittage damit, draußen zu spielen. Es war herrlich. Ich durfte Kind sein, und das ganze Dorf war unser Spielzimmer. Der einzige Junge, der mich damals interessierte, war Michel aus Lönneberga. (Leider hat er auf meinen schriftlichen Heiratsantrag bis heute nicht geantwortet. Was hätte aus meinem Leben werden können!)
Mein Vater war Uhrmacher und arbeitete in einem kleinen Geschäft, das meinem Großvater gehörte. Ein- oder zweimal im Jahr fiel eine Horde Amerikaner ein, um Kuckucksuhren zu kaufen. An den restlichen Tagen blieb es im Laden ziemlich ruhig. Ich sehe meinen Vater noch vor mir, wie er an der Werkbank saß, ein Vergrößerungsglas auf seiner Brille, und sorgfältig die kleinen Uhrrädchen auf Fehler untersuchte. Er war dafür bekannt, dass er Uhren reparieren konnte, die sonst keiner mehr angenommen hätte. Für ihn gehörte es zur Ehre seines Handwerks, gerade die alten Uhren wieder zum Laufen zu bringen. Er dachte nicht daran, dass dieser Ehrgeiz irgendwie geschäftsschädigend sein könnte und er den Leuten besser neue Uhren verkaufen sollte. Im Gegenteil. Ich erinnere mich, dass er an einigen Uhren ganz besonders hing und sie deshalb nur unter größtem Widerstand über die Ladentheke schob.
Ich mochte seinen Laden, das Ticken der Uhren, den Kachelofen, an dem wir im Winter unsere Hände wärmten. Mein Vater war ein großzügiger Mann, er verlangte für seine Reparaturen meist viel zu wenig Geld. Im Rückblick denke ich, dass wir ein relativ einfaches Leben geführt haben, aber ich empfand mich als Kind sehr reich. (Und das war ich ganz sicher auch!)
Mein Vater war ruhig und im Umgang mit anderen sehr direkt, manchmal auch etwas harsch. Meine Mutter war mit ihrer fröhlichen und freundlichen Art das genaue Gegenteil. Sie war immer auf dem Sprung, um irgendjemandem zu helfen. Sie kümmerte sich liebevoll um uns und um das halbe Dorf, und ich bewunderte sie zutiefst. Ich glaube, wir Töchter werden sehr von unseren Müttern geprägt. Meine Mutter vermittelte mir: Wenn jemand unsere Hilfe braucht, dann sind wir für ihn da – egal, wie es uns selber geht. In seltenen Momenten sah ich sie erschöpft und schmerzgeplagt. Aber sobald es an der Tür läutete oder das Telefon klingelte, war sie wieder auf den Beinen, bereit, für andere da zu sein. Das passte gut dazu, dass mir die christliche Botschaft vor allem als Selbstaufgabe vermittelt wurde und als Gebot, meinen Nächsten mehr zu lieben als mich selbst.
In unserem kleinen Kinderzimmer, das ich mit meiner Schwester teilen durfte, hing ein etwas düsteres Bild. Darauf war ein riesiger Mann abgebildet, der ein Kind mühsam auf den Schultern durch tiefes, dunkles Wasser trug. Auf Nachfragen erfuhr ich, dass es den heiligen Christophorus zeigte. Einer Legende zufolge gab es diesen großgewachsenen Typen namens Offerus, der dank seiner Größe Leute wie ein Fährmann durch ein tiefes Flussbett tragen konnte. Eines Tages wollte ein Kind über den Fluss – eine leichte Übung für ihn. Je länger er aber durch das Wasser watete, umso schwerer wurde das Kind. In der Mitte des Stroms keuchte Offerus: „Kind, du bist so schwer, als hätte ich die Last der Welt zu tragen.“ Das Kind antwortete ihm: „So ist es. Ich bin Christus, und ich trage die Last der Welt. Und weil du mich getragen hast, sollst du Christopherus heißen – der, welcher Christus trägt.“
Dieses Bild hing am Fußende meines Bettes, und jeden Abend fiel mein Blick vor dem Einschlafen auf dieses Gemälde. Dabei hatte ich jedes Mal das beklemmende Gefühl, dass es meine Verantwortung wäre, Jesus zu tragen, wohin er wollte. Und ich ahnte, dass dies eine ziemlich schwere Last war (sozusagen die Umkehrung des berühmten Fußspurengedichts von Margaret Fischback Powers: „… da trug ich dich auf meinen Schultern“). Ich wollte Christus ja tragen, aber ich dachte: Wenn schon der riesige Mann das nicht schafft, wie soll ich es dann hinbekommen?
Eine alte Tante von uns sprach immer davon, dass wir den Herr Jesus nicht traurig machen dürften. Dabei schaute sie mich so an, dass ich mir sicher war: Jesus weint wohl sehr viel wegen mir.
Also wuchs ich einerseits in einer ziemlich heilen Welt, in einem liebevollen Umfeld auf, andererseits kamen ein paar Dinge in mein Kinderherz, die mir nicht guttaten. Und ich bin skeptisch, wenn ich höre, wie leichtfertig manche Menschen bei einem „FroKi“ (einem frommen Kind) denken: Na, dann ist ja alles gut. Trotz meiner behüteten Kindheit hatte ich doch immer das Gefühl, dass ich ziemlich kaputt war, und mir war klar, dass ich auf längere Sicht die eine oder andere Reparatur benötigen würde.
Wie gut, dass Gott da meinem Vater sehr ähnelt und es seine Leidenschaft ist, kaputte Dinge wieder ganz zu machen!