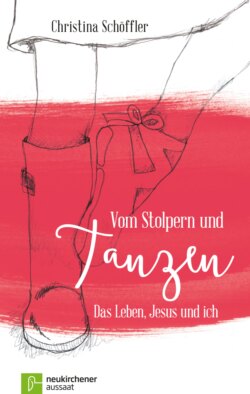Читать книгу Vom Stolpern und Tanzen - Christina Schöffler - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Außergewöhnlich gewöhnlich
ОглавлениеMeine Eltern hatten ein Herz für die Mission, und deshalb schauten bei uns immer wieder Missionare auf ihrem Heimaturlaub vorbei. Meistens waren dies außergewöhnliche Persönlichkeiten, die in irgendeiner Landestracht auftauchten, fremdartige Lieder vortrugen, Dias von fernen Orten zeigten und merkwürdige Geschenke hinterließen. Ich beobachtete sie staunend und spürte, dass sie in den Augen meiner Eltern und der Leute in der Gemeinde etwas ganz Besonderes waren.
Also fasste ich den Entschluss, auch Missionarin zu werden. Als Jugendliche las ich reihenweise die Abenteuerbücher des Missionspiloten Danny Orlis und träumte mich an seine Seite. Wir würden wilde Abenteuer bestehen und ein außergewöhnliches Leben führen. Dass ich nach Gottes Willen leben wollte, war selbstverständlich – meinen eigenen Willen (von dem ich keine Ahnung hatte) hatte ich schließlich als Kind schon an ihn abgegeben. Ich, Christina, wollte die „Christusträgerin“ sein, bis ans Ende der Welt. Außergewöhnlich wollte ich sein und etwas ganz Besonderes für Gott tun.
Die christliche Kultur, in der ich aufgewachsen bin, verstärkte diesen Gedanken noch. Da war viel die Rede davon, etwas Großes für Gott zu machen: „Gott hat einen Plan mit deinem Leben“, „Du kannst mit Gott die Welt verändern“, „Gott hat eine besondere Berufung für dich“ – und ich wollte das so gerne glauben! Da ich ein ganz gewöhnliches Mädchen aus dem Schwarzwald war, ohne berühmte Eltern oder krasse Vergangenheit (beides Dinge, mit denen man damals in christlichen Kreisen hätte punkten können), dachte ich: Dann werde ich eben etwas ganz Besonderes für Gott machen. Ganz bestimmt will ich kein gewöhnliches Leben mit Mann, Kind und Eigenheim. Ich lebe lieber ungewöhnlich.
Der Start dazu war denkbar schlecht: Ich machte eine Ausbildung zur Krankenschwester, was damals so ungefähr jedes zweite christliche Mädchen tat. Wahlweise hätte ich noch Erzieherin werden können, aber nach einem Vorpraktikum in einem Kindergarten stellte ich fest, dass Basteln nicht zu meinen größten Begabungen gehört und Kinder in größeren Ansammlungen unglaublich anstrengend sein können.
Zu der Zeit las ich Das Kreuz und die Messerhelden von David Wilkerson, eine wahre Geschichte über die Erweckung bei Straßengangs in New York. Das Buch hatte mich gepackt und ich sah mich schon helfend und predigend durch die Straßen der gefährlichen Innenstädte ziehen. Schusswunden versorgen zu können, wäre dabei doch sehr hilfreich, dachte ich mir. Deshalb entschied ich mich dafür, die einzige mir sinnvoll erscheinende Alternative zur Erzieherin zu wählen, und wurde Krankenschwester. Da das Versorgen von Schusswunden nur einen sehr geringen Teil der Ausbildung ausmachte (bei dem ich unglaublich aufmerksam war!), quälte ich mich mehr schlecht als recht durch diese Jahre.
Natürlich wollte ich nie in einem „normalen“ Krankenhausbetrieb arbeiten und suchte mir nach meinem Examen die heftigeren Aufgaben aus: Pflege von AIDS-Kranken, Arbeit mit Drogenabhängigen und dazwischen internationale Einsätze. Ich war bereit für Großes. Auf sämtlichen Konferenzen ging ich nach vorne, um Gott ganz mein Leben zu weihen, aber irgendwie kam es mir vor, als würde er mein Angebot dankend ablehnen.
Eine Arbeit in Amsterdam zerschlug sich, und ich blieb im normalen Alltag in Deutschland stecken. Anstatt in New York Schusswunden zu säubern, wusch ich in Stuttgart-Vaihingen die Füße von alten Menschen. Alles klar, dachte ich mir, das ist jetzt wohl der Test, dass ich im Kleinen treu sein soll. Wird gemacht. Also erledigte ich die Fußwaschungen voller Hingabe, in der Hoffnung, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis Gott meine Treue belohnen und mich zu Höherem berufen würde.
In dieser Zeit hörte ich von Martin Dreyer und der Jesus-Freaks-Bewegung in Hamburg. Wieder flammte die Sehnsucht auf, etwas Besonderes für Gott zu tun, in einem radikalen Umfeld. Vielleicht lag die Berufung, nach der ich mich sehnte, ja direkt vor meiner Haustür! Also gründete ich mit ein paar Leuten die „Jesus Freaks Stuttgart“. Wir waren mit Feuereifer dabei und von dem Gedanken erfasst, etwas Außergewöhnliches, Neues zu machen – anders als alle anderen Gemeinden zu der Zeit. Und vieles davon war wirklich außergewöhnlich: Punkmusik, bekiffte Prediger, Alkoholausschank während des Gottesdienstes. Und es sind tatsächlich wilde und auch ganz wunderbare und außergewöhnliche Dinge passiert. Einmal durfte ich sogar beim Freakstock auf der großen Bühne predigen. Aber ich bin eigentlich immer nur ich selbst geblieben: ein ganz gewöhnliches Mädchen aus dem Schwarzwald. (Nichts gegen Schwarzwälder – da gibt es ja auch außergewöhnliche Menschen. Man denke nur an Tony Marshall oder Jürgen Klopp!)
Mit den Jahren kamen mir allerdings Zweifel, ob dieses Etwas-Besonderes-sein-Wollen nicht viel mehr mit unserer Kultur zu tun hat als mit echtem christlichem Glauben. Und je besser ich mich kennenlerne, desto mehr fürchte ich, dass mein Drang, wichtig sein zu wollen, aus einem Defizit in meinem Herzen kommt – von der leisen Befürchtung, so wie ich bin, nicht genug zu sein. Vielleicht hat Gott mich vor manchen Wegen bewahrt, die meinen Wunsch, etwas Besonderes zu sein, befriedigt hätten. Ich hätte sonst womöglich noch länger gebraucht, um zu erkennen, dass nicht entscheidend ist, was ich für Gott tue. Nicht ich bin die „Christusträgerin“, sondern Gott trägt mich. Und er flüstert mir zu: „Christina, weißt du eigentlich, wie außergewöhnlich geliebt du bist?“ Es ist keine krasse Aufgabe, für die ich leben muss. Ich muss Gott nichts beweisen, sondern es ist seine Liebe, die es schafft, mein unruhiges Herz zur Ruhe zu bringen.
Ich habe lange (bewusst oder unbewusst) versucht, etwas Besonderes, Außergewöhnliches hinter meinen Namen zu schreiben:
Christina, die Missionarin;
Christina, die eine krasse Arbeit macht;
Christina, die jedem hilft und sich aufopfert;
Christina, die toll predigt;
Christina, die außergewöhnliche Gedanken hat.
Aber das alles ist nicht Teil meines Namens und wäre schon gar nicht der entscheidende Teil. Mein Name lautet einfach: Christina, von Gott geliebt. Damit ist das Wichtigste gesagt. Ich bin, so wie ich bin, von Gott geliebt. Und dieser Zusatz macht mich, macht jeden von uns zu etwas Außergewöhnlichem. Diese Wahrheit versuche ich langsam zu begreifen, mitten in meinem ganz gewöhnlichen Leben.
Ich habe gesagt, dass jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Das glaube ich wirklich. Nicht, weil es eine krasse Erfolgsgeschichte ist, sondern weil jede Geschichte im tiefsten Kern eine spannende und berührende Liebesgeschichte ist. Der Held dieser Geschichte bin nicht ich, sondern Jesus. Ich bin die Geliebte, die gerettet werden muss. So sieht es aus. Du und ich, wir sind ganz außergewöhnlich geliebt. Und diese Tatsache macht uns, macht unser Leben, zu etwas ganz Besonderem.