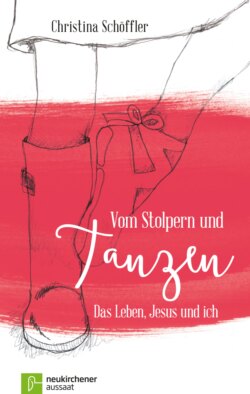Читать книгу Vom Stolpern und Tanzen - Christina Schöffler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Schlaflos in St. Petersburg
ОглавлениеEs war mitten in der Nacht. Ich stolperte durch die Straßen von St. Petersburg, in mir nur ein Gebet: „Jesus, bitte, bitte hilf mir, dass ich nicht in eine russische Psychiatrie eingeliefert werde.“
Was war passiert? Ich hatte mich einem Team von 24-7 angeschlossen, einer Gebetsbewegung aus England, und war nach Russland gereist, um dort während des Sommers den Menschen zu dienen.
Damals war ich im Leitungsteam der Jesus Freaks. Heftige Zeiten lagen hinter uns – Schicksalsschläge in unserer Gemeinde, die viele von uns erschüttert hatten. Einer meiner besten Freunde, in den ich auch noch verliebt war, hatte einen schweren Unfall und lag wochenlang im Koma. Wir beteten und glaubten und standen dann fassungslos an seinem Grab. Ich fiel in eine tiefe Traurigkeit und war gleichzeitig bemüht, die Gemeinde zusammenzuhalten. (Als ob das an mir liegen würde!) Die Fragen nach Gottes mangelndem Eingreifen blieben und verstärkten sich noch, als eine Freundin nach einem Unfall dauerhaft gelähmt war.
Eigentlich denke ich, dass Gott unseren Glauben stärken will. Aber es gibt Zeiten, da ist es, als würde er eine riesige Abrissbirne in unser Glaubenshaus schmettern, und wir können nur dabeistehen und hoffen, dass es keine tragenden Pfeiler trifft. Diese Zeit hat mir etwas von meinen unbedarften Überzeugungen genommen – in Bezug auf das, was Gott tut und was er uns ganz bestimmt nicht zumuten wird. Und es hat mich das Schweigen gelehrt über Dinge, die ich einfach nicht verstehe. (Und die Erkenntnis, dass viele Tränen erst im Himmel getrocknet werden.)
Aber nicht nur mein Glaube wurde brüchiger. Mein ganzes Leben geriet ins Schleudern. Neben der Gemeindeleitung arbeitete ich im Drogenentzug und war auch hier mit großer Not konfrontiert. Oft konnte ich nur hilflos daneben stehen und zusehen, wie junge Leute vergeblich gegen ihre Sucht ankämpften. Ich fühlte mich zunehmend überfordert und ausgelaugt. Äußerlich hielt ich meine „Alles in Ordnung – wie kann ich helfen?“-Fassade aufrecht, aber wenn ich alleine war, brach eine tiefe Traurigkeit auf. Ich kam kaum zur Ruhe, fühlte mich ständig erschöpft und einsam. Meine Leere stopfte ich mit Essen und Dingen, die mir nicht guttaten. All das waren Anzeichen dafür, dass es höchste Zeit war, langsamer zu machen, aber ich war wie ein Schnellzug auf einem Gleis, unfähig die Richtung zu wechseln oder anzuhalten. Die Not der Menschen war groß, also machte ich weiter, auch wenn mein Tank längst im roten Bereich war. Und anstatt Sommerurlaub zu machen, nahm ich nun an einem Einsatz in St. Petersburg teil.
Nach einer Woche in Russland reiste der Leiter ab und übertrug die Verantwortung für das Team einer jungen Engländerin und mir. Inzwischen war ich am Ende meiner Kräfte. Hinzu kam noch, dass wir zur Zeit der sogenannten „weißen Nächte“ dort waren, was bedeutete, dass die Sonne nie wirklich unterging. Mir schien es, als hätten unsere russischen Freunde ihren Jahresrhythmus so eingestellt, dass sie in dieser Zeit sehr wenig Schlaf benötigten (der wurde dann im dunklen Winter nachgeholt). Sie waren also oft bis in die frühen Morgenstunden unterwegs, um auf den Straßen von St. Petersburg nach Menschen in Not Ausschau zu halten. Als Teamleiterin konnte ich schlecht sagen: „Viel Spaß, ich bleibe zu Hause und schlafe eine Runde!“, und so bin ich, oft völlig entkräftet, mitgegangen.
Und in einer dieser Nächte fürchtete ich tatsächlich, erschöpft zusammenzubrechen und in einer russischen Psychiatrie zu landen. Der Gedanke war vielleicht deshalb besonders beängstigend für mich, weil ich als Kind immer für die verfolgten Christen in Russland gebetet hatte. Ich hatte gehört, dass einige von ihnen jahrelang in psychiatrischen Kliniken festgehalten wurden und man sie Elektroschock-Therapien und Gehirnwäsche unterzog. Mein Vertrauen in das russische Gesundheitswesen hielt sich also in Grenzen – aber Gott sei Dank musste ich nie herausfinden, ob es dort heute anders abläuft (wovon ich aber stark ausgehe).
In diesen Tagen in Russland erlebte ich aber auch, dass Gott das Wenige, was ich noch in der Hand hatte, segnete. Er hat ja eigentlich nie ein Problem mit unseren Schwächen. Vielleicht eher mit unserer vermeintlichen Stärke. Deshalb ist mir diese Zeit trotz meines geschwächten Zustands doch in guter Erinnerung geblieben, und ich habe mich auf ewig ein wenig in diese wunderbaren russischen Jugendlichen verliebt.
Doch als ich wieder in Deutschland war, hatte ich dann den gefürchteten Zusammenbruch. Ich erinnere mich noch genau an den Moment: Auf dem Weg zu einer Freundin fuhr ich auf eine Ampel zu, die auf Rot umsprang. Diese Tatsache löste einen solchen Weinkrampf in mir aus, dass ich kaum noch weiterfahren konnte. Von da an lag ich jeden Abend weinend im Bett. Die Tränen strömten mir übers Gesicht, ohne dass ich einen Grund dafür finden konnte. Es war, als wollte meine Seele in mein Bewusstsein dringen, um mir zu sagen: „Stopp. Mir geht es nicht gut. Kümmere dich bitte um mich.“
Ich legte mein Leitungsamt nieder, und erstaunlicherweise brach die Gemeinde nicht zusammen. Es war heilsam festzustellen, dass ich nicht die tragende Säule war, sondern dass es Jesus war und ist, der uns trägt (und die ganze Zeit getragen hat). In einem Buch von Thomas Härry habe ich gelesen, dass der hebräische Wortstamm von „glauben“ (aman) eine Mutter beschreibt, die ihr Kind ganz nah bei sich trägt. Und er schreibt dazu: „Es gibt für mich keine schönere Umschreibung davon, was Glaube im tiefsten bedeutet, als diese: Ich werde von meinem Gott getragen. … Ein Glaubender ist ein Getragener.“3 Was für ein schönes Bild! Das hätte ich gerne in meinem Kinderzimmer an der Wand gehabt. (Sorry, Offerus …)
Und ganz langsam fing ich nun auch an zu lernen, mich nicht immer nur um andere zu kümmern, sondern auch um meine eigene Seele. Mir wurde klar, dass ich meistens sehr gut wusste, wie sich andere Menschen fühlten und was sie brauchten – aber ich hatte keine Ahnung, wie ich mich fühlte und was ich brauchte. Von klein auf hatte man mir beigebracht, nach Gottes Willen zu fragen, und ich glaubte, dass mein eigener Wille Gottes Plan im Weg stand. Deshalb war ich völlig unvorbereitet auf die sanfte Frage Gottes, die an mein Ohr drang: „Und was willst du, meine geliebte Tochter?“
Wie ein kleines Kind musste ich herausfinden, wer ich wirklich war, was ich wollte und was meine Seele brauchte. Anstatt Verantwortung für alle anderen Menschen zu übernehmen, lehrte Gott mich ganz sanft, Schritt für Schritt, Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Das war nicht einfach. Ich war froh, dass mir eine Therapeutin dabei half, die ersten Schritte in eine gesunde Richtung zu gehen. Mit ihr versuchte ich Antworten zu finden auf die für mich – auch heute noch – schwierigen Fragen: Wie geht es mir? Wo sind meine Grenzen? Was raubt mir zu viel Kraft? Was muss ich abgeben? Und was macht mich lebendig?
Es geht langsam voran, und oft bin ich frustriert darüber, dass ich vieles immer noch so schlecht hinbekomme. Aber im Rückblick sehe ich doch, dass ich schon ein ganzes Stück Weg zurückgelegt habe.
Und wenn ich an die Christina denke, die vor fünfzehn Jahren in St. Petersburg durch die Straßen stolperte und sich keine Ruhe gönnte, dann würde ich sie gerne in den Arm nehmen und ihr sagen: „Christina, unter allen Menschen, denen du gerade dienen willst und um deren Nöte du dich sorgst, ist ein Mensch, der es am nötigsten braucht: Sorge für deine Seele. Sei freundlich und geduldig mit ihr. Komm zur Ruhe. Hab Vertrauen. Lass dich tragen. Und lass Gott deine Wunden verbinden.“
Vielleicht hätte ich mich dagegen gewehrt und gesagt: „Aber ich will doch Gott zu Ehren leben, seinen Willen tun und mich nicht um mich selbst drehen!“ Heute ahne ich etwas davon, dass bei Gott das Vertrauen viel wichtiger ist als all mein getriebenes Machen und Tun. Er will mein Sein segnen und sorgt sich mehr darum, mein Herz heil zu machen, als darum, ob ich weiter funktioniere, auch wenn ich am Ende dabei kaputtgehe.
„Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch“, hat Irenäus von Lyon gesagt. Und im großen Glaubensbekenntnis von Nicäa steht: „Wir glauben an den heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht.“ Deshalb lerne ich zu beten: „Jesus, mach etwas aus mir zu deiner Ehre. Mach mich heil und ganz lebendig.“
Und ich glaube, Gott sagt dazu voller Liebe: AMEN.