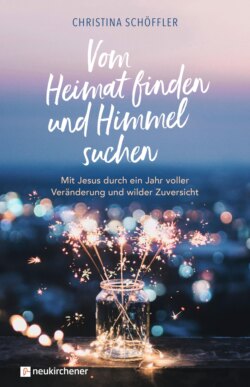Читать книгу Vom Heimat finden und Himmel suchen - Christina Schöffler - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление• 04 •
Kaddisch im Februar
Inzwischen ist es Februar. Draußen war es die letzten Tage kalt und ungemütlich. Heute Morgen wecken mich die Sonnenstrahlen. Der Blick nach draußen in unseren Garten ist aber eher deprimierend. Karge Äste. Schlammiger Boden. Vertrocknete Pflanzen vom letzten Jahr. Eine kahle Stelle da, wo vor einigen Monaten noch unser Hasenstall stand. Dreckige Gummistiefel auf der Terrasse und ein modriger Geruch in der Luft. Nein. Heute hebt die Sonne meine Stimmung nicht. Ihr Licht zeigt einfach, warum der Februar besser trübe und verregnet sein sollte. Diese Armseligkeit muss man nicht beleuchten. Seufzend schenke ich mir die erste Tasse Kaffee ein und halte mich ein wenig an dem warmen Keramikbecher fest. Und wie so oft in diesen Tagen wandern meine Gedanken zu den Ereignissen vor einem Jahr. Was im Februar als schmerzhafte, aber eigentlich harmlose Rückenverletzung bei meiner Mutter begonnen hatte, wurde innerhalb weniger Wochen zu ihrem Todeskampf. Morphium, Verwirrtheit mit kurzen, klaren Momenten auf ihrer Seite. Endlose Autofahrten, Arztgespräche, Erschöpfung, alles geben und doch so viel schuldig bleiben auf meiner Seite. In den Tagen vor ihrem Tod war meine Mutter von einer großen Zuversicht erfüllt. Aber die letzten Stunden waren schwer. »Manchmal bringt Gott seine Kinder im Dunkel ins Bett«11, sagte der Schweizer Theologe und Schriftsteller Samuel Keller. Genauso fühlte sich der Abschied an. Mir blieb nur noch, sie im Arm zu halten – die Mutter, die mich so viel gehalten hatte – und über ihre letzten mühsamen Atemzüge auf dieser Erde zu wachen. Ich vergrub meinen Kopf in ihrem Schoß, der Ort aus dem ich geboren wurde, und spürte, wie der vertraute Körper langsam kalt wurde. Lange saß ich neben ihr und hielt ihre schwieligen Hände. Hände, die so viel gearbeitet hatten, die unzählige Male Essen auf den Tisch gestellt, Pflaster auf Knie geklebt und Tränen abgetrocknet hatten. Hände, die in meiner Kindheit allabendlich segnend auf meinem Kopf gelegen und sich bis zum Schluss treu zum Gebet gefaltet hatten, für mich und viele andere Menschen. Wir begruben ihren Körper neben dem Körper meines Vaters. Asche zu Asche, Staub zu Staub. So endet das Leben. Wir sprachen davon, dass meine Mutter nun bei ihrem geliebten Heiland ist, dass sie nun sehen darf, was sie geglaubt hat. Aber in mich war eine Kälte gekrochen. Und was, wenn nun alles nicht stimmt? Wenn der Tod einfach das Ende und Aus ist? Es war nicht das erste Mal, dass ich einen geliebten Menschen verlor. Und es war auch nicht das erste Mal, dass mich Zweifel überfielen. Zweifel tauchen in meinem Glaubensleben so regelmäßig auf wie lästige Tauben neben der Parkbank. Ich versuche sie einfach nicht zu füttern. Aber dieses Mal war es anders. Ich konnte sie nicht mal eben verscheuchen. Diese Begegnung mit dem Tod hat meinen Glauben tiefer erschüttert als alles zuvor. Vielleicht ist das so, wenn die Mutter stirbt.
Zuerst habe ich kaum gewagt, darüber zu sprechen. Als würde alleine durch das Aussprechen meiner Zweifel noch mehr Hoffnung wegbrechen. Irgendwann saß ich dann doch bei meiner Seelsorgerin. Sie hörte zu. Sie segnete mich. In ihren Worten lag die große Zuversicht, die mir abhanden gekommen war. Ich fühlte mich zurückversetzt in meine Kindheit, wenn ich im Winter von draußen kam und meine Mutter meine kalten Hände so lange rieb, bis sie langsam wieder warm wurden. Ich wärmte mich in der Seelsorge. Ich wärmte mich auch an der Hoffnung meiner Weggefährten, wenn wir Sonntag für Sonntag zusammen die Glaubenswahrheiten aussprachen und sangen, die mir so vertraut waren und die mir doch im Moment so schwer über die Lippen gingen. Und ich wärmte mich an den Worten von dem, der von sich sagt, dass er die Auferstehung ist. Ich las die Kapitel der Jesusgeschichte so, als würde ich sie zum allerersten Mal lesen. Ganz langsam. Hier war sie: die Schönheit meines Glaubens. Und doch wirkte plötzlich alles so seltsam fern. Ich las Abschnitt für Abschnitt mit der drängenden Frage: »Was hast du noch mal gesagt, Jesus? Worauf kann ich wirklich meine Hoffnung setzen?« Und ich fand mich vor der Frage wieder, die Jesus Martha stellte, als sie ihren toten Bruder beweinte: »Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, glaubst du das?« Sanft und klar klang es: »Christina, glaubst du das?« Seine Frage erhellte mein Inneres wie die Februarsonne. Sie offenbarte die Abwesenheit der kindlichen Zuversicht, die mir irgendwo auf der Strecke abhanden gekommen war.
Wenn mich die vergangenen Monate eins gelehrt haben, dann das: Manches im Leben kann man nicht schnell wegstecken. Manche Zeiten kann man genauso wenig überspringen wie eine ungeliebte Jahreszeit. Man muss sich da durchleben. Und das kann dauern. Denn im Schmerz humpelt die Seele in Schrittgeschwindigkeit. Diese Erkenntnis ist in der jüdischen Glaubenstradition fest verankert. Die ehemals orthodoxe Jüdin Lauren Winner beschreibt, dass Trauern im Judentum wie eine Disziplin ist, zu der man ganz bewusst aufgefordert wird. Das Jahr nach dem Tod eines geliebten Menschen wird als wichtige Zeit wahrgenommen, für die es einen festen Ablauf gibt: »Das Christentum verfügt über ein hoffnungsvolles und wahres Vokabular für Tod und Auferstehung. Das Judentum jedoch bietet die Grammatik für die Zeit zwischen beidem, für das Trauern nach dem Tod und vor Ostern.«12
Da ist zum Beispiel die Schiwa nach der Beerdigung. Sieben Tage lang sitzt man schweigend zusammen (wie Hiob und seine Freunde). Essen wird gekocht und vorbeigebracht. Darauf folgen die dreißig Tage nach dem Sterbetag (Schloschim). Auch hier ist genau festgelegt, wie der Trauernde sich in der Gemeinschaft verhält. Am ersten Schabbat nimmt er nicht am ganzen Gottesdienst teil. Am zweiten Sabbat ist er dabei, aber er sitzt nicht an seinem gewohnten Platz. Und im gesamten Trauerjahr ist man dazu aufgefordert, täglich das Kaddisch zu sprechen. Für dieses Gebet müssen mindestens zehn Erwachsene anwesend sein. Winner schreibt dazu: »Ein Trauernder, der sich ganz für sich alleine ausweinen will, hat bei uns keine Chance!«13
Man trauert in der Gemeinschaft. Es ist, als würde man sich mit den anderen im gemeinsamen Gebet die Hände reiben. Erstaunlicherweise besteht das Kaddisch aus vier Zeilen Lobpreis. Es gibt natürlich auch viele Klagepsalmen, die dem Schmerz und der Verzweiflung Worte geben. Gott sei Dank dafür! Das Kaddisch aber drückt einfach aus, was geglaubt wird. Vielleicht kommt das Herz noch nicht hinterher. Aber ihm wird sanft die Richtung gezeigt.
Der erste Todestag ist dann nochmals ein besonderer Tag des Gedenkens. Jeder gestaltet ihn anders. Sich erinnern, Klagepsalmen rezitieren, dankbar feiern – alles ist möglich, schreibt Winner. Und jedes weitere Jahr danach wird der Todestag – genannt »Jahrtag« – gefeiert (denn das Vermissen hört ja auch nach einem Jahr nicht auf!).
Ich mag diese Tradition, die Raum gibt für Zeiten, in denen unsere Seele schwer hinterherkommt. Die Ja sagt zu Tränen, zu stockenden Gebeten, zu langsamen Schritten, zu Zweifeln und Fragen und der Suche nach dem eigenen Platz. Der Gott der Ewigkeit schenkt uns Zeit. Zeit für diejenigen, die »immer noch nicht drüber weg sind« und für jeden, der das Glaubensbekenntnis heute nicht durchgehend mitsprechen kann. Gott wartet nicht schon in der nächsten Jahreszeit auf uns und wundert sich, wo wir so lange abgeblieben sind. Ich glaube, er setzt sich zu uns, mitten in den kargen Garten unserer Seele, und flüstert uns zu: »Ich bin hier. Nimm dir Zeit. Es ist gut.«
Es braucht Zeit, wenn wir um geliebte Menschen trauern, wenn wir Schmerzhaftes erlebt haben, wenn wir Herzenswünsche loslassen müssen und gute Zeiten an ihr Ende gekommen sind.
Meine Mutter hat – zusammen mit vielen anderen aus ihrer Generation – diese Zeit nie bekommen. Bei allem Schweren, das sie erlebt hat, musste es immer auch gleich weitergehen. Und so hat sie es dann auch an meine Schwester und mich weitergegeben. »Jetzt sind wir aber wieder fröhlich!«, hörte ich sie oft sagen. Meistens viel zu früh. Wenn gerade die ersten Tränen flossen und wir dabei waren, dem Schmerz mutig ins Auge zu schauen. Ich weiß, sie hat es gut gemeint. Und sie konnte uns nicht geben, was sie selbst nie erleben durfte: dass wir die dunklen Tage nicht einfach wegstecken müssen, um weiter zu funktionieren. Dass Zeiten ihren Raum einnehmen dürfen, in denen einem die Kälte in die Knochen kriecht und bei Licht betrachtet alles so karg und leer ausschaut. Jeder Gärtner weiß: Niemals geschieht nichts. Der Februar ist eine wichtige Zeit von verborgenem Wachstum. Floyd McClung sagte einmal in einer Predigt: »If we learn to grieve well, we can grow well.« Was für eine wichtige Erinnerung: Wer dem Trauern in guter Weise Raum gibt, schafft Platz für inneres Wachstum.
Also will ich mich, ganz jüdisch, auf die Disziplin des Trauerns einlassen. Ich will in der Gemeinschaft mit mindestens zehn Erwachsenen meinen Lobpreis singen. Woche für Woche. Gloria dem Gott, der in die tiefen Schichten aus toter, verfallener Erde Samen legt und neues Leben aufbrechen lässt. An der Seite des Auferstandenen enden unsere Geschichten nicht im Februar! Zu diesem Glauben will ich durchdringen wie durch die letzten trüben Tage vor dem Frühling.
Ein Traum
In diesen Februartagen weiß ich noch nicht, dass ich in der Nacht zum »Jahrtag« einen Traum haben werde: Ich laufe an einem großen Hafengelände entlang und plötzlich ist meine Mutter neben mir. Ich freue mich überrascht. Wir reden über ein paar Belanglosigkeiten, was mir wie mein verzweifelter Versuch erscheint, sie zu halten. Währenddessen kommen große Schiffe und Fähren in den Hafen. Meine Mutter sieht immer wieder in einer freudigen Erwartung auf die Uhr. Eigentlich will ich mit ihr noch eine Tasse heiße Schokolade trinken – die hat sie immer so geliebt –, aber sie sagt: »Du, ich muss jetzt los!« Und dann ist sie weg. Und ihre kribbelige Vorfreude, der lebendig-strahlende Ausdruck in ihrem jungen (!) Gesicht wird mich wie getröstet aufwachen lassen. Ja, so wird der »Jahrtag« beginnen. Und nachdem ich das Kaddisch gesungen habe, werde ich mit Heio und Samuel Gyros essen gehen, mit Mamas letztem gesparten Geld. Wir werden mit Johannisbeerschorle auf sie anstoßen, das Autoquartett auf dem Tisch. Mitten im Leben werden wir das Leben feiern. Und abends werden wir die alten Fotos anschauen und uns an sie erinnern, dankbar und mit Tränen in den Augen. Es wird ein Tag sein wie das Winken und Rufen hinauf zur Reling, wenn man den geliebten Menschen davonfahren sieht. Flatterndes Taschentuch im Wind. Es ist an der Zeit loszulassen.
Mach’s gut Mama.
Bis wir uns wiedersehen!