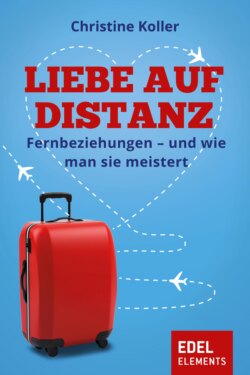Читать книгу Liebe auf Distanz - Christine Koller - Страница 7
1. Kapitel: Beziehungstrend „Getrennt zusammenleben“ Begriffsspielereien rund um die Fernbeziehung
ОглавлениеWie schwammig das Wort Fernbeziehung ist, konnte Dirk Schröder feststellen, als er vor wenigen Jahren zu einer gleichnamigen Ausstellung aufrief. Mit Gedichten, Videoinstallationen, Bühnenbildern, Fotos und Erzählungen gaben junge Künstler auf dessen Online-Plattform www.textgalerie.de ihre Interpretationen zum Besten. „Allerdings gingen nur 50 Prozent auf ihre persönliche Beziehung ein. Die anderen thematisierten unter dem Begriff sprachliche Barrieren, räumliche Distanz, ihre Entfremdung gegenüber ihrer Umwelt oder die Entfernung zu Gott“, blickt Schröder zurück.
Versucht man das Wort auf die Beziehung zwischen zwei Menschen einzugrenzen, die zwar zusammen, aber dennoch getrennt sind, war wohl der Begriff Living apart together (LAT), der erste, der dem neuen Paar-Individualismus einen Namen gab. Der Filmemacher Pim de la Parra prägte ihn, als er zusammen mit Charles Gormey das Drehbuch zu dem 1973 erschienenen niederländischen Kinofilm „Frank & Eva – Living Apart Together“ schrieb. Die niederländische Wissenschaftlerin Cees J. Starver führte das Wortspiel dann in den 80er Jahren in die wissenschaftliche Diskussion ein. 1989 machte der Familiensoziologe Rüdiger Peuckert im Anschluss an amerikanische Forschungen den Begriff Commuter-Ehe (Commuter aus dem Englischen übersetzt: Pendeln) in Deutschland bekannt. Peuckert verstand darunter eine „Ehe- bzw. Familienform, bei der die Ehepartner in zwei räumlich getrennten Haushalten leben und beabsichtigen, die Ehebeziehungen aufrechtzuerhalten“. Die Trennung erfolgt, da beide Partner stark karriereorientiert sind – ähnlich Dual-Career-Couples (Doppel-Karriere-Paare) – und nicht am gleichen Ort einen ihrer Ausbildung angemessenen Job finden können. Breiter legte die Journalistin Dorothea Schmitz-Köster 1990 den Begriff an, als sie in ihrem gleichnamigen, mittlerweile vergriffenen Buch erstmals von „Liebe auf Distanz“ sprach. Darunter fielen alle verheirateten und nicht verheirateten Paare, „die in einer festen Partnerschaft leben, aber aus unterschiedlichen Gründen keinen gemeinsamen Alltag haben. Soziologisch ausgedrückt: keine alltägliche Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft praktizieren“. Diese Wortneuschöpfung ist damit ein breiter Trichter für eine Vielzahl von neudeutschen Begriffsspielereien in Sachen Fernliebe: Long-Distance-Beziehung, Pendel-Liebe, Spagatfamilie, Teilzeit-Ehe, Wochenendbeziehung etc.
Was genau eine Fernbeziehung kennzeichnet, damit hat sich der Soziologe Norbert Schneider auseinander gesetzt. Als Professor an der Universität Mainz und Leiter der Studie „Berufsmobilität und Lebensform“, bei der 1000 mobile Berufstätige und deren Partner (zwischen 20 und 59 Jahren) befragt wurden, unterscheidet er unter diesem Oberbegriff zwei, genau genommen drei Varianten der Fernbeziehung:
Erstens die so genannte LAT-Beziehung, die beide Partner freiwillig wählen, weil sie in Sachen Autonomie, Distanz und Selbstständigkeit ihrer Idealvorstellung von Partnerschaft entspricht. Im extremsten Fall lebt das Paar in zwei Haushalten in unmittelbarer Nachbarschaft, etwa im selben Haus, aber in unterschiedlichen Apartments – ähnlich dem Intellektuellen-Paar Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Dieses Modell leben 29 Prozent aller Fernliebenden.
Weitere 58 Prozent führen eine weitere Form der Fernbeziehung, die so genannte Long-Distance-Beziehung. Sie entsteht in der Regel unfreiwillig aus beruflichen Umständen heraus und kann Liebende zum Teil auf unterschiedliche Kontinente verschlagen. Wie weit die Entfernung zwischen den einzelnen Partnern ausfallen kann und wie oft sie sich sehen müssen, darüber sagt das „fern“ – nach Definition von Schneider – nichts aus. Es bezieht sich lediglich auf die Tatsache, dass beide zwei voneinander getrennte Haushalte führen.
Und schließlich gibt es noch mit 13 Prozent die Fernliebenden, die eine Long-Distance-Beziehung zu Liebespendlern gemacht hat, die sich aber im Laufe der Zeit mit der Tatsache angefreundet haben und so auch weiterhin leben wollen.
Neben diesen drei Typen von Fernbeziehungen bestimmt Schneider in seiner Studie vier weitere Mobilitätsformen im partnerschaftlichen Miteinander:
Die Fernpendler: Sie nehmen lange Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf, um den gemeinsamen Wohnort des Paares oder der Familie aufrechtzuerhalten. Das Pendeln erfolgt in der Regel täglich mit mindestens einer Stunde Fahrzeit für die einfache Wegstrecke.
Die Wochenendpendler oder so genannten Shuttles: Bei ihnen gründet einer der beiden Partner einen Zweithaushalt am Arbeitsort. An den Wochenenden oder in anderen zeitlichen Rhythmen teilen sie sich den gemeinsamen „Haupthaushalt“.
Die Variomobilen: Bei dieser Paarform ist mindestens einer der beiden Partner an wechselnden Orten beruflich tätig und in dieser Zeit in Hotels, Gemeinschaftsunterkünften etc. untergebracht. Davon betroffen sind bestimmte Berufsgruppen wie Piloten, Stewardessen, Schauspieler, Vertriebsleute oder Manager.
Die Umzugsmobilen: Das sind Paare bzw. Familien, die sich aufgrund beruflicher Mobilitätserfordernisse in den letzten fünf Jahren zu einer Verlagerung ihres gemeinsamen Haushalts entschieden und einen Fernumzug hinter sich haben.
Unter dem Strich könnte man also sagen: Fernbeziehungen führen Paare, die, in regelmäßigen Abständen räumlich getrennt, im Geiste vereint leben und lieben und zwei voneinander getrennte Haushalte besitzen. Am Rande zählen dazu wohl auch die Variomobilen, die in Hotels, Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnwägen für eine gewisse Zeit einen provisorischen „Zweit-Haushalt“ aufschlagen. Denn wenngleich ihre Motive etwas anders gelagert sind als bei klassischen Fernbeziehungen, gilt es, ähnliche Probleme zu meistern. Vor allem je länger und je regelmäßiger ihre Aufenthalte fern von zu Hause sind.