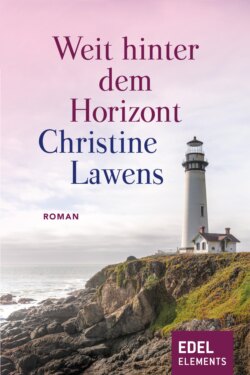Читать книгу Weit hinter dem Horizont - Christine Lawens - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 4
Was, grübelte sie niedergeschlagen, tue ich hier eigentlich?
Sie lag auf dem Bett und dachte an den Brief in ihrer Handtasche.
Maman war dreiunddreißig Jahre alt gewesen, als sie angeblich bei einer Explosion am Leuchtturm mit ihrem Vater und Gérard Renaud umgekommen war. Florence vernahm bis heute noch die Detonation und das Vibrieren der Erde.
Oft fuhr sie nachts aus dem Schlaf, hörte den ohrenbetäubenden Knall und sah die lodernden Feuerzungen auf dem Atlantik.
An diesem späten Abend hatte solch ein Chaos geherrscht. Es schien, als sei der ganze Ort auf den Beinen. Der untere Teil des Leuchtturms stand noch, der obere Teil fehlte.
Niemand konnte sich vorstellen, was die Explosion ausgelöst hatte.
Man fand die Leichen einige Tage später am Strand. Das erzählte man sich. Und bei der Beerdigung standen drei Särge in der Kirche. Sie und Serge standen eng beieinander. Und doch jeder für sich, einsam und allein. Lobeshymnen und Beileidsbekundungen wurden Hunderte von Malen wiederholt. Was jeder der drei doch für ein liebenswerter Mensch gewesen sei.
Vielleicht sollte Florence es einfach glauben, weil es so häufig wiederholt worden war. Aber wenn Wortfülle ein Mittel gegen den Schmerz sein sollte, so hatte die Überdosis nicht gewirkt. Trotz ihrer vierzehn Jahre hatte Florence es besser gewusst.
Es war Großmutter, die ihr sagte, dass Gott für den Tod ihrer Eltern nicht verantwortlich sei, dafür, dass schreckliche Dinge auf dieser Welt passierten. Alle diese wohlmeinenden Menschen, die behauptet hatten, ihre Eltern und Serges Vater seien liebenswerte Menschen gewesen, hatten nur eine einfache Antwort auf eine sehr schwierige Frage gesucht.
Nach dem Tod ihrer Eltern war Florence hiergeblieben, um bei ihrer Großmutter zu leben.
In den ersten Jahren ihres Heranwachsens hatte Florence noch an den Rockschößen ihrer Großmutter gehangen. Großmutter wusste, was es bedeutete, Gott gegenüber aufrichtig zu sein. Dem Allmächtigen gegenüber nahm sie nie ein Blatt vor den Mund. Sie war der Überzeugung, Gott sei groß genug und könne mit ihren Fragen, ihrem Zorn und ihrem Schmerz fertigwerden.
Das war eine wichtige Lektion, aber eine Lektion, die für Florence zunehmend schwieriger zu lernen war, vor allem aus zweiter Hand. Als sie der Kindheit entwuchs, und damit dem Heiligtum und dem Schutz ihres überlieferten Glaubens, und sich an ihre eigenen geistigen Überzeugungen heranzutasten begann, lernte sie, ihre beharrlichen Fragen zu unterdrücken. Sie boten oberflächliche Antworten statt tief gehender Gespräche.
Sehr schnell verstand Florence die Botschaft: Gute Christen behielten ihre Zweifel für sich. Sie begruben ihren Schmerz, um Gott damit nicht in Verlegenheit zu bringen. Sie fanden Entschuldigungen für nicht erhörte Gebete. Gute Christen stellten keine Fragen, wie zum Beispiel die, ob man sich auf Gott verlassen könne oder warum Leid passierte, wenn er die Menschen doch liebte.
Glauben hieß, das Boot nicht zum Wanken zu bringen. Mit der Frage nach dem Warum sprach man Gott gleichzeitig auch sein Misstrauen aus.
Und so hielt Florence den Mund. Zumindest in der Öffentlichkeit. Nie mehr wollte sie das junge Mädchen sein, das sie damals gewesen war – das Tod und Schmerz erlebt hatte und keine Erklärung für das Warum finden konnte. Florence begann langsam, ihre Kindheit fein säuberlich wegzupacken. Sie spürte bereits in frühen Jahren, dass da draußen in der Welt irgendetwas auf sie wartete, etwas, das sie finden oder verlieren musste. Trotzdem machte sie alles mit, besuchte jeden Sonntag den Gottesdienst und gab sich den Anschein der Frömmigkeit, doch nur selten fand sie unter den guten Christen, die neben ihr auf der Kirchenbank saßen, einen Geist wie den ihrer Großmutter.
Bis der Brief aus dem Kloster eintraf.
Jemand klopfte an Florence’ Tür. Nur mühsam wurde sie wach, jede Bewegung war schmerzlich langsam. Ihr rechter Arm war eingeschlafen. Vorsichtig bewegte sie ihn. Es kribbelte wie unzählige Nadelstiche in ihrer Handfläche. Das Licht im Zimmer hatte sich verändert. Es war nicht mehr so hell. Wie viel Uhr war es jetzt? Wie lange hatte sie geschlafen? Florence fuhr sich mit der Hand über die Wange, um ihr Haar zurückzustreichen; auf ihrem Gesicht hatte sich das Muster der Chenillebettdecke eingedrückt.
Das hartnäckige Klopfen hörte nicht auf. Sie schüttelte den Kopf, um ihre Gedanken zu ordnen, rollte sich vom Bett herunter und taumelte zur Tür.
Rochers finsterer Blick begrüßte sie, als sie die Tür öffnete. »Das Abendessen wird kalt«, fuhr die Frau sie an. »Unten im Salon.«
Florence zog ihre Schuhe an und folgte der Krankenschwester den Flur entlang und die hintere Treppe hinunter. Noch immer im Halbschlaf, stolperte Florence und wäre beinahe hingefallen. Rocher beachtete sie nicht, sondern stapfte unbeirrt weiter und verschwand um eine Ecke.
Im Salon war das Essen bereits angerichtet, und Florence nahm Platz.
»Ihre Großmutter hat schon vor einer Stunde zu Abend gegessen«, murmelte Rocher und kam damit der Frage zuvor, die Florence auf den Lippen hatte. »Noch einen Wunsch?«
»Nein. Danke, Madame Rocher. Sie sind doch nicht die Haushälterin, sondern nur die Krankenschwester.«
Wortlos ergriff Rocher die Fleischplatte und begann, ein Stück vom Rinderbraten in Salzkruste auf Florence’ Teller zu balancieren. Doch bevor sie ihn abstellte, richtete sich ihr Blick auf Florence.
Florence sah auf das Stück Fleisch und musste ein Lachen unterdrücken, weil eine Erinnerung in ihr aufstieg. Sie, Serge und sein Bruder Pierre wollten deren Eltern mit einem Essen zu ihrem Hochzeitstag überraschen. Die kleine Schwester Angélique tänzelte in der Küche umher und redete ununterbrochen. Serge und Pierre würzten den Rinderbraten und legten ihn auf das Backblech. Sie forderten Angélique auf, in den Keller zu gehen und viel Salz zu holen, während Florence sich um die Kartoffeln und das Gemüse kümmerte. Die beiden Brüder gaben sich viel Mühe, das Fleisch schön mit Salz zu ummanteln. Nach einer halben Stunde im Backofen war der Braten bereits verbrannt. Und es roch noch dazu sehr merkwürdig. Alle schauten sich fragend an, und Florence griff nach der Tüte, die Angélique aus dem Keller gebracht hatte. Es war Streusalz anstatt Meersalz.
»Stimmt was nicht?« Lucienne Rocher riss Florence aus ihren Gedanken.
»Was? Doch, doch, es ist alles in Ordnung. Ich habe mich nur an etwas erinnert.«
»Im ganzen Leben werde ich euch junge Leute nicht verstehen«, sagte sie, während sich ihre Augen in Florence’ bohrten. »Warum sind Sie hier?«
»Was für eine Frage ist denn das?«, platzte Florence heraus. Sie stützte ihre Ellenbogen auf den Tisch, zog die Serviette mit der rechten durch die linke Hand und schnappte nach Luft. Sie spürte, wie erschöpft sie war. »Ich bin hier, weil ich meine Großmutter liebe.«
Rocher stellte den Teller ab, aber ihr Blick hing nach wie vor an Florence’ Gesicht. »Tatsächlich.«
»Ja, tatsächlich.«
Rocher schwieg, starrte Florence aber weiter an, bis diese stammelte: »Und ich muss mir über ein paar Dinge klar werden. Persönliche Dinge. Ich brauche Zeit für mich.«
»Das ist wenigstens ein wenig ehrlicher.« Triumphierend nahm sie die Schüssel mit den Kartoffeln und reichte sie Florence.
»Ich wusste nicht, dass sie krank ist.«
»Krank oder nicht, sie hätte ihre Familie gebraucht. Und wird sie auch in Zukunft brauchen.«
Florence unterdrückte die aufsteigenden Schuldgefühle. »Ich weiß. Im August habe ich mit Großmutter am Telefon gesprochen. Sie sagte, sie hätte eine leichte Erkältung.«
Schwester Rocher zog eine Augenbraue in die Höhe. »Phh.«
»Das stimmt. Ich liebe sie, und ich würde alles für sie tun.«
»Alles?«
Florence nickte. »Alles.« Sie beugte sich vor. »Was kann ich tun, Madame Rocher, um meiner Großmutter zu helfen?«
Ein seltsamer Ausdruck trat auf das Gesicht der älteren Frau, als würde sie einen Geist aus einer lange tot geglaubten Erinnerung sehen. Dann entspannte sich ihre Miene wieder.
»Hören Sie zu«, sagte sie. » Und was meine Arbeit hier im Hause betrifft: Ich bin Mädchen für alles.«
Lucienne Rocher hatte sich schon abgewandt, ging mit strammen Schritten in Richtung Küche, als sie sich plötzlich umdrehte und zurück zu Florence ging. »Ihrer Großmutter geht es gut. Es wird nur ein wenig Zeit brauchen, bis sie wieder bei Kräften ist.« Sie berührte Florence vorsichtig am Arm.
Florence hob den Kopf und starrte die Pflegerin an, als befände sie sich in Trance. Sie nickte – und dann kamen die Tränen. Plötzlich umklammerte sie wie eine Ertrinkende den Arm von Schwester Rocher. »Ich mache mir solche Vorwürfe«, brachte sie mühsam hervor, »ich habe doch nur noch sie …«
»Sie ist in Ordnung.« Lucienne Rocher tätschelte ihre Hand. »Sie braucht viel Ruhe. Wollen Sie mit mir nach draußen gehen und eine Zigarette rauchen?«
»Ja.«
Sie gingen auf die Veranda, stiegen die Stufen hinunter in den Park und setzten sich auf eine Bank. Wortlos klopfte die Pflegerin zwei Zigaretten aus ihrer Schachtel.
»Wird meine Großmutter das Bett wieder verlassen können?« Ihre Stimme war nicht mehr als ein heiseres Krächzen in dem herbstlichen Garten.
»Aber ja doch.« Die Schwester sprach plötzlich ganz sanft, kein Anzeichen mehr von Feindseligkeit. Ihre glühende Zigarettenspitze drehte sich in ihre Richtung.
»Ich wusste nie, was Angst ist«, flüsterte Florence, blickte an ihr vorbei und in die Blätter über ihnen. »Ich dachte, Angst hätten nur andere. Ich habe nie verstanden, wie Menschen mit Angst leben können. Menschen, die sich vor der Dunkelheit fürchten, vor der Nacht, vor der Zukunft.« Florence sah, dass sich die Blätter leicht im Wind bewegten. »Aber jetzt schließt sie mich in einen Kokon ein, aus dem ich nicht entfliehen kann.« Sie zog an ihrer Zigarette und sah dem Rauch nach, der sich in Richtung Baumwipfel verzog.
»Das kann ich gut verstehen. Aber es ist auch eine ganz normale Reaktion. Glauben Sie mir, Mademoiselle …«
»Florence!«, unterbrach sie die Schwester. »Nennen Sie mich Florence.«
Die Pflegerin nickte, hielt ihr die Hand hin und lächelte zum ersten Mal. »Lucienne!«
Als Florence ihre Hand ergriff und in das freundliche Gesicht sah, ließ sie ihren Gefühlen erneut freien Lauf. Jetzt brach alles aus ihr heraus, all die Angst und das Entsetzen, die Sorge und die Schuldgefühle, die Verwirrung und der Kummer. Sie weinte einige Minuten lang, während Lucienne sie in den Armen hielt.