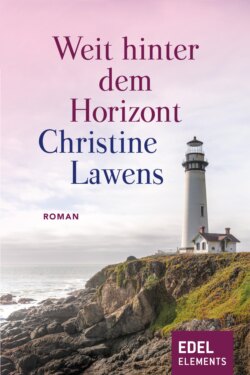Читать книгу Weit hinter dem Horizont - Christine Lawens - Страница 11
ОглавлениеKapitel 5
Das Gesicht ihrer Mutter. Eine im Regen stehende Gestalt mit Kapuze. Ein Schatten am Fenster. Das Signalfeuer des Leuchtturms, das in der Ferne aufblitzte, ein herzzerreißender Schrei.
Sie saß aufrecht im Bett, fuhr sich mit den Händen durch die Haare und stieß einen tiefen Seufzer aus. Die Bilder des Traumes verfolgten sie. Von irgendwo tief aus ihrer Erinnerung tauchte ein keltisches Märchen auf: Einst lebte die wunderschöne Etain zusammen mit den anderen Unsterblichen – mit Angus, dem ewig jungen Weltenwanderer, Fuamnach, der dunklen Zauberin, und Midir, dem Weltenbauer – in der lichten Anderswelt Tir-na-nog …
Großmutter hatte ihr dieses Märchen vor fast zwanzig Jahren erzählt, als Florence nach dem Tod ihrer Eltern allein mit ihr im Schloss wohnte. In jener Zeit hatte alles ihr Angst gemacht – die knackenden Geräusche in dem großen alten Gemäuer, der Wind in den Blättern, das Klappern der Fensterläden. Und natürlich der Traum – vor allem der Traum.
Gemeinsam hatten sie dann über die Geschichte gesprochen, immer und immer wieder, bis sie bei den Wörtern »Geister« und »Gespenster« beide in Lachen ausbrachen. Dann hatte Großmutter ihr über das Haar gestrichen und ihr leise etwas vorgesungen, bis sie eingeschlafen war.
Die Erinnerung an diese beruhigende Berührung war für Florence immer noch lebendig. Auch hatte sie diesen Wänden ihre Geheimnisse, Träume und Wünsche anvertraut. Sie, Florence, gehörte hierher. Warum nur beschlich sie dieses Gefühl, eine Fremde in ihrem eigenen Heim zu sein?
Mit weit aufgerissenen Augen legte sie sich wieder hin und beobachtete das Spiel von Licht und Schatten an der Decke. Eine kühle Brise wehte durch das geöffnete Fenster, und in der Ferne hörte sie das Schnauben eines Pferdes und das leise Klingeln eines Telefons.
Florence fuhr im Bett hoch. Das Telefon! Sie hatte versprochen, Patrick sofort nach ihrer Ankunft anzurufen. Sie schnappte sich den Wecker auf ihrem Nachttisch und starrte die Leuchtanzeige an. Viertel vor drei. Sollte sie ihn jetzt stören oder bis zum Morgen warten?
Sie stand auf und suchte in ihrer Handtasche nach ihrem Handy. Sie musste feststellen, dass der Akku leer war. In dem riesigen Haus hatte Großmutter nur zwei Telefone – eines unten in der Eingangshalle und das andere in ihrem Schlafzimmer. Als Florence auf die Universität gegangen war, hatte sie darauf bestanden, dass Großmutter sich einen Anschluss in ihrem Schlafzimmer installieren ließ. Sie zog ihren Morgenrock an und schlich die Treppe hinunter.
Patrick nahm beim zweiten Läuten ab.
»Ich bin so froh, dass du anrufst«, sagte er. »Ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Es tut mir leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe. Ich … ich habe es vergessen.«
Es folgte eine lange Pause. »In letzter Zeit vergisst du ziemlich viel«, bemerkte er. »Du wirkst … ich weiß nicht, ein wenig distanziert. Als würde dich etwas beschäftigen, über das du nicht reden kannst.« Seine Stimme wurde rau. »Ich kenne dich, Florence. Ich weiß, wenn etwas nicht stimmt.«
Innerlich protestierte Florence. Wie konnte er sie kennen, wenn sie sich nicht einmal selbst kannte? Er kannte das Bild, die Person, die sie geschaffen hatte, und das, was er sehen wollte. Und diese Person liebte er: die geheimnisvolle Frau. Wenn sie ihn näher an sich heranließ, ihn hinter das Geheimnis blicken ließ …
Sie schob den Gedanken beiseite. »Mit mir ist alles okay.«
Ein langes Schweigen folgte. Schließlich sagte er: »Also gut.« Sie hörte ihn seufzen. »Wie geht es deiner Großmutter?«
»Sie hat eine Lungenentzündung. Schon seit drei Wochen.«
»Das tut mir leid.« Seine Stimme war sanft und mitfühlend. »Richte ihr liebe Grüße aus, okay?«
»Das werde ich.«
»Du fehlst mir.« Sie konnte ihn beinahe vor sich sehen, wie er vorgebeugt am Telefon saß, mit eindringlichem Blick, ganz auf sie konzentriert. »Bist du sicher, dass du mir nichts erzählen möchtest?«
Florence zögerte. Dann sagte sie: »Nein, Patrick. Mir geht es gut. Wirklich. Ich muss nur über ein paar Dinge nachdenken, eine Bestandsaufnahme machen. Vielleicht habe ich hier bei Großmutter die Gelegenheit dazu.«
»Also gut. Ich rufe dich morgen an. Ich liebe dich.«
Für immer?, dachte sie. Eher unwahrscheinlich. Sie schloss die Augen und schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter. »Ich liebe dich auch. Gute Nacht.«
Florence legte auf und schlich die Stufen wieder hoch. Sie sah den dunklen Flur entlang, straffte die Schultern, öffnete jede Tür und sah in jedes Zimmer. Neben dem Schlafzimmer ihrer Großmutter befand sich das Badezimmer. Dann zwei Zimmer, die ihre Eltern bewohnt hatten. Das erste war deren Schlafzimmer, und Florence ging hinüber in den angrenzenden dazugehörigen Salon. Dies war ein reizvoller Raum, groß, luftig, mit hoher Stuckdecke und mehreren Fenstern mit Blick auf den zwei Hektar großen Park. Er war wie das Schlafzimmer in sanften Tönen gehalten – apricot, cremefarben und ab und zu ein Tupfer Rosa und Gelb – und atmete jene verblichene Eleganz, die von würdigem, altem Adel zeugte. Unter den wertvollen Möbelstücken stach ein Louis-XV-Sekretär ins Auge, ein Unikat mit Messingbeschlägen. Dieser Schreibtisch, der zwischen zwei Fenstern an der Stirnseite des Zimmers stand, gefiel Florence ganz besonders. Er hatte ihrer Mutter gehört. Die bequeme Sitzgruppe sowie die zwanglos verteilten Beistelltische, auf denen früher frische Blumengebinde zu stehen pflegten, vervollständigten die Einrichtung. Florence wischte mit dem Handrücken eine Träne fort, die über ihre Wange lief. Dann straffte sie die Schultern und verließ den Raum.
Auf der anderen Seite des Flurs, hinter dem Zimmer ihrer Großmutter, betrat Florence ihr Schlafzimmer, in dem sie gewohnt hatte, bis sie nach Paris gegangen war – ein geräumiges Zimmer mit drei Fensterfronten. Der Nordostturm. Vom linken Fenster aus konnte man ein Stück vom Atlantik sehen und früher auch den Leuchtturm. Jetzt hatte man freie Sicht. Als Kind hatte Florence Angst vor diesem Zimmer gehabt, weil das Mondlicht, das von allen Seiten ins Zimmer fiel, unheimliche Schatten warf. Später, als Teenager, hatte sie es richtig in Besitz genommen. Sich jetzt in dieses Zimmer zurückziehen zu können war tröstlich für sie.
Die wenigen Kleidungsstücke, die sie mitgebracht hatte, verloren sich in dem riesigen Eichenschrank. Florence legte sich auf das Bett. Ihr war gar nicht klar gewesen, wie müde sie war. Ihr Rücken schmerzte vor aufgestauter Anspannung. Sie zog sich die Decke über die Füße und versuchte zu schlafen.
Aber Großmutters ausgezehrtes und verwelktes Gesicht verfolgte sie. Sobald sie die Augen schloss, wurde Florence von einer Flut kurz aufblitzender Erinnerungsbilder überschwemmt. Der Nachthimmel in einem glutroten Feuerschein, helle Lichtfetzen, Adélaides trauernde Züge. Es schien Florence wie ein Aquarell, das an den Rändern verschwamm und in der Mitte verblichen war. Die Bilder verwirrten Florence für einen Moment. In was für einer Welt befand sie sich? Das Ausmaß ihrer Suche nach ihrer Identität überwältigte sie. Dazwischen drängte sich immer wieder das Bild von Patrick.
Ihr Kopf schmerzte, und jeder Nerv in ihrem Körper war angespannt. Sie knipste das Licht an und setzte sich im Bett auf.
Ja, Patrick liebte sie. Aber er kannte sie nicht richtig. Er wusste nichts von ihren Albträumen, der Furcht, die Florence selbst nicht erklären konnte. Er hatte keine Ahnung von ihren Bedürfnissen und Schwächen, die unter der Oberfläche lauerten. Nach so vielen Jahren der Übung hatte sie gelernt, sie gut zu verstecken. Sie griff nach ihrer Zigarettenpackung und ihrem Kimono und verließ wieder ihr Zimmer. Schwach leuchtende schmiedeeiserne Wandlampen säumten die Diele im oberen Stockwerk und zeigten den Weg.
Sie musste nur nach rechts abbiegen, die Diele entlanggehen, links die Treppe hinuntergehen, dann war sie im Eingangsbereich. Geradeaus war die Eingangstür und links davon die Bibliothek, in der sie in Ruhe rauchen konnte.
Es war totenstill im Haus. Kein Sparren knarrte, keine Bohle quietschte. Während die Gänge und Zimmer oben mit vornehmen Wollteppichen ausgelegt waren, bestanden die Böden unten aus großen, abgelaufenen Steinplatten, die sich wie Eis unter ihren nackten Füßen anfühlten.
Weitere Leuchter entlang der Wand spendeten gedämpftes Licht, während sie leise die geschwungene Treppe hinunterlief und durch die lächerlich große Eingangshalle ging.
Vorbei an den Porträts ihrer Vorfahren, an dem bretonischen Tisch, der angeblich von der Herzogin Anne de Bretagne stammte, und dem Schwert an der Wand, das Urgroßvater Arnaud bei seiner letzten Schlacht im Krieg 1870 geschwungen hatte.
Als sie endlich in die mit Büchern gesäumte Bibliothek hineinschlüpfte, war sie außer Atem.
Sie schloss die Tür leise hinter sich, lehnte sich gegen sie, wartete, dass ihr Herzschlag sich beruhigte und ihr Atem wieder gleichmäßig ging. Im Raum war es mucksmäuschenstill, und eine sanfte Beleuchtung schien. Gott sei Dank war niemand da. Sie hatte halb damit gerechnet, dass sie – irgendwo – der Pflegerin in die Arme laufen würde. Sie wollte keine Erklärungen abgeben. Nur ihre Ruhe.
Es roch nach modrigem Papier, Leder, Feuer, das in dem verrußten offenen Kamin gebrannt hatte. Früher hatten die frischen Blumen, die auf dem Kaminsims und auf den im Raum verteilten Tischen platziert gewesen waren, ihren betörenden Geruch freigegeben.
Eingebaute Bücherregale aus Mahagoni, reich verziert und handgeschnitzt, säumten drei der Wände. Der riesige offene Kamin aus Granit nahm die vierte Wand ein.
In den Regalen müssen mehrere Hundert Bücher stehen, dachte sie, während sie die ledergebundenen Exemplare mit ihren ausgeblichenen goldenen Titeln betrachtete, die sie bereits als Kind bewundert hatte, und sich fragte, ob sie es schaffen würde, sie alle mal zu lesen.
Von allen Räumen des Schlosses mochte Florence diesen am liebsten. Die dunkelbraunen Lederstühle und Sofas sahen alt und bequem aus. Das gesamte Mobiliar war antik, hinterließ aber nicht den Eindruck, als hätte man es auf Hochglanz poliert, und es war auch nicht mit einem »Bitte nicht anfassen«-Schild versehen worden. Es hatte genau die Patina, die Möbel bekamen, wenn sie genutzt wurden, so als ob Menschen ihre Füße auf den Couchtisch gelegt hätten, um das eine oder andere ausgedehnte Nickerchen in den tiefen Kissen der Sofas zu machen, die seitlich neben dem offenen Kamin standen.
Neugierig sah sich Florence die Titel der vielen Bücher an, der größte Teil war in französischer Sprache, Märchen und Sagen überwiegend in Bretonisch. In einem anderen Schrank standen ledergebundene Ausgaben großer französischer Schriftsteller: Zola, Victor Hugo …
Nachdenklich strich Florence mit der Hand an den Büchern entlang, bis ihr ein zerschlissener Band in die Augen stach: Le Misanthrope von Molière.
Sie zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief. Sie fühlte sich plötzlich so entspannt wie seit Tagen nicht mehr. Sie wollte lesen, das Buch durchblättern, die Stellen finden, die sie in der Schule besonders geliebt hatte. Dabei zündete sie die zweite Zigarette an, die sie im nächsten Moment wieder im Aschenbecher ausdrückte.
Dort, zwischen den Seiten, lag zusammengefaltet ein Aufsatz von ihr. Florence nahm die zwei Blätter in die Hand und fing an zu lesen.
Der Menschenfeind von Molière – Aufsatz von Florence Letrec
Unter den Widersprüchlichkeiten der Liebe, die Molière behandelt, ist die Liebe einer Figur zu ihrem charakterlichen Gegenpol sehr häufig. Diese Konstellation birgt unendlich viel dramatisches Potenzial und wirft die Frage auf, ob eine solche Liebe unerfüllt bleiben muss. Die Liebe zum Gegenpol, zum Alter Ego ist die Ursache für Konflikte und Probleme und zwingt die handelnden Personen des Stückes unerbittlich, die Wahl zu treffen zwischen Liebe und Egoismus.
In der dritten Szene des vierten Aktes sagt Célimène zu Alceste: »Sie lieben nicht, wie man mich lieben sollte.«
Sie will ihm ihr Verständnis von Liebe aufzwingen, worauf er antwortet: »Ich wünschte, dass der Himmel Ihnen bei der Geburt nichts gegeben hätte, weder Rang noch Herkunft noch Wohlstand, und meine Freude wäre alleine Ihre Sonne und versöhnte Sie mit Ihrem traurigen Geschick.«
Was ist das für eine Liebe, die das Wesen des Geliebten ändern will? Es ist der absolute Gipfel des Egoismus.
Er will, dass sie sich durch ihn verwirklicht. Doch Célimène hat ihren eigenen Freundeskreis, ihr eigenes Vermögen und ihren freien Willen, ungewöhnlich für eine Frau in dieser Epoche. Seiner Zeit weit voraus, nimmt sich Molière eines äußerst brisanten Themas an: der Unabhängigkeit der Frau.
Beide Helden tragen ihre eigene Welt mit sich, und keiner ist bereit, auch nur einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Diese unvernünftige Leidenschaft, die Alceste zu bekämpfen versucht, ist oft zutiefst ergreifend. Wenn zum Beispiel Alceste, der Aufrichtige, Unversöhnliche, der radikale Feind der Lüge, Célimène bittet, ihn anzulügen.
Vierter Akt – dritte Szene
»Tun Sie, was Sie können, um unbescholten wenigstens zu scheinen, und ich will alles tun, um Ihnen blind zu trauen.«
Er hofft bis zuletzt, sie ändern zu können; vergeblich. Denn ein Mensch lässt sich nicht einfach ändern. Niemand hat das Recht, so etwas zu verlangen. Und wenn auch sehr umständlich und in der gezierten Sprache des 17. Jahrhunderts, ist Célimènes Botschaft an Alceste eindeutig. Was sie ihm sagen will, ist: Wenn du mich liebst, dann nimm mich, wie ich bin, denn ich werde mich nie ändern. Akzeptiere mich, wie ich bin, dann akzeptiere ich dich, wie du bist.
Denn wenn man über Liebe und Egoismus heutzutage spricht, dann nur, weil sich nichts, absolut nichts geändert hat und weil es immer noch so schwierig ist wie damals, Liebe mit Selbstverwirklichung zu vereinbaren. Alceste ist unnachgiebig, egoistisch und besitzergreifend. Célimène ist leichtlebig, unverantwortlich, untreu.
Doch wenn sie die Fehler des anderen akzeptieren, wenn sie darüber sogar lachen würden, hätte die Liebe den Egoismus besiegt. Aber solche Opfer kann man nur für eine wahre Liebe bringen. Und woran erkennt man wahre Liebe?
Wenn man auf einmal das Gefühl hat, dass der einzige Mensch, der einen trösten kann, der ist, der einem am meisten wehgetan hat. Dann ist man ein Liebespaar.
Ihre Augen schmerzten vor Müdigkeit. Mein Gott, dachte sie, da war ich elf Jahre alt und habe so altklug geklungen. Den konnte nur ihre Mutter in dieses Buch reingelegt haben. Sie drehte eines der Blätter um und entdeckte die Handschrift ihrer Mutter.
Für meine so kluge und talentierte Tochter. Ich möchte deinen wundervollen Aufsatz mit einem Zitat von Alfred de Musset kommentieren. Er hat nach einer Vorstellung gesagt: »Statt darüber zu lachen, hätte man weinen müssen.« Wie ich finde, zu Recht. Eine große Liebe scheitern zu sehen ist tragisch. Unsere beiden Helden enden in der Wüste ihrer Einsamkeit. Was könnte trostloser sein? Ich denke, das wollte Molière uns mit auf den Weg geben. Und jeder sollte sich einmal ganz ehrlich die Frage stellen: Geht mir das Glück des Menschen, den ich zu lieben behaupte, über mein eigenes Glück? Bin ich bereit, auf ihn einzugehen, seine Enttäuschung und seine Freude mit ihm zu teilen? Und gibt es auf der Welt etwas Schöneres als einen Bund zwischen zwei dieser unvollkommenen Geschöpfe?
Florence ließ das Blatt sinken. Ihre Augen brannten vor Erschöpfung. Irgendetwas in ihr sträubte sich gegen die Worte ihrer Mutter und löste ein Durcheinander an Gefühlen aus. Resigniert löschte sie das Licht. Morgen, morgen gab es vielleicht eine Antwort.