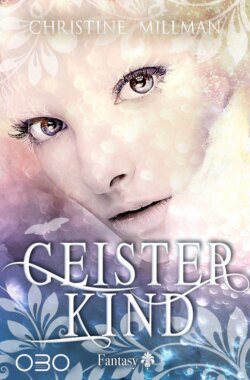Читать книгу Geisterkind - Christine Millman - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Krickdorf
ОглавлениеDu bist hell und leuchtend, wie der Mond, mein Winterkind. Wie so oft dachte Inja an die Worte ihrer Großmutter, während sie im Zwielicht der hereinbrechenden Nacht am Ufer des Murgflusses saß und ihre Zehen in das träge fließende Wasser stippte. Kleine Kreise kringelten sich über das Wasser, wo sie die Oberfläche berührte. Ein neugieriger Fisch schwamm herbei und stupste gegen ihren großen Zeh. Inja kicherte und zog die Füße zurück.
»Ban, sieh mal ein Buntfisch«, rief sie.
Ban, der auf einen Baum geklettert war, um Saftpflaumen zu pflücken, spähte zwischen den Ästen hindurch. »Boah, was für ein Brocken. Versuch ihn weiter anzulocken, ich geh und hole meine Angelrute.«
In Windeseile kletterte er den Baum hinab und rannte Richtung Dorf, welches nur eine kurze Wegstrecke entfernt lag. Lächelnd blickte Inja ihm nach. Ban war ihr bester und einziger Freund. Die Menschen im Dorf mieden sie seit ihrer Geburt, nannten sie Geisterkind, Mädchen mit dem bösen Blick und klopften sich gegen Lippen und Stirn, wenn sie ihr begegneten. Nur Ban hatte sich mit ihr angefreundet. Ban, der als Bastard eines unbekannten Vaters fast ebenso misstrauisch beäugt wurde wie sie.
Inja lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Fisch. Er war so schön anzusehen, mit seinen schillernden Schuppen, die wie Silberperlen glänzten. Buntfische waren ein überaus seltener Anblick, denn nur in der Abenddämmerung kamen sie aus den Tiefen hervor und verschwanden wieder, sobald es dunkel war. Obwohl Inja viel Zeit am Murgfluss verbrachte, hatte sie erst einmal in ihrem Leben einen Buntfisch zu Gesicht bekommen, und der hatte gewürzt und gebraten auf einem Teller gelegen, damals, während der Namensgebungsfeier ihrer Schwester. Sie kniete sich hin und beugte sich über die Uferböschung, bis ihre Haarspitzen das Wasser berührten, und besah sich ihr Antlitz, das sich verschwommen auf der Oberfläche spiegelte. Wasserblaue Augen und mondhelle Haut, das Haar von der Farbe der Winterrose und die Wimpern wie Fäden aus gesponnenem Licht. Eine schmale Nase und Lippen, klein und geschwungen wie die ihrer Mutter, doch nicht rot, sondern blassrosa, wie die Haut eines Neugeborenen. Der Anblick bekümmerte sie.
Du bist so weiß wie der Kalkfelsen nordöstlich der Mandaebene, hallte die vorwurfsvolle Stimme ihrer Mutter in ihrem Kopf. Warum bist du nur so bleich?
Ja, sie war blass, blasser als alle anderen. Und zart, fast schon fragil, wie eine Blüte im Wind. Aber sie war auch zäh. Trotzte sie etwa nicht den Anfeindungen der Menschen schon seit der Nacht ihrer Geburt vor vierzehn Wintern? Führte sie nicht den Haushalt und hütete ihre kleine Schwester, während die Eltern tagein tagaus in der Schankstube schufteten?
Der Kopf des Buntfisches durchstieß ihr Spiegelbild und zerteilte es in fließende Formen.
»Schwimm weg«, flüsterte Inja und stupste den Fisch an. Sein Leben sollte nicht in einem Kochtopf enden.
Schimmernde Blasen perlten an die Oberfläche, als sie ihn berührte und er mit einem leisen Platschen in den dunklen Tiefen des Murgflusses verschwand. Dabei zog er einen Schweif aus buntem Licht hinter sich her. Inja lächelte verzückt, streckte die Hände in das Wasser und berührte den Schimmer. Warm fühlte er sich an, wie die ersten Sonnenstrahlen an einem Frühlingstag. Sie schloss die Augen und summte leise, während sie sich vorstellte, wie es wäre, in der schillernden Wärme zu baden, einzutauchen in Kaskaden aus Wasser und Licht. Sie liebte das Wasser. Nur in der klaren, ruhigen Kälte fühlte sie sich zuhause. Kurzentschlossen zog sie ihre Tunika und den Rock aus und watete in das kühle Nass. Noch immer konnte sie die warmen Stellen spüren, die der schillernde Schweif hinterlassen hatte. Sie hielt den Atem an und tauchte unter. Stille umfing sie. Der feurige Glanz der Abendsonne brach sich auf der Wasseroberfläche und hüllte sie ein, wiegte sie wie die tröstenden Arme ihrer Großmutter. Sie schloss die Lider, ließ sich von der Strömung treiben und dachte an das geliebte Gesicht der alten Frau. Faltig, mit blauen Augen, die sie zärtlich betrachteten.
Mein Winterkind.
Die Erinnerung zauberte ein Lächeln auf Injas Gesicht. Jeder im Dorf hatte die alte Frau mit dem herrischen Blick gefürchtet, jeder außer Inja.
Ein Schatten über dem Wasser holte sie in die Wirklichkeit zurück. Sie tauchte auf, öffnete die Augen und blickte sich verwundert um. Unbemerkt war die Abendröte der Nacht gewichen. Der Weg ins Dorf war nirgendwo zu sehen. Wie lange war sie unter Wasser gewesen? Und wie weit hatte sie die Strömung des Flusses fortgetragen?
»Ban?«, rief sie. »Bist du wieder da?«
Niemand antwortete. Hatte er sich versteckt, um sie zu erschrecken? Das tat er oft. Manchmal, wenn sie im Morgengrauen das Haus verließ, um Wasser zu holen oder wenn sie auf der Bank neben dem Gemüsegarten saß und Erdknollen schälte, schlich Ban sich an sie heran und gab ein schauerliches Heulen von sich, so dass sie zusammenfuhr und ihr Herz wild zu schlagen begann. Dann klopfte er sich auf die Schenkel und lachte über ihr erschrockenes Gesicht, bis sie in sein Lachen mit einfiel und sie gemeinsam kicherten, bis sie völlig außer Atem waren. Doch das war im Dorf, hier am Murgfluss und noch dazu im Dunkeln, war ihr ganz und gar nicht danach, erschreckt zu werden.
Sie stieg aus dem Wasser und suchte nach dem Kreuzdornschössling, neben dem sie ihre Kleider abgelegt hatte. Sie fand ihn dreißig Schritte stromaufwärts. Schnell streifte sie ihr Kleid und die Tunika über das nasse Untergewand und spähte zwischen die Bäume. Im bleichen Licht des Mondes wirkten sie wie finstere Riesen, die ihre Klauen nach ihr ausstreckten, um sie zu ergreifen. Zu ihrer Rechten raschelte es.
»Das ist nicht lustig, Ban«, rief sie. Unwillkürlich dachte sie an Wölfe und Strauchdiebe, die durch die Wälder schlichen und unbescholtene Bürger überfielen. Unermüdlich hatte Großmutter sie ermahnt, die Nacht außerhalb des Dorfes zu meiden, doch Großmutter war im letzten Winter gestorben und seitdem gab es niemanden mehr, der auf Inja achtete.
Sie warf einen kurzen Blick Richtung Dorf. Einsam und verlassen lag der Weg da. Keine Menschenseele weit und breit. Das misstönende Krächzen einer Krähe schreckte sie auf. Der Vogel flatterte von einem Baum herab, landete kaum zwei Schritte entfernt im Gras und starrte sie aus glänzenden, schwarzen Augen an.
Es ist nur eine Krähe, versuchte Inja sich zu beruhigen, trotzdem schlug ihr Herz wild in ihrer Brust und sie wich vorsichtshalber einen Schritt zurück. Der Vogel ließ sie nicht aus den Augen, beobachtete sie wie ein Jäger die Beute. Und plötzlich durchschnitt ein heiseres Röcheln die nächtliche Stille, ein unmenschlicher Laut, der Inja an den letzten Atemzug eines Sterbenden denken ließ. Eine konturlose Gestalt schälte sich aus dem Schatten eines Baumes, mehr ein Schemen, denn eine feste Gestalt. Die Gliedmaßen waren lang und dünn, die Finger wie verbrannte Zweige. Der durchdringende Geruch nach Schimmel und Fäulnis entströmte dem Leib, der schwärzer war als die schwärzeste Nacht, ein Abbild vollkommener Finsternis.
Ein Wiedergänger dachte Inja entsetzt. Was tut er hier, weit weg vom Schattenland? Sie wollte zurückweichen, doch ihre Füße waren wie festgefroren. Die Worte ihrer Großmutter hämmerten in ihrem Kopf. Lausche nie den Lauten eines Wiedergängers, denn sie lähmen dich, sodass du dich nicht mehr rühren kannst.
Die Krähe flatterte auf und ließ sich auf der Schulter des schaurigen Wesens nieder, verschmolz mit ihr zu einer Einheit, die jedes Licht absorbierte. Eisige Kälte kroch Injas Beine hinauf. Das Wesen öffnete den Mund, ein Schlund aus wirbelnder Luft. Ein Säuseln entströmte seiner Kehle, kaum zu verstehende Worte. »Schattenland«, war alles, was Inja heraushören konnte und etwas das ähnlich klang wie Arnyekeh.
Panisch presste Inja die Hände auf die Ohren, drehte sich um und rannte so schnell sie ihre Beine trugen. Steine gruben sich in ihre nackten Füße. Sie ignorierte den Schmerz. Das Blut rauschte in ihren Ohren. Schon kamen die Lichter des Dorfes in Sicht. Über ihr flog die Krähe, die Schwingen weit ausgebreitet. Inja schrie um Hilfe, während ihre Füße rannten und rannten. Eine Gestalt löste sich aus der hölzernen Einfriedung des Dorfes und eilte auf sie zu.
»Ban«, keuchte sie, nahm die Hände von den Ohren und stürzte sich in die Arme ihres Freundes.
»Inja, was ist passiert?«, fragte Ban. Er klang besorgt.
Sie antwortete nicht, denn sie war viel zu sehr damit beschäftigt, nach Luft zu ringen. Die Krähe wendete und flog krächzend davon.
»Komm, lass uns ins Dorf gehen. Alus will das Tor schließen.« Hastig schob Ban sie am Zaun vorbei.
»Warum … bist du … nicht zurückgekommen?«, keuchte sie.
»Ich bin zurückgekommen«, antwortete Ban entrüstet. »Doch du warst fort.«
Inja richtete sich auf und runzelte die Stirn. »Das ist nicht wahr. Ich bin die ganze Zeit über am Fluss gewesen und habe auf dich gewartet.«
Ban schüttelte den Kopf. »Vielleicht bist du im Fluss gewesen, aber auf keinem Fall am Ufer.« Er verschränkte die Arme vor der Brust und sah sie mitleidig an. »Hast du wieder einen deiner Tagträume gehabt und dich vom Flussufer entfernt? Und wieso bist du so nass? Hast du etwa im Fluss gebadet? Das ist gefährlich, das weißt du.«
»Ach lass mich in Ruhe«, erwiderte Inja unwirsch. Sie hatte doch nur im Wasser gelegen und einen Augenblick lang die Augen geschlossen. Oder hatte sie tatsächlich alles nur geträumt? »Sag hast du die riesige Krähe gesehen, die über mir geflogen ist?«
Ban runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Seine Mundwinkel zuckten, bei dem Versuch, ein Schmunzeln zu unterdrücken. »Du hast geträumt Inja. Was war es diesmal? Ein Klushund oder wieder ein Hakemann? Scheinbar lockt dich das Wasser des Murgflusses in die Welt der Träume.«
Inja schob schmollend die Unterlippe vor. In Bans Augen war sie eine Träumerin. Niemals würde er ihr Glauben schenken. »Ich gehe nach Hause«, sagte sie, wandte sich abrupt ab und stapfte davon.
Ban eilte ihr nach. »Tut mir leid. Ich wollte dich nicht kränken, aber ich schwöre, dass du nicht am Ufer gesessen hast, als ich mit der Angel kam.«
»Schon gut«, erwiderte sie missmutig und schritt noch ein wenig schneller aus. Sie wollte nicht mehr reden.
Kurz darauf erreichten sie die Schankstube, die sich in einer Seitengasse am Dorfrand befand. Die Butzenglasfenster waren hell erleuchtet, gegrölte Sauflieder drangen auf die Straße. Vor der Tür standen zwei Männer neben einer drallen Frau. Sie hatte die Brüste hochgeschnallt und warf Ban einen verführerischen Blick zu, bevor sie sich wieder den Männern widmete. Der Geruch nach Schwarzbier und Schweiß umhüllte die Drei wie eine Wolke. In einer dunklen Ecke stand ein Mann, der sich auf seinen Beinen abstützte, während er sich laut würgend erbrach.
»Willst du reingehen und deinen Eltern sagen, dass du zuhause bist?«, fragte Ban.
Inja warf einen angewiderten Blick auf den Betrunkenen und schüttelte den Kopf. »Mutter sagt, ich bin zu jung, um bei Nacht die Schänke zu betreten. Außerdem wäre ich sowieso nur im Weg.«
»Du zählst vierzehn Winter, ich finde das alt genug«, erwiderte Ban entrüstet.
Inja rollte mit den Augen. Ban war nur einen Winter älter als sie und mochte es gar nicht, für ein halbes Kind befunden zu werden. Dabei sah er natürlich noch lange nicht aus wie ein Mann. Sein flachsblondes Haar war strubbelig und immer ein wenig zu lang und sein Körper so ungelenk und schlaksig, als wäre er zu schnell gewachsen, was er auch war. Innerhalb eines Jahres war er in die Höhe geschossen und überragte Inja nun um eine Kopfeslänge. Inja dagegen war klein und zierlich, und obwohl sich erste Anzeichen von weiblichen Rundungen bemerkbar machten, ähnelte sie mehr einem Kind.
Am Hintereingang des Hauses hielten sie inne. Ban sah sie an, als würde er auf etwas warten.
»Gute Nacht«, sagte Inja, wandte sich ab und stieg die Stufen empor. Benlin, ihr jüngerer Bruder öffnete die Tür. Durchdringendes Geschrei begleitete ihn.
Inja seufzte. »Weint Irmeli schon wieder?«
Benlin stöhnte resigniert. »Ja, Beni und ich tragen sie abwechselnd herum, doch sie hört einfach nicht auf, zu schreien.«
Ohne sich nach Ban umzusehen, betrat Inja das Haus und schloss die Tür. Was war nur mit ihrer kleinen Schwester los, dass sie ständig weinte? »Wo sind Aberlin und Veit?«
»Aberlin ist bei seiner Liebsten«, antwortete Benlin und machte ein angewidertes Gesicht, als wäre das unvorstellbar ekelhaft. »Wo Veit ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich in der Schankstube.«
Benhard kam herbei, in den Armen hielt er Irmeli, Injas Schwester, die noch nicht einmal einen Winter zählte. Vor lauter Schreien hatte sie einen feuerroten Kopf und Schweißperlen glänzten auf ihrer Stirn. Inja nahm sie auf den Arm und wiegte sie sanft, während sie leise summte. Irmeli beruhigte sich, lehnte schluchzend den Kopf an Injas Schultern und schloss die Augen.
»Habt ihr sie gefüttert und ihre Wickeltücher gewechselt?«
Benlin und Benhard sahen sie empört an. »Wir haben ihr in Milch eingeweichtes Brot gegeben und ihr ein frisches Tuch umgebunden«, sagte Benhard.
»Vielleicht sitzt es etwas locker, doch wir haben es genauso gemacht, wie du es uns gezeigt hast«, fügte Benlin hinzu.
Lächelnd wuschelte Inja ihm durchs Haar, was er mit einem protestierenden Laut zur Kenntnis nahm. Sein Bruder Benhard grinste schadenfroh. Liebevoll betrachtete Inja die beiden Jungen. Wie ähnlich sie einander sahen mit den rotblonden Haaren, den unzähligen Sommersprossen und der schlaksigen Statur. Manche hielten sie aufgrund ihrer Ähnlichkeit sogar für Zwillinge. Auch ihr fiel es schwer, die beiden nicht als Einheit zu sehen, hatten sie doch in einem Abstand von nicht einmal einem Winter das Licht der Welt erblickt.
Mittlerweile war Irmeli eingeschlafen. Vorsichtig bettete Inja sie in die Wiege neben dem Esstisch und bedeckte sie mit einem Tuch.
»Wo bist du so lange gewesen?«, fragte Benhard.
»Ich war am Murgfluss und bin eingedöst«, log sie, weil sie ihre Brüder nicht mit ihrer seltsamen Vorliebe für das Wasser und unheimlichen Geschichten über Krähen und Wiedergänger ängstigen wollte.
»Hast du Saftpflaumen mitgebracht?«, fragte Benlin hoffnungsvoll. Er liebte süße Saftpflaumen.
Inja zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Nein, tut mir leid.«
»Das glaub ich nicht.« Benhard sprang auf, öffnete die Tür und trat auf die Treppe hinaus. »Ich schaue nach, ob Ban ein paar Pflaumen für uns dagelassen hat.« Kurz darauf kehrte er mit einem verknoteten Tuch zurück. »Ich wusste es doch. Ban lässt uns nie im Stich.«
Mit einem seligen Grinsen löste er den Knoten, nahm eine Frucht heraus und biss genüsslich hinein. Dunkelroter Saft tropfte über sein Kinn. Inja schüttelte den Kopf und ging zur Feuerstelle, um den Eintopf, den sie am Mittag zubereitet hatte, aufzuwärmen. Dann schnitt sie drei dicke Brotscheiben ab und trug sie zum Tisch. Irmeli schmatzte leise im Schlaf.
Nach dem Essen befahl Inja ihren Brüdern, sich zu waschen und schlafen zu gehen. Zwar murrten sie darüber, doch sie gehorchten. Auch Inja spürte die Müdigkeit und beschloss, ihren Brüdern zu folgen. Die Geschehnisse am Murgfluss steckten ihr noch in den Knochen. Vorsichtig, damit Irmeli nicht erwachte, trug sie die Wiege in ihre Kammer, streifte ihr Nachtgewand über und legte sich hin.
Aus der Schankstube drangen Gelächter und das Klappern der Krüge zu ihr hinauf. Trotz der vertrauten Geräusche rieselte ein Schauer über ihren Rücken und ein Gefühl der Beklommenheit überfiel sie, als sie die Kerze neben ihrer Bettstatt ausblies. Schnell kroch sie unter die wärmende Decke und zog sie übers Kinn. In der Dunkelheit stahl sich die Erinnerung an den Wiedergänger in ihre Gedanken. Das Geschehen am Fluss war so wirklich gewesen. Die Geräusche, der Geruch, die Krähe. Das konnte unmöglich ein Traum gewesen sein.
Schwarze Krähen verkünden Unheil, hatte ihre Großmutter immer gesagt. Eine leise Stimme in Inja flüsterte ihr zu, dass Großmutter Recht hatte. Etwas Unheilvolles würde geschehen. Schon sehr bald. Sie spürte es tief in ihrer Seele, wie eine unsichtbare Verletzung.
Im Morgengrauen stand Inja als Erste auf, wie sie es immer tat. Müde trug sie die Wiege mit ihrer schlafenden Schwester in die Küche und stieg dann mit der Waschschüssel unter dem Arm die Stufen hinter dem Haus hinab. Die vergangene Nacht war unruhig gewesen, voll wirrer Träume und sie fühlte sich kraftlos und verdrossen. Eigentlich hatte sie gehofft, dass die Morgensonne ihre Sorgen vertreiben würde, doch während sie einen Eimer Wasser aus dem Brunnen zog, spürte sie das Unbehagen fast noch stärker als zuvor. Nachdem sie die Waschschüssel gefüllt und in die Küche zurückgebracht hatte, kletterte sie in einen Verschlag hinter dem Gemüsegarten und sammelte die Hühnereier auf. Anschließend erleichterte sie die Ziege um einen Krug Milch. Schon auf der Treppe hörte sie Irmeli weinen. Oh nein. Nicht schon wieder. Seufzend öffnete sie die Tür und spähte in die Küche. Ihr ältester Bruder Aberlin stand mit bloßem Oberkörper über die Waschschüssel gebeugt und spritzte sich Wasser ins Gesicht. Veit saß am Tisch und hielt sich den Kopf, die rotblonden Haare, die er normalerweise mit einem Lederband bändigte, hingen wirr um seinen Kopf herum. Benlin füllte Buchweizenmehl in den Topf und Benhard deckte den Tisch. Niemand beachtete Irmeli, die sich am Wiegenrand hochgezogen hatte und aus Leibeskräften schrie. Einen Augenblick lang verharrte Inja im Türrahmen und betrachtete die Szene, nahm sie in sich auf wie einen wertvollen Schatz, bevor sie die Ziegenmilch an Benlin weiterreichte und Irmeli aus der Wiege hob. Die Tücher um ihren Po waren durchnässt und rochen nach Urin.
»Stopft dem verdammten Balg endlich das Maul«, brüllte es aus der der Schlafkammer der Eltern. Erschrocken blickte Inja zur Tür. Ihr Vater reagierte höchst ungehalten, wenn er aus dem Schlaf gerissen wurde, und hatte sie und ihre Geschwister schon oft hart bestraft, wenn sie zu laut waren oder es nicht schafften, ihre kleine Schwester zu beruhigen. Da Irmelis Wohl vornehmlich Injas Aufgabe war, bekam sie die meisten Ohrfeigen verpasst.
»Hol frische Tücher, schnell«, befahl sie an Veit gewandt. Der brummte unwillig, doch folgte er ihrer Anweisung. Die Angst vor dem Zorn des Vaters war größer als die Müdigkeit. Vorsichtig legte Inja ihre Schwester auf den Tisch und knotete die Windeltücher auf. Der Ausschlag zwischen ihren Beinen war schlimmer geworden.
»Veit. Bring das Sonnenkrautöl mit.«
Benhard trat hinter sie und schaute über ihre Schulter. »Was ist mit ihr?«
»Der Wundausschlag ist schlimmer geworden. Habt ihr das gestern Abend denn nicht bemerkt?« Ihre Stimme klang schärfer als beabsichtigt.
Benhard zuckte mit den Schultern, derweil trat Veit hinzu und reichte ihr die Tücher und eine kleine Flasche. Inja nahm die Sachen wortlos entgegen, goss etwas Öl auf ein Tuch und betupfte die Pusteln auf Irmelis Haut. Die Kleine strampelte mit ihren dicken Beinchen und schrie. Benhard warf einen besorgten Blick zur elterlichen Schlafkammer und versuchte dann hektisch, seine kleine Schwester mit Grimassen schneiden abzulenken. Erfolglos. Irmeli schrie und zeterte.
»Man könnte glauben, dass sie eine Tracht Prügel bekommt, so stellt sie sich an«, murrte Aberlin, während er sein Hemd zuschnürte.
»Sie ist noch klein und weiß es nicht besser«, erwiderte Inja vorwurfsvoll.
Geschickt wickelte sie die Tücher um Irmelis Gesäß, nahm sie hoch und reichte sie an Benhard weiter. »Nimm sie. Ich muss nach dem Buchweizenbrei sehen.«
Vor der Feuerstelle trat unvermittelt ihr Vater auf sie zu. Dunkle Ringe unter den Augen und bleiche Haut zeugten von seiner Müdigkeit. »Hab ich nicht gesagt, dass ihr das Balg beruhigen sollt?«, brüllte er, holte aus und schlug ihr ins Gesicht. Das Klatschen hallte durch die Küche. »Deine Mutter und ich schuften die ganze Nacht. Da ist es wohl nicht zu viel verlangt, wenn du dich am Morgen um deine Schwester kümmerst.«
Inja lag eine trotzige Erwiderung auf den Lippen. Immerhin kümmerten sie und ihre Brüder sich Tag und Nacht um Irmeli, die ihre Eltern kaum kannte und sich eher von Inja als von ihrer Mutter beruhigen ließ, doch sie schluckte die Worte. Es war ratsam, ihren Vater nicht noch mehr zu erzürnen, wollte sie keine weiteren Hiebe riskieren.
»Entschuldige Vater. Es wird nicht wieder vorkommen«, sagte sie mühsam beherrscht, wandte sich ab und rührte den Brei herum, der leise vor sich hinblubberte. Ihre Wange brannte von dem Schlag, doch sie verbot sich, vor den Augen des Vaters die schmerzende Stelle zu reiben. Der Vater spuckte ins Feuer und stapfte davon.
Nach dem Frühstück ging Inja in den Garten, wo sie Unkraut rupfte und Schmirgelschnecken vom Gemüse zupfte. Irmeli saß in einer hölzernen Einfriedung und lutschte an einer Brotkruste herum. Um die Mittagszeit wachten endlich ihre Eltern auf. Für Inja war das die beste Gelegenheit, sich aus dem Staub zu machen. Schnell reichte sie ihre kleine Schwester an die Mutter weiter, nahm den Wäschekorb und verließ das Haus.
Wie jeden Tag führte ihr Weg sie zuerst zu Ban, der in einer kleinen Kate am östlichen Tor lebte. Niemand wusste, wer Bans Vater war, nicht einmal Ban und je älter er wurde, umso mehr quälte ihn die Frage nach seiner Herkunft. Regelmäßig versuchte er seiner Mutter mit Schmeichelei und Drohungen die Wahrheit zu entlocken, stellte ihr Fallen, in der Hoffnung auf ein unbedachtes Wort, doch was er auch tat, die Lippen seiner Mutter blieben versiegelt. Anfänglich hatte Inja versucht, ihn deswegen zu trösten, doch das hatte ihn nur noch missmutiger gestimmt, deshalb ließ sie es lieber bleiben.
Leise vor sich hinsummend saß er auf einem Schemel vor dem Haus und schnitzte. Der vertraute Anblick zauberte das erste Lächeln des Tages auf Injas Gesicht.
»Ist heute Waschtag?«, fragte er mit einem schiefen Blick auf den gefüllten Korb.
Inja grinste entschuldigend. »Ja, leider.«
»Na gut.« Ban zuckte mit den Schultern, legte das Schnitzwerk zur Seite und erhob sich. Ohne zu fragen, ergriff er eine Seite des Korbes und begleitete sie zum Fluss. Ein Dutzend Frauen hatte sich ebenfalls am Flussufer eingefunden. Sie grüßten Inja und Ban nicht, warfen ihnen nur abfällige Blicke zu oder klopften sich eilig gegen Lippen und Stirn, bevor sie sich wieder dem Wäschewaschen zuwandten. Inja hörte sie tuscheln und Zorn wallte in ihr auf. Nie hatte sie den Dorfbewohnern Anlass gegeben, ihr zu misstrauen. Selbst ihre Vorliebe für das Wasser hielt sie geheim. Trotzdem begegneten sie ihr mit Feindseligkeit. Außer ihren Eltern und Geschwistern und natürlich Ban, vermieden es die Menschen, das Wort an sie zu richten oder sie auch nur anzusehen, als würde ihr Anblick allein schon Unglück bringen.
Ban, der Injas innere Aufruhr bemerkte, schubste sie aufmunternd an. »Beachte sie einfach nicht.«
Inja nickte. Er hatte recht. Trotzdem war ihre Laune nun vollends dahin. Schweigend wanderten sie ein Stück flussaufwärts. Vor der Abzweigung des Weges, der zur großen Straße führte, hielten sie inne. Inja nahm ein Hemd ihres Vaters und ein Stück Gallus zur Hand und tauchte es in das kalte Wasser. Die Strömung riss an dem Kleidungsstück, brachte ungewollt die Erinnerung an die vergangene Nacht zurück. An die schillernden Spuren des Buntfisches, den Wiedergänger und die Krähe, deren Perlenaugen sie auf so beängstigende Weise angestarrt hatten. Einen Augenblick lang glaubte sie sogar, die glänzenden Augen im Wasser zu sehen.
»He Träumerin schau mal. Da hinten sind Reiter.« Bans Worte rissen sie aus ihren Gedanken. Inja hob den Kopf und blickte zum Weg. Es geschah nicht oft, dass jemand nach Krickdorf kam. Der Ort lag abseits der großen Straßen und hatte einem Reisenden nichts zu bieten. Nicht einmal Händler oder Gaukler verirrten sich hierher, denn die Dorfbewohner waren arm und lebten nur von dem, was sie selbst anbauten. Wer im Leben etwas erreichen wollte, tat gut daran, wenn er Krickdorf verließ und nach Grimmelstadt oder Murg ging.
Inja beschattete die Augen und betrachtete die Wolke aus Erde und Staub, die von einer Vielzahl Hufe aufgewirbelt wurde.
»Das sind mindestens acht Berittene«, staunte Ban.
»Es sind zehn«, korrigierte Inja, die im Gegensatz zu Ban ausgesprochen gut sehen konnte. »Und sie tragen Harnische und Schilde, auf denen der geflügelte Stier prangt.«
Staunend riss Ban die Augen auf. »Bist du dir sicher? Das ist das Wappen des Königs!«
Inja nickte. Kälte kroch ihren Rücken hinauf. »Das ist mir nicht geheuer. Lass uns lieber ein Versteck suchen.«
»Warum? Es sind doch keine feindlichen Soldaten oder eine Räuberbande.«
Sie warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. »Es sind keine einfachen Soldaten. Kannst du das nicht sehen? Sie tragen die Stachelkugeln an ihrem Gurt. Das sind Männer der Söldnergarde. Nur die Götter wissen, was sie nach Krickdorf führt.«
Hastig stopfte sie das nasse Gewand in den Korb, nahm ihn auf und hockte sich zwischen die Wurzeln einer alten Sumpfeiche. Widerwillig folgte Ban ihrem Beispiel.
»Glaubst du, ich sollte Mutter warnen?«, flüsterte er.
Eine Warnung wird nicht reichen. Inja zuckte mit den Schultern, eine unbestimmte Angst schnürte ihr die Kehle zu.
Während die Reiter den Murgfluss überquerten, warf sie einen Blick auf ihre Gesichter mit den struppigen Bärten und den kalten Augen, die vermutlich schon jede Grausamkeit erblickt hatten, die es gab auf der Welt.
»Sollten wir nicht lieber ins Dorf zurückkehren?«, fragte Ban. Obwohl sie sich außer Hörweite der Soldaten befanden, sprach er weiterhin im Flüsterton.
Inja schüttelte den Kopf, noch immer außerstande zu sprechen. Die schreckliche Ahnung, die seit der Begegnung mit dem Wiedergänger in ihr keimte, nahm plötzlich Gestalt an.
»Aber wir müssen Mutter und deine Brüder warnen. Sie sollten die Türen verriegeln und in ihren Kammern bleiben.«
Inja schluckte nervös. Ban hatte recht. Ihr Gefühl sagte ihr, dass sie am Ufer des Murgflusses ausharren sollten, bis die Söldner Krickdorf wieder verließen, notfalls auch die ganze Nacht, doch die Vernunft drängte sie dazu, nach ihren Geschwistern zu sehen. Sollten die Männer in die Schankstube einkehren, würden Aberlin und Veit den Eltern sicher zu Hilfe eilen und Benlin, Benhard und Irmeli wären ganz allein.
»Du hast Recht. Lass uns zurückgehen«, sagte sie mit dumpfer Stimme.
Im Dorf erwartete sie Stille. Die Menschen hatten die Türen verriegelt und die Fenster mit Lumpen verhüllt, in der Hoffnung auf Schutz. Doch die Soldaten waren nicht wie der Winter, sie ließen sich nicht durch ein wärmendes Feuer und geschlossene Fensterläden vertreiben.
Wie Inja befürchtet hatte, waren die Männer in die Schankstube eingekehrt. Ihre Pferde standen vor dem Eingang und blockierten den gesamten Weg. Ein blutjunger Söldner band sie an einem Pfosten fest. Inja hielt inne und betrachtete den Mann. Das Haar trug er offen. Es war fettig und fiel über sein schmales Gesicht wie ein schmutziger brauner Vorhang. Sein Wams und die Beinkleider waren aus Leder und er trug den Waffengurt mit der Stachelkugel an seiner Hüfte. Beim Anblick seiner kräftigen Muskeln und des Langschwertes, das fast bis zum Boden reichte, krampfte sich Injas Magen schmerzhaft zusammen und sie warf Ban einen besorgten Blick zu. Ban hielt einen Finger an die Lippen und zog sie eilig in den Schatten des benachbarten Hauses.
»Wir müssen zur Hintertür schleichen. Auf keinem Fall darf uns jemand sehen«, wisperte er.
Inja nickte beklommen. Fast lautlos huschten sie zwischen den Häusern hindurch, bis sie zum Gartentor gelangten. Diesmal wartete Ban nicht, bis sie die Stufen hinaufgestiegen war, zu groß war die Sorge um das Wohl seiner Mutter. Inja hastete die Treppe hinauf. Die Tür war unverschlossen. Benlin saß am Küchentisch und blickte ihr ängstlich entgegen. Irmeli lag in der Wiege und schlief.
«Wo ist Beni?«, fragte sie.
»Er ist in die Schankstube gegangen«, erwiderte ihr Bruder geknickt.
Entsetzt riss Inja die Augen auf. »Was? Wie konntest du das zulassen? Weißt du denn nicht, dass Söldner des Königs im Dorf sind?«
Benlin senkte den Kopf. »Ich weiß. Er ist einfach fortgerannt, hat gesagt er will Veit holen, um uns zu beschützen.«
Hastig verriegelte Inja die Tür und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Fast ihre gesamte Familie befand sich in der Schankstube, in Gesellschaft der Söldner. Das war übel. Blieb nur zu hoffen, dass sie sich einigermaßen gesittet verhielten. Wenn sie an die Geschichten dachte, die man sich von der königlichen Söldnergarde erzählte, war das jedoch mehr als unwahrscheinlich. Allerorts verbreiteten die Männer Angst und Schrecken. Mit unbarmherziger Härte schlugen sie Aufstände nieder, trieben überfällige Steuern ein und suchten und töteten flüchtige Halunken. In Kriegszeiten schwächten sie Feinde, noch bevor die Schlacht begann, indem sie die Ernten vernichteten, das Vieh abschlachteten und Dörfer und Weiler niederbrannten. Das alleine wäre nicht besonders beunruhigend, doch solange die Söldnergarde ihre Aufgaben erfüllte, kümmerte sich König Ulrik nicht um das, was sie anrichteten, wenn sie zwischendurch ihr kurzes Leben genossen. Bei diesem Gedanken wurde Inja elend zumute. Die Aussicht, dass ihre Familie unversehrt hieraus hervorgehen würde, war gering. Was würde geschehen, sollten die Männer das Haus niederbrennen? Oder gar das ganze Dorf? Wovon sollten sie dann leben?
Erschöpft barg Inja den Kopf in den Händen. Mutlosigkeit und Sorge schwemmten über sie hinweg wie eine tödliche Flut.
»Was ist mit dir?«, fragte Benlin.
»Es ist nichts, ich bin nur müde«, murmelte sie in ihre Hand.
»Die Männer werden Beni doch nichts antun, oder?«
Die Angst in Benlins Stimme veranlasste Inja dazu, den Kopf zu heben und ihren Bruder anzusehen. Er blickte flehend, wie ein verwundetes Tier. Er fürchtete um Benhards Wohl mehr noch als um das seiner Eltern. Sie nahm seine Hand und zwang sich zu einem Lächeln. »Mach dir keine Sorgen. Benhard wird nichts passieren.«
»Bist du sicher?«
»Natürlich. Alles wird gut.« Die Worte kamen ihr glatt von den Lippen und sie hoffte, dass sie sich nicht als Lüge herausstellen würden, noch bevor die Nacht vorüber war.