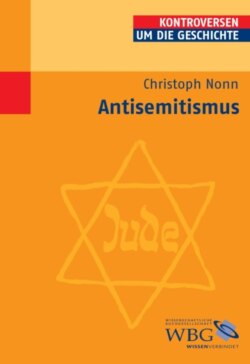Читать книгу Antisemitismus - Christoph Nonn - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Judenfeindschaft vor und in der Moderne – Kontinuität oder Bruch?
ОглавлениеWie ähnlich ist ein Schmetterling einer Raupe? Nicht eben sehr, hat es den Anschein. Dennoch gibt es Raupen, aus denen Schmetterlinge werden. Solche Gestaltveränderungen oder Metamorphosen gibt es wie im Tierreich auch in der Geschichte der Judenfeindschaft. Denkt man an die hässliche Fratze des nationalsozialistischen Antisemitismus im 20. Jahrhundert, mag der Vergleich mit einem Schmetterling unter ästhetischen Dimensionen zwar etwas hinken. Doch gerade um das Absehen von Äußerlichkeiten geht es hier. Denn wie bei der Metamorphose der Raupe zum Schmetterling stellt sich auch bei der Entwicklung der vormodernen zur modernen Judenfeindschaft die Frage: Entspricht dem offensichtlichen Wandel der äußeren Form auch ein Wandel der Inhalte? Hat sich die Natur des Objekts grundlegend verändert?
Kontinuitätsthese
Manche Historiker verneinen diese Frage. Sie sehen eine grundlegende Kontinuität der Judenfeindschaft zwischen Vormoderne und Moderne. In einem Aufsatz mit dem Titel Vom christlichen Judenhass zum modernen Antisemitismus hat Yehuda Bauer diese Position pointiert zusammengefasst. Zwar hätten Judenfeinde in Europa seit dem 19. Jahrhundert dem modernen Zeitgeist oberflächlichen Tribut gezollt, indem sie ihre abstrusen Vorstellungen als Wissenschaft ausgaben und mit neuen Ideologien wie Nationalismus verbanden. „Doch kann der Antisemitismus sein christliches Erbe nicht verleugnen.“ Christentum und Judenhass bildeten eine unauflösliche Einheit. Da die westliche Kultur im Christentum wurzele, sei Judenfeindschaft in dieser Kultur allgegenwärtig. Sie verändere sich allenfalls in den äußeren Formen, aber nicht in ihrer Natur. Judenhass ähnele überdies dem Grinsen der Cheshire-Katze im Buch Alice im Wunderland, das noch bleibt, wenn der Rest der Katze bereits unsichtbar geworden ist: Als „eine tiefgründige kulturelle Erscheinung des Abendlandes“ bleibe er auch dort lebendig, wo das Christentum durch Säkularisierung an sichtbarer Bedeutung verliert. Denn letztlich gingen auch vermeintlich säkulare Formen von Judenhass auf christliche Traditionen zurück (63; ähnlich 27, S. 204 – 207; 29; 35; 55).
NS als „politische Religion“
Auch der nationalsozialistische Antisemitismus wird aus dieser Sicht in der Tradition christlicher Judenfeindschaft verortet. Besonders Michael Ley hat den Nationalsozialismus als „politische Religion“ interpretiert. Zwar verstand Hitler seine Bewegung als säkular und auch gegen die christliche Religion gerichtet. Vor allem ideologisch habe der Nationalsozialismus jedoch vielfach direkt an christliche Vorstellungen angeknüpft. So übernähmen die Juden in der nationalsozialistischen Weltanschauung die Rolle, die im christlichen Weltbild dem Teufel zukomme. Mit diesem im Bunde zu sein, wurde den Juden im Christentum traditionell ohnehin unterstellt. Auch das nationalsozialistische Verständnis der Geschichte als Rassenkampf zwischen Ariern und Juden, der mit der totalen Vernichtung der Letzteren enden müsse, sei eine säkularisierte Version der Auseinandersetzung zwischen den Kräften des Himmels und der Hölle in der biblischen Apokalypse. Die Utopie des „tausendjährigen Reiches“ baue auf christlichen Endzeiterwartungen auf, die seit dem Spätmittelalter nachweisbar sind (72; 73; 74; 81; 82).
In einem vielzitierten Buch über die „theologischen Wurzeln des modernen Antisemitismus“ hat Rosemary Ruether deshalb Kontinuitäten christlicher Judenfeindschaft seit der Antike betont. Wenn man diese Kontinuitäten zur Kenntnis nehme, werde „aus dem angeblichen Bruch zwischen mittelalterlichem Antijudaismus und dem Nazismus eine unbequeme Nähe“. Zwar habe die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden seit dem 19. Jahrhundert „den Antijudaismus in neuen Formen“ belebt, „indem sie die Grundlage für den Hass von theologischen auf nationalistische und dann rassistische Gründe übersetzte […] Doch dieselben Stereotypen, dieselben psychologischen Grundeinstellungen wurden bei dem Wechsel der theoretischen Grundlagen beibehalten […] Die Rassentheorie war neu, doch die Stereotypen des Hasses waren die alten“ (76, S. 199f.).
Transformationsthese
Die Neuheit der Rassentheorie ist denn auch der zentrale Einwand gegen die Kontinuitätsthese. Tatsächlich gehen viele Historiker von einem grundlegenden Bruch, einer einschneidenden Transformation in der Entwicklung der Judenfeindschaft aus. Im Gegensatz zu Bauer, Ley, Ruether und anderen sehen sie eine wesentliche Zäsur zwischen einem früheren, religiös begründeten Antijudaismus und einem späteren, rassistisch motivierten Antisemitismus. Dafür spräche bereits, „dass der Begriff ,Antisemitismusʻ erst im 19. Jahrhundert als Selbstbezeichnung der Träger dieser Form von Judenfeindschaft aufkam, schon im Wort den rassisch konstruierten Gegensatz zwischen ,Semitenʻ und anderen (,Ariernʻ) anzeigend“. Hauptsächlich argumentieren die Vertreter der Transformationsthese allerdings mit einer in vielerlei Hinsicht neuartigen Ausprägung von Judenfeindschaft. „Die Akzente dieser Argumentation können im einzelnen verschieden ausfallen. Zentral ist das Argument, dass mit dem Antisemitismus die Judenfeindschaft auf eine nachreligiöse Grundlage gestellt wurde“ (67, S. 99).
Dass ein solcher Wandel erfolgt ist, erkennen zumindest manche Vertreter der Kontinuitätsthese durchaus an. In Frage gestellt wird von ihnen aber, ob dieser Wandel in der Theorie auch Rückwirkungen auf die Praxis der Judenfeindschaft gehabt hat. Ein noch so einschneidender Wechsel der theoretischen Grundlagen von Judenhass ließe sich als letzten Endes nebensächlich abqualifizieren, wenn die Inhalte antijüdischer Vorurteile und die daraus erwachsenden Handlungen gegen Juden die gleichen blieben. In diesem Sinn verwiesen Rosemary Ruether und andere auf die langfristige Kontinuität von stereotypen Judenbildern (38; 47; 76). Nach Ansicht von Victor Karady „hat die Behandlung der Juden durch die Christen in der Geschichte die wesentlichen Modelle der antijüdischen Gewalt in der Moderne geliefert. Die Massaker der mittelalterlichen Kreuzzüge, die Pogrome in Russland während des ganzen 19. Jahrhunderts, die ,Reichskristallnachtʻ (10. November 1938) und die in Kielce (Polen) oder Kunmadaras (Ungarn) 1946 verübten Morde unterscheiden sich kaum voneinander (auch nicht im Ausmaß der Brutalität). Die Scheiterhaufen der Inquisition […] dienten als Vorbild für die Krematorien von Auschwitz“ (27, S. 205f.). Und macht es überhaupt einen Unterschied für die jüdischen Opfer von Pogromen, warum sie gedemütigt, misshandelt, vertrieben oder getötet werden? Spielt es eine Rolle, ob sie aus religiösen oder rassischen Motiven verfolgt werden?
„Judenfrage“ im Christentum
Die Vertreter der Transformationsthese antworten darauf freilich: Ja – es spielt eine Rolle, und es macht einen Unterschied. Denn die Auswechslung der theoretischen Grundlagen von Judenhass in der Moderne hatte ihrer Auffassung nach auch wichtige Folgen für die Praxis judenfeindlicher Politik. In der christlichen Weltsicht des Mittelalters wurde den Juden demnach ein gänzlich anderer Platz angewiesen als in der rassistischen Weltsicht der deutschen Nationalsozialisten des 20. Jahrhunderts. Es mochten zwar in beiden Weltanschauungen Juden die Antithese zu Christentum und „Ariertum“ verkörpern. Insofern stellte die jüdische Existenz sowohl für mittelalterliche Christen wie auch für Nationalsozialisten ein subjektives Problem dar: Für beide gab es eine „Judenfrage“. Über die Lösung dieses subjektiv konstruierten Problems gab es aber in der vormodernen christlichen Welt ganz andere Vorstellungen als unter den rassistischen Antisemiten der Moderne. Nach traditionell christlichem Verständnis konnte die Antwort auf die „Judenfrage“ letzten Endes nur durch göttliche Intervention gegeben werden. Im göttlichen Heilsplan kam den Juden die Rolle zu, am Jüngsten Tag als „letzte Zeugen“ die Göttlichkeit von Jesus zu erkennen und damit die Erlösung der ganzen Menschheit zu vollenden. Christen konnten auf den Tag der Erlösung zwar hinarbeiten, indem sie sich schon vorher um eine Bekehrung von Juden zum „wahren Glauben“ bemühten. Im Grunde blieb aber der Jüngste Tag und damit auch die endgültige Lösung der „Judenfrage“ ein Akt göttlicher Gnade.
Zwar gestehen Anhänger der Transformationsthese wie David Nirenberg durchaus zu, dass deshalb Juden in der christlich geprägten Welt der europäischen Vormoderne keineswegs Diskriminierung und Verfolgung erspart blieb. Die theologische Etikettierung von Juden als Bundesgenossen von Teufel und Antichrist, überschießender Bekehrungseifer und andere, durchaus profane Motive wie das Bestreben statt jüdischer Seelen jüdischen Besitz zu gewinnen, spielten dabei gleichermaßen eine Rolle. Für die Opfer hatte das grausame und nicht selten auch tödliche Konsequenzen. Dennoch unterschied sich die Lage von Juden im vormodernen christlichen Europa individuell wie kollektiv grundsätzlich von der unter nationalsozialistischer Herrschaft. Dem Einzelnen blieb der Weg offen, sich durch Bekehrung zum Christentum Verfolgung und Tod zu entziehen. In der Verfolgung durch die nationalsozialistischen Rassisten, die das Judentum als Abstammungs- statt als Religionsgemeinschaft konstruierten, war dieser Ausweg dagegen versperrt. Während der Vormoderne engagierten sich zudem die geistigen und weltlichen Obrigkeiten, allen voran das Papsttum, in der Regel für Schutz und Erhaltung jüdischer Gemeinschaften, dabei auch immer eingedenk der Funktion, die den Juden nach christlichem Verständnis im göttlichen Heilsplan am Ende der Zeiten zukommen sollte (75).
„Judenfrage“ im NS
Die Gegensätze zum nationalsozialistischen Antisemitismus liegen auf der Hand. Den rassistischen Judenhassern des 20. Jahrhunderts war die der christlichen Welt eigene Heilsgewissheit verloren gegangen. An die Stelle der göttlichen Vorsehung war für sie die Gestaltung des Schicksals durch den Menschen getreten. Die Lösung der „Judenfrage“ konnte in dieser säkularisierten Form der Judenfeindschaft nicht mehr auf das Ende der Zeiten vertagt, sondern musste im Diesseits selbst angegangen werden. Und weil sie anders als nach christlichem Verständnis nicht durch die Integration der Juden in das eigene Lager denkbar erschien, ließ sie sich nur als physische Vernichtung des imaginierten Gegenübers vorstellen – und in die Tat umsetzen (67, S. 106 – 108; 69, S. 306f.). Die Judenverfolgungen der Vormoderne mögen zwar an Brutalität denen der Moderne nicht nachstehen. Deshalb die einen mit den anderen gleichzusetzen, übersieht aber nicht nur die unterschiedlichen Motivlagen. Es ignoriert zumindest im Fall des nationalsozialistischen Völkermords an den europäischen Juden während des zweiten Weltkriegs auch die Totalität des dahinter stehenden Vernichtungswillens.
Zeitpunkt der Transformation
Angesichts dieser Differenzen wird die Transformationsthese von Spezialisten für moderne (22; 44) wie für vormoderne Judenfeindschaft geteilt (64; 68; 75). Nicht ganz eindeutig sind in dieser Gruppe allerdings die Ansichten darüber, wann sich der Prozess der Transformation von religiös zu rassisch motiviertem Judenhass vollzogen hat. Die klassische und bis heute am meisten verbreitete Auffassung geht von einem mehr oder weniger klaren Bruch im 19. Jahrhundert aus. In diesem Jahrhundert habe eine Sicht von Juden als „Rasse“ sich weithin durchgesetzt. Erst seitdem sei es üblich geworden, unter dem Judentum eine Abstammungsgemeinschaft zu verstehen. Bis ins 18. Jahrhundert habe man darunter hingegen eine Religionsgemeinschaft verstanden.
Dieser Auffassung sind jedoch empirische Befunde entgegengehalten worden, die auf rassistische Elemente in judenfeindlichem Denken schon weit vor dem 19. Jahrhundert hindeuten. So findet sich bereits zur Zeit der Reformation in einer Reihe von Texten aus dem deutschen Sprachraum der Begriff „Taufjude“. Bezeichnet wurden so Menschen jüdischer Herkunft, die zum Christentum konvertiert waren. Das Judenbild der Autoren der betreffenden Texte war offensichtlich zumindest nicht nur von religiösen Kategorien geprägt (77, S. XIV–XIX). In Spanien wurden im späten 15. Jahrhundert zum Christentum Konvertierte ebenfalls als Juden ausgegrenzt und verfolgt. Das geschah hier im Rahmen von „Blutreinheitsgesetzen“ sogar von Seiten der Staatsgewalt. Manche Historiker haben diese Gesetze als Anzeichen für einen Antisemitismus auf rassistischer Grundlage interpretiert, der mit dem nationalsozialistischen vergleichbar sei (66).
Die Analyse antijüdischer Bildstereotype gibt sogar Hinweise darauf, dass Rassismus selbst in mittelalterlicher Judenfeindschaft einen Platz haben konnte: Die „jüdische Hakennase“ als prominentestes Element der antisemitischen Vorstellung eines „typisch jüdischen“ Körpers, und damit einer auch durch Bekehrung zum Christentum nicht veränderbaren jüdischen Natur, taucht zum ersten Mal bereits in einer Illustration des 13. Jahrhundert auf. Dieses rassistische Bildstereotyp entstand zudem aus einer Übertragung religiöser Konzepte: Die Hakennase war zunächst nur ein Attribut von bildlichen Darstellungen des Teufels. Angesichts der christlichen Praxis, Juden als Bundesgenossen des Teufels anzusehen, wurden dann auch diese mit ihr dargestellt (70). Letzten Endes stellen solche Befunde nicht nur die gängige These eines Wandels der Judenfeindschaft im 19. Jahrhundert in Frage, sondern auch eine Grundlage der Transformationsthese überhaupt: nämlich die Annahme, dass sich religiöse und rassistische Bestandteile von Judenhass analytisch voneinander trennen lassen.
Gavin Langmuirs Alternative: Chimärischer Antisemitismus
Gavin Langmuir hat deshalb vorgeschlagen, den Versuch dazu ganz aufzugeben. Stattdessen plädiert er für eine alternative Klassifizierung von Judenfeindschaft in xenophobe (fremdenfeindliche) und chimärische Vorstellungen. Eine xenophobe Vorstellung steht etwa hinter der Behauptung, alle Juden seien Wucherer. Ein solche Behauptung ist zwar nachweislich falsch. Da es aber durchaus auch Juden gibt, die Wucher treiben, hat sie immerhin noch einen gewissen Bezug zur Realität, weil tatsächliche Eigenschaften einzelner Mitglieder einer Gruppe der ganzen Gruppe zugeschrieben werden. Chimärische Vorstellungen zeichnen sich dagegen durch den Verlust jedes Realitätsbezuges aus. Dazu gehören zum Beispiel die Vorwürfe, Juden würden Ritualmorde an Christen begehen oder hätten sich zur Erlangung der Weltherrschaft verschworen, die jeder Grundlage in der Wirklichkeit entbehren. Nach Langmuir kamen solche chimärischen Vorstellungen über Juden erst seit dem 12. Jahrhundert auf. Sie hätten zu einer Intensivierung und Radikalisierung ihrer Verfolgung durch Christen geführt. Dies, und nicht ein Übergang von religiösem zu rassistisch motiviertem Judenhass, sei die entscheidende Transformation (71).
Langmuirs Theorie erinnert an den wichtigen Umstand, dass Judenfeindschaft sich auch nach anderen Kriterien klassifizieren lässt als nach den ihr zugrunde liegenden Motiven. Seine Schlussfolgerungen über die historische Entwicklung des Phänomens sind unter anderen Wissenschaftlern allerdings größtenteils auf Skepsis gestoßen. Denn wenn auch chimärische Vorstellungen wie die von jüdischen Ritualmorden erst seit dem 12. Jahrhundert entstanden, gab es vergleichbare Wahnideen unter Nichtjuden doch schon wesentlich früher. Der nicht weniger chimärische Glaube, Juden verehrten den Teufel oder beteten zu einem Eselskopf, ist etwa bereits für Antike und frühes Mittelalter belegt (67, S. 102; 78, S. 721f). Langmuirs Ansicht, dass der entscheidende Wandel in der Natur von Judenfeindschaft der zu chimärischen Vorstellungen ist, und dass dieser Wandel während des Hochmittelalters im 12. Jahrhundert geschah, hat sich deswegen nicht durchgesetzt.
Gleitende Transformation
Ebenso wenig durchgesetzt hat sich eine von einzelnen Historikern zur Diskussion gestellte Vorverlegung der Transformation von religiösen zu rassistischen Triebkräften des Judenhasses auf die Zeit um 1500 oder noch früher. Die meisten Anhänger der Transformationsthese gehen weiterhin davon aus, dass dieser Wechsel theoretischer Grundlagen erst seit dem 19. Jahrhundert weithin handlungsleitend wurde. Der Wechsel wird allerdings nun vielfach weniger als radikaler Bruch denn als gleitender Übergang mit einer längeren Vorbereitungsphase gesehen. So möchte etwa Rainer Walz zwar an der Unterscheidung zwischen einem christlich geprägten Antijudaismus im Mittelalter und einem modernen Rassismus im 19. und 20. Jahrhundert festhalten. Dazwischen sieht er aber eine Phase des „genealogischen Rassismus“ in der frühen Neuzeit. Dieser „genealogische Rassismus“ habe eher die gemeinsame Abstammung aller Juden betont, der spätere „anthropologische Rassismus“ mehr ihre Natur (78). Johannes Heil und andere sprechen dagegen lieber von einem „Proto-Rassismus“ in spätem Mittelalter und früher Neuzeit, weil in den Quellen dieser Epoche eine Gemengelage von genealogischen und anthropologischen Argumenten anzutreffen sei (67, S. 103 – 109). Tatsächlich gesteht Walz zu, dass der Inhalt von Begriffen wie „Rasse“ und „Abstammung“, aber auch von „Religion“, „Stand“ und „Nation“ zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert nicht wirklich voneinander zu scheiden sei (78, S. 724 – 728). Einigkeit besteht jedenfalls über einen Bedeutungsgewinn rassistischer und säkularer Elemente im Lauf der Zeit: Weil „das traditionelle Vorurteilssystem aus seinem religiösen oder religiös bemäntelten Legitimationsrahmen gelöst wurde“, habe schließlich „die Judenfeindschaft eine neue Qualität“ erreicht (67, S. 104f.).
Untersuchungen judenfeindlicher Stereotype
Bisher sind Kontinuitäts- und Transformationsthese an der historischen Entwicklung einzelner antijüdischer Stereotype, ob xenophob oder chimärisch, nur selten überprüft worden. Das vormoderne Klischee vom jüdischen Wucherer erfreut sich zwar eines breiten wissenschaftlichen wie öffentlichen Interesses (38, S. 43 – 147), aber tiefschürfende Analysen über seine Verbindungen zur modernen Legende vom „jüdischen Finanzkapital“ und deren Aspekte fehlen. Auch die Vorstellung vom jüdischen Ritualmord ist erst in Ansätzen systematisch untersucht worden. Neben Forschungen zu ihren Ursprüngen aus christlicher Blutmystik und Gottesmordvorwurf liegen vor allem Fallstudien zu einzelnen Ritualmordvorwürfen vor. Trotz einer Fülle von Detailstudien (zuletzt: 17; 255; 282) ist die analytische Erschließung von Kontinuitäten und Brüchen der Ritualmordlegende seit ihrer Entstehung im 12. Jahrhundert immer noch ein Desiderat der Forschung. Stefan Rohrbacher hat allerdings einen Hinweis darauf gegeben, dass die Legende spätestens im nationalsozialistischen Deutschland während des Zweiten Weltkriegs in wesentlich gewandelter Form auftaucht. Die Propaganda der Nationalsozialisten stellte den Weltkrieg nämlich als einen jüdischen „Ritualmord an den Völkern“ dar. Der Ritualmordvorwurf wurde dabei nicht nur von seinen christlichen Elementen getrennt und mit dem Nationalismus verbunden. Er wurde auch mit einem anderen uralten antijüdischen Stereotyp verquickt „als ein letzter Versuch der jüdischen Weltverschwörung, die nichtjüdische Menschheit abzuschlachten“ (38, S. 357f).
„Jüdische Weltverschwörung“
Die Geschichte der Vorstellung von einer jüdischen Weltverschwörung ist ein vergleichsweise gut erforschtes Stereotyp. Norman Cohn hat sich schon vor längerer Zeit mit der im 20. Jahrhundert am weitesten verbreiteten Variante dieses „Mythos“ beschäftigt, mit den „Protokollen der Weisen von Zion“. Diese „Protokolle“ einer angeblichen Besprechung zwischen den Führern des „Weltjudentums“ über die Schritte zur Erlangung jüdischer Herrschaft auf dem gesamten Globus wurden Anfang des Jahrhunderts in Russland von radikalen Antisemiten gefälscht. Cohn interpretierte dieses Machwerk und die Geschichte seiner Rezeption im Wesentlichen als Ausdruck einer ungebrochenen Kontinuität antijüdischen Denkens seit dem Mittelalter. Die im 20. Jahrhundert verbreitete Vorstellung von der jüdischen Weltverschwörung sei „einfach eine modernisierte, säkularisierte Form des mittelalterlichen Volksglaubens, wonach die Juden eine Rotte von Zauberern waren, deren sich Satan bediente, um die Christenheit geistig und körperlich zugrunde zu richten“ (18, S. 12).
Die Entwicklung dieser Vorstellung vor dem 19. Jahrhundert untersuchte Cohn allerdings nicht näher. Das tat erst Johannes Heil ein halbes Menschenalter später. Heils Ergebnisse widersprechen Cohns Kontinuitätsthese deutlich. Demnach koppelte sich der Glaube an eine jüdische Weltverschwörung bereits seit dem Spätmittelalter zunehmend von seinen religiösen Wurzeln ab. Die Verbindungen zwischen diesem Glauben und dem an den Teufel, die besonders in der Figur des „Antichristen“ zusammenflossen, verblassten während der frühen Neuzeit zusehends. Der Antichrist, so Heil, verschwand aus der Mitte der europäischen Vorstellungswelten, und nach dem 17. Jahrhundert „hat man ihn sang- und klanglos in die Gruft der Ideengeschichte zur letzten Ruhe gebettet“. Der imaginierte Zielpunkt der jüdischen Verschwörung wurde infolgedessen aus dem Jenseits ins Diesseits verlegt. Aus einer latenten wurde in der antisemitischen Vorstellungswelt dadurch eine akute Gefahr; der nun unmittelbar bevorstehenden jüdischen „Machtergreifung“ musste durch sofortige Aktion zuvorgekommen werden. Das „Heil“, die Rettung vor der jüdischen Weltherrschaft, lag jetzt nur noch in der totalen physischen Vernichtung des Gegners. Den Juden blieb damit der ihnen in der christlichen Welt offene Ausweg der Assimilation, der Bekehrung versperrt. Von einer bruchlosen Kontinuität könne deswegen keine Rede sein, urteilt die vorläufig letzte Studie zur Frage des Verhältnisses von Judenfeindschaft vor und in der Moderne (68).