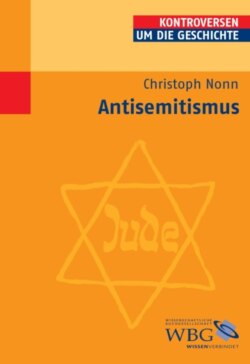Читать книгу Antisemitismus - Christoph Nonn - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Soziale und wirtschaftliche Kontexte
ОглавлениеWirtschaftskrisen und Antisemitismus
Diese Differenzen haben eine Reihe von Interpretationen der Judenfeindschaft aus deren ökonomischen und sozialen Kontexten zu erklären versucht. So wird etwa dem Auf und Ab wirtschaftlicher Entwicklungen eine besondere Bedeutung zugemessen. Die klassische Fassung dieser Interpretationsrichtung, die einen kausalen Zusammenhang zwischen konjunkturellen Krisen und Antisemitismus annimmt, stammt von dem deutschamerikanischen Historiker Hans Rosenberg. Rosenberg musste in den 1930er Jahren wegen seiner jüdischen Abstammung aus Deutschland fliehen und fand in Kalifornien eine neue Heimat. Noch während des Zweiten Weltkriegs formulierte er erste Ideen zu den Ursachen des modernen deutschen Antisemitismus in der wirtschaftlichen Entwicklung des späten 19. Jahrhunderts. Ein Vierteljahrhundert später publizierte er diese Überlegungen in ausführlicher Form als Kapitel eines Buches über Große Depression und Bismarckzeit (103, S. 88 – 117).
Die Zeit der „Großen Depression“ in den Jahren 1873 bis 1896 sah Rosenberg als erste Wirtschaftskrise des industriellen Deutschland. Das Entstehen antisemitischer Parteien und ihr Wachstum in dieser Zeit interpretierte er als direkte Folge der Krise. Es habe sich während der „Großen Depression“ eine „antisemitische Volkswelle“ gebildet, „die in weitgehendem Maße gerade mit dem Klagen über die Wirtschaftslage und die sozialen Schäden der kapitalistischen Entwicklung kausal verbunden war“. Besonders Bauern und Angehörige der Mittelschichten, die sich wegen der krisenhaften industriellen Entwicklung gefährdet sahen, seien für die Parolen der neuen antisemitischen Parteien anfällig gewesen. Dieser Befund einer Abhängigkeit des Ausmaßes der Judenfeindschaft von ökonomischen Krisen lasse sich aber auch auf spätere Epochen der deutschen Geschichte übertragen: „Dass ein Wirkungs- und Sinnzusammenhang zwischen der Dynamik des Wirtschaftsablaufs und dem Wachstumsprozess des Antisemitismus bestanden hat, wird jedenfalls nahe gelegt durch die bemerkenswerte Korrelation, der gemäß bis zum Zweiten Weltkrieg das langfristige Anschwellen und Abflauen der akuten Judenfeindschaft umgekehrt proportional zu den langen Schwingungen der Wirtschaftslage und der sozialen Spannungen verlief […] In gewissem Sinn kann man in der Tat sagen: Seit 1873 stieg der Antisemitismus, wenn der Aktienkurs fiel“ (103, S. 111, 95f.).
Tatsächlich verlief die Entwicklung der antisemitischen Parteien zumindest in Deutschland auffallend parallel zu den wirtschaftlichen Wechsellagen. Während des Kaiserreichs erreichten sie ihre besten Wahlergebnisse nach den beiden Tiefpunkten der „Großen Depression“ am Anfang der 1880er und in den frühen 1890er Jahren. Als danach eine bis zum Ersten Weltkrieg anhaltende Phase der wirtschaftlichen Hochkonjunktur einsetzte, versanken sie dagegen in Bedeutungslosigkeit. Mit der Ära der großen Inflation nach dem Krieg gewannen antisemitische Parteien dann mehr Wählerstimmen als jemals zuvor. In der Mitte der zwanziger Jahre gingen mit einer vorübergehenden Beruhigung der wirtschaftlichen Lage auch ihre Wahlerfolge noch einmal zurück, bis sich vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise ab 1929 der Aufstieg der NSDAP zur stärksten Partei vollzog.
Nicht nur zwischen den Erfolgen antisemitischer Parteien und Konjunktureinbrüchen ist ein enger Zusammenhang gesehen worden. Auch Ausbrüche von Gewalt gegen Juden werden oft als Folge von Wirtschaftskrisen interpretiert. Mehrere neuere Fallstudien haben deren Rolle als Ursache für Pogrome während des deutschen Kaiserreichs und der Weimarer Republik hervorgehoben (222; 232; 256; 289). Für die Zeit vor der Gründung des Kaiserreichs, in der es keine antisemitischen Parteiorganisationen gab, gewinnen gewaltsame Ausschreitungen gegen Juden als Indikator für Antisemitismus besondere Bedeutung. Auch die Autoren von einigen Studien über solche Pogrome in verschiedenen Regionen Mitteleuropas während des frühen 19. Jahrhunderts vertreten die These, dass diese im Kern ökonomisch bedingt gewesen seien (57; 224). Eine international vergleichende Untersuchung, die mit quantifizierenden Methoden Gewaltakte gegen Juden und ihre Darstellung in führenden Tageszeitungen von fünf europäischen Ländern zwischen 1899 und 1939 analysiert, identifiziert wirtschaftliche Krisenlagen ebenfalls als einen wichtigen Faktor für Antisemitismus (108).
Allerdings wird in diesen Analysen fast immer ausgeblendet, dass „Krise“ tatsächlich ein sehr subjektiver Begriff ist. So nimmt man etwa heute in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitslosenraten als völlig normal hin, die während der 1960er Jahre unter Bevölkerung und Politikern alle Alarmglocken hätten schrillen lassen. Ab wann die Entwicklung von Arbeitslosigkeit, Preisen oder Aktienkursen „krisenhaft“ erscheint, ist eine Frage der Definition (vgl. auch 93, S. 55f). Das erklärt mit, warum manche Autoren von Studien zu Pogromen im deutschen Sprachraum vor 1848 eine kausale Verbindung zu „Krisen“ annehmen (49; 57; 224), während andere diese verneinen (28; 39; 228). Tatsächlich kann man eine solche Kausalität an sich ebenso wenig feststellen wie das Vorhandensein einer „Krise“. Feststellen lässt sich höchstens, ob Zeitgenossen eine Krise sehen, und ob sie eine gedankliche Verbindung zwischen ihr und Juden konstruieren.
Selbst dann ist freilich die Frage nicht beantwortet, warum diese Verbindung hergestellt wird – und warum sie mit Juden hergestellt wird. Wie die Theorie von der antisemitischen Persönlichkeit können auch ökonomische Interpretationen des Antisemitismus nicht erklären, warum gerade die Juden als Zielscheibe ausgesucht werden. Von Kurt Tucholsky stammt ein Witz, der dieses Problem sarkastisch auf den Punkt bringt: Zwei Männer sitzen in einem Café und lesen Zeitung. Plötzlich springt der eine auf und schreit laut: „Die Juden sind unser Unglück!“ Der andere blickt kurz hoch und seufzt: „Ja, ja, die Juden und die Radfahrer.“ – „Wieso denn die Radfahrer?“ fragt der eine verblüfft. „Wieso denn die Juden?“ gibt der andere zurück.
Eine denkbare Erklärung dafür, dass Juden besonders gerne für alle möglichen Missstände verantwortlich gemacht werden, ist der Eindruck einer jüdischen Allgegenwärtigkeit. Anders als andere Minderheiten scheint es Juden in fast der ganzen Welt zu geben. Und im Unterschied zu den „Zigeunern“, den Sinti und Roma, gehören sie nicht nur den Unterschichten an, sondern sind in allen sozialen Schichten vertreten (34, S. 15f). Das würde freilich letzten Endes nur die Legende von einer jüdischen Weltverschwörung erklären. Diese spielt aber in konkreten antisemitischen Äußerungen und Handlungen in konkreten Situationen meist keine Rolle. Jedenfalls lässt sich nicht nachweisen, dass sie hinter jedem antisemitischen Verhalten steht, was auch ziemlich unwahrscheinlich sein dürfte. Die Kernfrage, die sich letztlich dem Historiker des Antisemitismus bei jeder Analyse konkreter Situationen stellt, in der auch andere potentielle Sündenböcke zur Verfügung stehen, bleibt damit bestehen: Warum die Juden?
Realkonfliktthese
Die radikalste Antwort darauf lautet, dass Juden gar keine Sündenböcke sind und Antisemitismus vielmehr eine Folge von realen sozialen Konflikten ist, in denen sie eine Konfliktpartei stellen. Diese Realkonfliktthese ist wohl die am heftigsten umstrittene aller Erklärungen für Judenfeindschaft. In ihrer klassischen Form stammt sie von Eva Reichmann. Wie so viele Pioniere der Antisemitismusforschung wurde auch Reichmann wegen ihrer jüdischen Abstammung von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben. 1945 schloss sie in London ihre Doktorarbeit über die Ursachen der deutschen Judenkatastrophe ab. Die These, „dass der Antisemitismus mit den Juden überhaupt nichts zu tun habe“, erklärte Reichmann darin für „fast ebenso einseitig wie die der Antisemiten, dass die Juden allein am Antisemitismus schuld seien.“ Antisemitismus war in ihren Augen zwar nicht immer und ausschließlich, aber doch auch Folge von sozialen Spannungen zwischen Juden und Nichtjuden. Besonders sei das in Deutschland während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts der Fall gewesen, als die emanzipierten Juden vielfach in Berufe eindrangen, die bis dahin Christen vorbehalten gewesen waren, und so Konflikte mit christlichen Anwälten, Ärzten oder Kaufleuten ausgelöst hätten (101, S. 27 – 36).
Reichmanns Realkonfliktthese ist unter anderem von mehreren neueren Arbeiten, die sich international vergleichend mit Antisemitismus in mehreren europäischen Ländern befassen, aufgegriffen worden. So hat Albert Lindemann den sozialen Aufstieg der Juden zwischen 1870 und 1914 als den Faktor bezeichnet, der am offensichtlichsten das Wachstum des modernen Antisemitismus erklären könne (110). William Brustein identifiziert in seiner aufwendigen, mit statistischen Korrelationsanalysen arbeitenden Studie die Zahl der jüdischen Einwanderer in ein Land als eine von vier Ursachen für das Ausmaß von Judenfeindschaft während der vier Jahrzehnte vor 1939 (108). In einer weniger ehrgeizigen Arbeit, die „nur“ Antisemitismus in einigen mittel- und osteuropäischen Staaten zwischen den beiden Weltkriegen vergleicht, stellt William Hagen die These auf, dass in Polen und wahrscheinlich auch in Ungarn und Rumänien reale soziale Konflikte zwischen christlichen Mehrheiten und großen jüdischen Minderheiten ein Ansteigen von Antisemitismus wesentlich begünstigt hätten (109). Auch mehrere empirisch gesättigte Detailstudien haben Realkonflikte als Ursache von Judenhass unter den verschiedensten Gruppen ausgemacht, so unter Berliner Kaufleuten (156) und deutschen Studenten (237) im Kaiserreich, oder unter hessischen (224) und elsässischen (167) Bauern während des frühen 19. Jahrhunderts.
Unter den Einwänden gegen die Realkonfliktthese sind diejenigen weniger ernst zu nehmen, die ihren Vertretern antisemitische Sympathien unterstellen (48, S. 61f.; 93, S. 62; 405, S. 101 f.). Solche Kritik wirft meist nicht nur komplexe historische Erklärungsansätze mit kruden Stammtischparolen in einen Topf, sondern übersieht auch, dass gerade die entschiedensten Repräsentanten der Realkonfliktthese selbst Juden waren und sind. Die These spielt von jeher eine Rolle in innerjüdischen Debatten zwischen Befürwortern und Gegnern einer Akkulturation an die christliche Mehrheitsgesellschaft (101, S. 288 – 291; 110, S. 533f.). Noch problematischer als ihre Entstehung und Instrumentalisierung im Kontext solcher außerwissenschaftlicher Kontroversen ist für die Plausibilität der Realkonfliktthese allerdings die Tatsache, dass Antisemitismus durchaus auch ohne Juden auskommt. Im modernen Japan sind Juden ebenso wenig präsent wie sie es etwa in England vom 13. Jahrhundert bis in Shakespeares Tage waren. Dennoch gab es im vormodernen England virulenten Judenhass, genau wie es diesen im heutigen Japan gibt (90; 119, S. 27 – 39).
Mehr noch: Gerade die besonders radikalen, rassistischen Formen von Judenhass lassen sich offensichtlich aus realen sozialen Konflikten zwischen Juden und Christen kaum erklären. Jedenfalls entwickelten christliche Kaufleute und Handwerker in Berlin, die sich um 1900 in einer Konkurrenzsituation zu jüdischen Unternehmern sahen, eine eher traditionell geprägte Judenfeindschaft. Unter denselben Berufsgruppen in Wien, die in keiner solchen Konkurrenzsituation standen, breitete sich dagegen gleichzeitig ein rassistisch geprägter Antisemitismus aus (156). Bauern im Westen Frankreichs, wo es keine Juden gab, votierten bei Wahlen für rassistische Antisemiten, während elsässische Landwirte, die mit jüdischen Händlern zu tun hatten, eher eine traditionell religiös motivierte Judenfeindschaft pflegten (177, S. 655 – 671). Wo der jüdische Bevölkerungsanteil im Europa der Zwischenkriegszeit mit fünf bis über zehn Prozent am höchsten war, nämlich in Polen, Rumänien und Ungarn, und das Potential für soziale Spannungen zwischen Juden und Nichtjuden daher besonders groß, blieb Judenfeindschaft weitaus weniger radikal und rassistisch als in Deutschland, obwohl dort das Potential für Realkonflikte angesichts von weniger als einem Prozent jüdischer Bevölkerung viel geringer lag.
Ersatzkonfliktthese
Statt in einer tatsächlichen gesellschaftlichen Spannung zwischen Nichtjuden und Juden sieht die Ersatzkonfliktthese die zentrale Ursache von Antisemitismus darum in einer Verschiebung der Ziele von sozialem Protest. Juden erscheinen in ihr nicht als Konfliktpartei, sondern als Sündenböcke. Der Bedarf nach Sündenböcken ergibt sich zum einen aus der Existenz von „Schafen, die ihrer bedürfen“, wie der Schriftsteller Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften den Titelhelden sagen lässt (93, S. 50). Die „Schafe“ werden in Interpretationen von Antisemitismus, die auf der Ersatzkonfliktthese aufbauen, in der Regel mit Unterschichten identifiziert. Eliten und Obrigkeiten würden dann den Protest der Unterschichten, der sich gegen sie selbst richtet, mit manipulativen Methoden auf Juden als Ersatzziel ablenken.
Die Ersatzkonfliktthese geht zurück auf sozialistische Antisemitismustheorien, die bereits im späten 19. Jahrhundert entwickelt wurden (45, S. 117 – 120). Nach 1945 war die Erklärung von Judenfeindschaft aus Manipulationen kapitalistischer Oberschichten zur Ablenkung von Klassengegensätzen Pflichtübung unter Historikern der DDR (99). In der pluralistischen Geschichtswissenschaft des Westens entwickelte sich dagegen eine heftige Kontroverse über diesen Erklärungsansatz. Streit entstand vor allem über die Bewertung antijüdischer Ausschreitungen im Deutschen Bund zwischen 1815 und 1848/49. Eleonore Sterling und andere Autoren sahen darin einen Ausdruck von Unterschichtenprotest. Dieser habe sich eigentlich an wirtschaftlichen und sozialen Missständen entzündet, aber wegen fehlender Einsicht in gesellschaftliche Zusammenhänge oder Unerreichbarkeit der tatsächlich verantwortlichen Eliten gegen die leichter greifbaren Juden als Ersatzziel entladen (49; 50; 57; 92; 106). Dagegen wandte sich vor allem Stefan Rohrbacher: Die antijüdische Gewalt im Biedermeier sei primär weder auf soziale oder ökonomische Faktoren zurückzuführen, noch handle es sich dabei um einen Ersatzkonflikt. Ursachen und Anlässe für die Pogrome seien hauptsächlich politischer Natur gewesen, und die Ausschreitungen hätten mit den Juden genau die getroffen, die getroffen werden sollten. Denn der Protest habe sich nicht gegen Obrigkeiten und gesellschaftliche Eliten gerichtet, sondern gegen die bevorstehende Emanzipation der jüdischen Bevölkerung (28; 39; 40; 228).
Freilich müssen sich beide Erklärungen nicht immer und unbedingt ausschließen. Die Emanzipation war ein politisches Thema, aber sie hatte wirtschaftliche und soziale Folgewirkungen, die den Zeitgenossen wohl bewusst waren. Emanzipation bedeutete auf dem Land gleichberechtigte Beteiligung von Juden am dörflichen Gemeindeeigentum, im städtischen Gewerbe stärkere jüdische Konkurrenz. Jüdische Gleichberechtigung und Teilhabe verkleinerte potentiell die Stücke, die für Nichtjuden vom Kuchen abfielen. Die Pogrome der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts richteten sich gegen Juden, aber sie konnten auch ohne Weiteres überschwappen in Attacken auf gesellschaftliche Oberschichten oder Repräsentanten staatlicher Macht. In einigen Fällen ist schwer zu erkennen, wer das eigentliche Ziel der Ausschreitungen war. Tatsächlich waren es ja auch die liberalen bürgerlichen Eliten, die sich hauptsächlich für die Emanzipation der Juden engagierten, und die staatlichen Autoritäten, die diese schließlich entgegen aller Widerstände durchsetzten. Auch spätere antisemitische Ausschreitungen wurden von der Wahrnehmung angetrieben, dass Juden, Staat und liberales Bürgertum unter einer Decke steckten (24, S. 189 – 194; 255, S. 156 – 168).