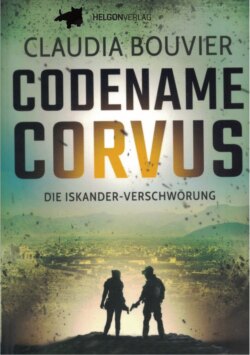Читать книгу Codename Corvus Thriller - Claudia Bouvier - Страница 9
ОглавлениеDrittes Kapitel
Afghanistan – Provinz Zabul – Absturzstelle des MedEvac
Rossis Atem stockte und sie wich instinktiv zurück. Unten beim Hubschrauberwrack bewegte sich etwas. Sie erspähte eine kleine Gruppe von bis an die Zähne bewaffneten Männern in Tarnanzügen, die plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht waren. Weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick konnte sie diese seltsamen Tarnanzüge, die mit der Umgebung zu verschmelzen schienen, einem der in Afghanistan vertretenen Truppenkontingente zuordnen. Und es waren gewiss keine Afghanen, weder Taliban noch Mudschaheddin noch irgendeine Miliz, dazu waren sie viel zu gut und einheitlich ausgerüstet. Rossi überlegte ein bisschen. Die Kerle waren ganz eindeutig Europäer und die Mündungen ihrer Waffen richteten sich auf das Wrack, in dem sich der Special-Forces-Soldat befand. Der Flecktarn sah irgendwie aus wie der US-MARPAT oder der neue kanadische Flecktarn CADPAT. Glücklicherweise kam niemandem die Idee, nach oben zu blicken oder gar in die Felsen zu klettern, um nachzusehen, ob sich vielleicht noch andere Überlebende herumtrieben. Rossi entschied sich für US-MARPAT. Sie als Ärztin machte nie einen solchen Aufstand um Tarnkleidung, sondern lief in der klassischen, kochfesten deutschen Standardware herum. Sie wollte sich in ihrem Feldhospital ja auch nicht verstecken. Aber die Kerle in der modischen Tarnkluft hatten eine sehr präzise Idee von dem, was sie wollten.
Rossi war etwa eine halbe Stunde zuvor mit grauenhaften Kopfschmerzen aufgewacht. Zunächst hatte sie gar nichts verstanden, dann waren langsam ein paar Erinnerungen zurückgekehrt; der fürchterliche Schlag, das Blut in ihrem Gesicht, die Hand, die sie nach oben gezogen und festgehalten hatte, der unverletzte Soldat aus der obskuren Special-Forces-Einheit, ruhige dunkelbraune Augen, die sie angelächelt hatten, ein einlullender beruhigender Singsang in einer Sprache, die ihr wage bekannt vorkam.
Der Mann hatte sich trotz der schlimmen Lage, in der sie waren, rührend um sie gekümmert. Sie war in einem weichen warmen, wenn auch übelriechenden Nest aus verschwitzten Kleidungsstücken aufgewacht. An ihrem rechten Handgelenk, Zifferblatt nach unten, bemerkte sie an einem khakifarbenen Zulu-Strap eine robuste, etwas altertümlich wirkende Taucheruhr. Unter ihrer rechten Hand hatte sie eine geladene halbautomatische Glock 17, ein paar mit 9-mm-Parabellum gefüllte Ersatzmagazine und ein gefährlich wirkendes, schlankes Kampfmesser gefunden. Direkt vor ihren Augen standen eine Wasserflasche, ein Dreißigerpäckchen Ibuprofen 400 mg und ein komplettes RCIR, eine jener heiß begehrten französischen Kampfrationen, um die alle in Afghanistan stationierten Truppen sich stritten, und für die man auf dem schwarzen Markt der ISAF mindestens fünf amerikanische MREs oder drei deutsche EPAs hinlegen musste. Im Gegensatz zu allen anderen militärischen Einmann-Futterpackungen enthielt die französische auch einen Esbit-Kocher, auf dem man sich zu den selbstwärmenden Mahlzeiten noch diskret einen heißen Tee oder Kaffee kochen konnte.
Die seltsame kleine Inszenierung hatte Rossi berührt und gleichzeitig beruhigt: Sie befand sich zwar im Niemandsland in den Bergen zwischen den Provinzen Kandahār und Zabul, doch sie war nicht allein und ihre Lage war nicht aussichtslos. Der Special-Forces-Soldat hatte seine sieben Sinne offensichtlich beisammen und wusste, was er tat. Selbst der Schnitt über ihrem rechten Auge war professionell versorgt. Sie hatte sich noch gewundert, woher er an einem solchen Ort Klammerpflaster und Ibuprofen-Tabletten bekam, und was im Kopf eines Mannes vorging, der in ihrer üblen Situation Zeit darauf verschwendete, die Bildung einer Narbe an einer belanglosen Stelle zu verhindern.
Noch leicht benommen nahm sie die Tabletten, das Wasser und die Pistole und kroch aus ihrem Versteck. Dann setzte sie sich eine Weile in die Sonne und wartete, bis das Gefühl der Übelkeit verschwand. Nach ein paar Schlucken Wasser und zwei Ibuprofen hörte ihr Kopf schließlich auf zu dröhnen. Es war still. Außer dem Rauschen des Flusses und ein paar Vögeln hörte sie nichts. Lediglich der widerliche Gestank nach verbranntem Fleisch und Treibstoff störte das afghanische Bergidyll.
Als sie sich besser fühlte, wurde sie unternehmungslustiger und erkundete ihre direkte Umgebung. Es gab nicht viel zu sehen; die Höhle lag gut versteckt auf einer Anhöhe direkt neben einem kleinen Wasserfall, der sich über graue Felsen und verstreutes Geröll hinunter in eine tiefergelegene Schlucht stürzte. Unten in der Schlucht hatte sie sofort den zerstörten Hubschrauber entdeckt und ihren schwarzhaarigen, bärtigen Schutzengel.
Er war dabei, mühselig irgendwelche Dinge aus dem Wrack zu bergen. Sie setzte sich hin und beobachtete ihn. Einmal sah er zu ihr hoch, bemerkte sie, winkte ihr zu und bedeutete ihr durch eine Geste, zu bleiben, wo sie war. Helfen konnte sie ihm in ihrem leicht benommenen Zustand sowieso nicht, und obwohl sie sportlich und durchtrainiert war, wäre sie nie so unbefangen wie er in das eiskalte Wasser gesprungen, um gegen die wilde Strömung bis zu dem Wrack des Hubschraubers zu schwimmen. Ihre Welt waren die Berge.
Und dann, als der Special-Forces-Soldat gerade in das Wrack gekrochen war, hatte sie die anderen Männer bemerkt. Im ersten Reflex wollte Rossi aufstehen und ihm ihre Entdeckung zurufen. War es möglich, dass Rettung so unglaublich nahe sein konnte? Doch sie besann sich und hielt inne. Gleich darauf beglückwünschte sie sich zu diesem weisen Entschluss, als sie beobachtete, wie die sechs unbekannten Männer ihre Maschinengewehre auf ihren Retter richteten, als dieser mit frischer Beute in den Armen wieder aus dem Wrack herauskroch. Rossi stockte kurz der Atem während ihr Herzschlag sich beschleunigte. Wenn das keine Irregulären, sondern wirklich Amerikaner waren? Vielleicht stammten sie ja aus einer dieser berüchtigten Special Operations Groups der Special Activities Division des US-Geheimdienstes CIA, über die auf der Kandahār-Airbase immer wieder die haarsträubendsten Stories erzählt wurden.
Pakistan – Provinz Khyber Pakhtunkhwa – Peshāwar
Der Mann wusste, dass ein Hotel der Luxusklasse wie das Pearl Continental immer die beste Garantie für Anonymität war, selbst in einem Dreckloch wie Peshāwar. Er bezahlte sein Zimmer in bar und verließ das Hotel im Zentrum der Stadt. Ein großer, schwarzer Geländewagen mit getönten Scheiben erwartete ihn. Kurze Zeit später bog der gepanzerte Chevrolet in die Ringstraße ein. Der Verkehr war in Peshāwar wie überall in Pakistan eine wilde Mischung aus kompletter Anarchie und normalem Chaos. Rund zwanzig Minuten später hatten sie den Schlagbaum und die Polizeikontrolle am südlichen Stadtrand passiert und befanden sich auf dem Weg nach Kohat. Die kugelsichere Trennscheibe zwischen der Fahrerkabine und dem Passagier wurde heruntergelassen. Der Mann hatte den Beifahrer bereits am Pearl Continental bemerkt.
»Es tut mir leid, dass ich Sie nicht früher begrüßen konnte, Sir.«
Jones steckte sein Satellitentelefon weg und drehte sich um. Der Anruf von der anderen Seite der Grenze verdarb ihm die Laune, doch er ließ sich nichts anmerken. Sein Freund Arkadij Matveev war tot und die Truppe ehemaliger SpezNas bis zum letzten Mann ausgelöscht! Das Dorf Rustam Kalay ein Trümmerhaufen! Dazu erhebliche Verluste in der Zivilbevölkerung! Jones kochte. Die Situation war verfahren. Keiner wusste, wer die Angreifer gewesen waren. Und ihr Versuch, heimlich in die Grabungsstätte einzudringen, war durch eine wanderlustige Ziege und Dadullahs ältesten Sohn rein zufällig vereitelt worden. In Anbetracht der Tatsache, dass sie erhebliche Geldmittel in hochmoderne Technologien zur Sicherung der Grabungsstätte investiert hatten, war dies ein schwaches Bild. Es war natürlich nicht der erste Zwischenfall dieser Art, und es würde gewiss auch nicht der letzte sein, doch ohne jegliche Vorwarnung hatte es bislang noch niemand fertiggebracht in ihre Nähe zu kommen, nicht einmal Aufklärungsdrohnen. Zabul war ein Hexenkessel und eine Hochburg der Taliban. Und die Taliban in Zabul gehorchten Dadullah. Dadullah herrschte mit eiserner Faust über die Provinz. Daran änderten auch die fast übermenschlichen Anstrengungen der Anti-Terror-Koalition OEF nichts. Dank der Nähe zu Pakistan mangelte es dem Warlord nie an Kämpfern: Tausende arbeits- und perspektivloser junger Paschtunen in den Stammesgebieten standen bereit, die Ränge des berüchtigten Warlords aufzufüllen. Und Dutzende junge Verblendete, die von islamischen Emigranten in Europa abstammten und davon überzeugt waren, nur wegen ihres Glaubens von der ganzen Welt benachteiligt zu werden, gesellten sich zu ihnen, um an diesem fernen Ende der Welt einen völlig sinnlosen Tod zu sterben.
»Es hat vor Ort ein Problem gegeben!«, erklärte Jones knapp seinem Auftraggeber.
»Aber Sie haben es gelöst und alles ist wieder unter Kontrolle?«, erwiderte der Mann genau so kurz angebunden. Er blickte Jones prüfend an.
Der Söldner schüttelte den Kopf. Sie kannten sich schon viel zu lange, um einander noch zu belügen: Ihre Beziehung war zwar nicht freundschaftlich, doch sie beruhte auf gegenseitiger Wertschätzung, ehrlichem Respekt und absolutem Vertrauen. Seitdem ihre Wege sich 1982 zum ersten Mal gekreuzt hatten, arbeiteten sie ausgezeichnet zusammen.
»Ein Teil des Problems hat sich sozusagen in Luft aufgelöst, Boss«, bemerkte Jones lakonisch in Anspielung auf die Boden-Luft-Rakete, die den MedEvac vom Himmel geholt hatte. »Was den Rest anbetrifft – wir werden sehen, sobald wir vor Ort sind. Im Augenblick kann ich Ihnen einfach nicht mehr sagen.«
Der Mann im Fond nickte. »Ich vertraue Ihnen, Jones. Sie wissen, was Sie tun müssen. Berichten Sie mir jetzt lieber von der Grabung.«
Jones atmete auf. Das unangenehme Thema war vorerst vom Tisch. Er wollte dem Boss auch nicht unqualifizierten Unfug erzählen, ohne genaue Kenntnis der Gesamtsituation zu haben. Sein sonnengebräuntes, kantiges Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. Aus der Brusttasche fingerte er eine Memory-Flash-Card, die er in sein Mobiltelefon schob. Der Professor hatte Jones vorsorglich ein paar ausgezeichnete Fotos mitgegeben. Sein Auftraggeber betrachtete die Bilder eingehend.
»Waren Sie auch unten?« In der Stimme des Manns schwang eine unverhohlene Neugier. Er bemühte sich nicht im Geringsten, seine Freude zu verbergen.
Jones schmunzelte. »Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, Ihr Interesse an dieser Sache zu teilen, Boss. Doch ja, ich war unten und ich war beeindruckt. Und der Professor ist euphorisch. Alles ist außergewöhnlich gut erhalten … ganz so, als ob die Gewölbe erst vor ein paar Tagen verschlossen worden wären.«
Der Mann war genauso euphorisch wie seine beiden Freunde vor Ort. Sie hatten bereits über Skype lange darüber gesprochen. Die Freunde hatten ihm triumphierend eine der kleineren Steintafeln gezeigt. Er hatte die Inschrift problemlos lesen können.
Dreißig Jahre hatte es gedauert, aber am Ende hatten sie es doch geschafft. Trotz aller Probleme und Schwierigkeiten, trotz der Sowjets, trotz der beiden Kriege und des Bürgerkrieges. Nicht einmal 9/11, die Twin Towers und der amerikanische Krieg gegen den Terrorismus hatten sie entzweit oder ihre uralte Freundschaft auch nur ins Wanken gebracht. Keiner von ihnen hatte je aufgegeben oder gezweifelt. Und jetzt ging ihr gemeinsamer Traum endlich in Erfüllung. Sie hatten diesen spektakulären und in seinen Ausmaßen gewaltigen Fund gemacht, als sie noch Studenten gewesen waren, am Ende ihres zweiten Studienjahres. Es war wahrscheinlich der Fund ihres Lebens. Sie hatten es geschafft, eines der größten Rätsel der Geschichte der Antike zu lösen, auch wenn niemand das je erfahren würde.
Afghanistan – Provinz Zabul – Shinkay Distrikt – Absturzstelle des MedEvac
O’Shaughnessy beobachtete seinen Gefangenen nachdenklich. Der saß mit gefesselten Händen und Füssen gegen einen Felsbrocken gelehnt etwas abseits ihrer Gruppe. Er ähnelte einem dieser halbverhungerten Köter, die man überall in Afghanistan herumlungern sah: struppiges, schwarzes Haar, ein struppiger Bart, feindselige dunkle Augen, zäh, dünn und dreckig. Ein paar Fliegen krabbelten über das verkrustete Blut auf seinen Armen und Händen, doch er machte keine Anstalten, sich zu bewegen, um die Quälgeister zu verscheuchen. Allerdings hatte diese Reglosigkeit nichts mit Resignation zu tun. Angesichts ihrer durchgeladenen und entsicherten Waffen hatte der Mann sich ohne viel Aufhebens gefangen nehmen lassen. Er hatte wohl verstanden, dass seine einzige Alternative dazu ein Schicksal wie das seiner toten Kameraden aus dem Helikopter war. Außer ihrem Gefangenen und den beiden Leichen am Ufer hatten O’Shaughnessy und sein Trupp noch die beiden Piloten und die beiden Bordschützen gefunden, vier schwer verbrannte Leichen, die man unmöglich aus dem Wrack hätte bergen können.
O’Shaughnessy ging davon aus, dass Zabelevs Information richtig war. Es fehlten somit mindestens zwei, vielleicht sogar drei Personen, die sich im Augenblick des Abschusses in diesem Rettungshubschrauber befunden hatten. Er zog die Handvoll ID-Tags, die er dem Gefangenen abgenommen hatte, aus einer Tasche seiner Funktionsweste und ließ sie nachdenklich durch die Finger gleiten. Beide Piloten, die zwei Bordschützen und eine der Leichen am Ufer waren Kanadier, die andere Leiche hatte noch ihren holländischen ID-Tag um den Hals getragen. Ihr Gefangener behauptete steif und fest ebenfalls Kanadier zu sein und seine Erkennungsmarke bei dem Versuch verloren zu haben, die toten Kameraden aus dem Wrack zu bergen. Sie hatten ihm eine ordentliche Tracht Prügel verpasst, aber alles, was sie aus ihm herausbekommen hatten, waren Name, Vorname, Geburtsdatum, Dienstgrad und die Personenkennziffer. Er war stur wie ein Maultier und pochte gebetsmühlenartig auf den völkerrechtlichen Schutz von medizinischem Personal als Nichtkombattanten. Er sei Arzt!
Angesichts der Tatsache, dass ihr Gefangener sehr genau mitbekommen hatte, dass sie weder Taliban noch irgendeine afghanische Miliz waren, sondern eine Truppe, die zu hundert Prozent aus Angelsachsen bestand und sogar US-amerikanische Tarnkluft trug, war diese Sturheit vielleicht auch nicht verwunderlich. Der Typ unterstellte ihnen ganz offensichtlich, dass sie sich aus diesem Grund auch an die Spielregeln halten würden, vielleicht sogar Reguläre waren. Und da weder O’Shaughnessy noch einer seiner Männer auch nur ein Wort Französisch sprachen, konnten sie die Geschichte mit Kanada auch nicht überprüfen. Der Kerl selbst sprach exzellentes Englisch mit einem leichten Akzent, der nicht Amerikanisch war und selbst ihn als Briten nicht befremdete.
Trotzdem störte O’Shaughnessy etwas. Er konnte es nur noch nicht greifen oder in Worte fassen. Es war ein Bauchgefühl, eine innere Stimme. Dieser angebliche kanadische Militärarzt nahm seine verfahrene Situation viel zu gelassen hin. Er hatte vom ersten Augenblick an alles richtiggemacht: Als sie ihn – mit auf ihn gerichteten Waffen – gestellt hatten, hatte er keine Angst gezeigt. Er hatte einfach dagestanden, die Augen geschlossen, durchgeatmet und sie machen lassen. Damit hatte er verhindert, versehentlich zu sterben oder – schlimmer noch – versehentlich schwer verletzt zu werden, weil einer seiner Fänger durchdrehte und schoss. Gehorsam war er ihnen gefolgt und hatte sich widerstandslos hingekniet und fesseln lassen. Auch ihre rauen Befragungsmethoden hatten ihn nicht beeindruckt. Die Prügel hatte er weggesteckt wie jemand, dem man beigebracht hatte, ein Verhör durchzustehen. Jetzt saß er an einen Felsbrocken gelehnt; trotzig, dreckig, blutig und zerschlagen. Er hatte geschrien, gejammert und geklagt, doch er trug den Kopf erhoben, und er bat um nichts; nicht um Wasser, nicht um Essen oder darum, dass irgendeine mitfühlende Seele seine Fesseln lockerte, die ihm inzwischen schmerzhaft ins Fleisch schneiden mussten. Und dann waren da noch seine Augen; furchtlos und aufmerksam beobachteten sie seine Peiniger wie ein Raubtier die Beute. O’Shaughnessy beschloss, mit einem seiner Männer zu tauschen.
Diskret entsicherte er seine Waffe.
× × ×
Die Nacht hatte sich schon vor Stunden langsam über ihr Felsenversteck und die Absturzstelle des Helikopters gesenkt. Trotzdem beobachtete Rossi angespannt weiter. Ihre Verwirrtheit und Schwäche vom frühen Nachmittag waren wie weggeblasen, genauso ihre Unsicherheit. Sie hatte die Typen in den seltsamen Tarnanzügen beobachtet, wie sie ihren Special-Forces-Soldaten zuerst gestellt und anschließend brutal verhört hatten. Sie erinnerte sich nicht daran, wie lange das abstoßende Schauspiel gedauert hatte. Zehn Minuten? Eine Stunde? Den ganzen Nachmittag? Der Mann hatte trotz der Schläge und Tritte geschwiegen. Nach einer halben Ewigkeit prügelten sie endlich ein paar zusammenhängende Worte in englischer Sprache aus ihm heraus. Im Gebirge trugen Stimmen, Rossi hatte alles mitangehört. Er besaß den Nerv, die Kerle auch noch nach Strich und Faden zu belügen. Dabei wanderte sein Blick kein einziges Mal in Richtung der Felsen und des Wasserfalls. Erst kurz vor Einbruch der Dämmerung, als die Typen mit Diskussionen abgelenkt waren, sah er einmal kurz zu ihr hoch. Einer – wohl ihr Anführer – verschwand mit seinem Satellitentelefon. Rossi begriff genau, was die Kopfbewegung des Soldaten bedeutete: Sie sollte verschwinden, solange die sonderbaren Kerle mit ihm beschäftigt waren, laufen, so schnell sie ihre Füße trugen, weg, irgendwohin. Nur nicht hierbleiben. Sie hatte warme Kleidung, seine Waffen und seine gesamte Ausrüstung. Sie hatte eine gute Chance durchzukommen. Doch eine innere Stimme flüsterte ihr zu, dass das falsch wäre. Er hatte ihr das Leben gerettet. Sie konnte sich jetzt nicht umdrehen und ihn einfach seinem Schicksal überlassen.
× × ×
Rossi war zur Höhle zurückgeschlichen, um Bestandsaufnahme zu machen. Sie selbst besaß nicht viel: Eine handliche, kleine Taschenlampe mit nagelneuen Batterien, ein Päckchen Kaugummi, das uralte Stethoskop, das sie seit Unizeiten immer als Glücksbringer mit sich herumschleppte, und einen Stadtplan von Kandahār. Ganz anders der Special-Forces-Soldat: Sie hatte systematisch sämtliche Taschen seiner zahlreichen zurückgelassenen Kleidungsstücke durchsucht. Ihre Funde ähnelten mehr einem Trödelmarkt als einem Combat-Outfit: ein kleiner Kompass, ein kleines Nachtsichtfernglas, ein Feuerzeug und eine Überlebensdecke. Dazu ein komplettes medizinisches Notfallset nach NATO-Standard. Der Mann hatte wirklich an alles gedacht. Nicht einmal die berüchtigten Go-Pills fehlten; das Päckchen mit den Amphetaminen war nagelneu.
Sie fand auch ein paar Dinge, die sie verwirrten: Ein kleines Lederetui, in dem sich Plastikröhrchen mit einer Auswahl homöopathischer Globuli befanden, alle in englischer Sprache von Hand beschriftet, 500-mg-Kapseln der nichtessentiellen Aminosäure L-Tyrosin, einer natürlichen Alternative zum chemischen Amphetamin, 500-mg-Magnesium-Kautabletten, ein Plastikdöschen mit deutschen Traumeel-Tabletten gegen Muskelschmerzen, ein Fläschchen Bachblüten »Emergency Rescue Remedy« für Schockzustände, Baldriankapseln und eine alkoholische Flüssigkeit, die sie vom Geruch her stark an traditionellen Franzbranntwein erinnerte. Der Soldat hatte offensichtlich kein allzu großes Vertrauen in die Schulmedizin. Aber er hatte auch ausreichend Munition in den Taschen, um den Dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen und sogar zwei kleine Portionen C4-Plastiksprengstoff. Die Sprengschnur fand Rossi neben einer Drahtschlinge, die man sowohl als Säge als auch als Mordwerkzeug verwenden konnte. Dazu schleppte er einen spektakulären Vorrat an Bonbons mit sich herum, der bei jedem deutschen Zahnarzt einen akuten Herzinfarkt ausgelöst hätte.
Mit ihren Schätzen war sie am Ende wild entschlossen zum Felsenversteck zurückgekrochen. Sie hatte zwar noch keine Idee, was sie tun konnte, aber sie hatte immerhin, neben Hahnemanns vollständiger homöopathischer Haus- und Reiseapotheke eine Waffe, Munition, etwas Verpflegung und ein bisschen Sprengstoff. Und außer dem gefangenen Special-Forces-Soldaten wusste niemand, dass sie existierte. Mit den vielen Kleidungsschichten ähnelte Rossi dem Michelin-Männchen »Bibendum«, aber ihr war wenigstens nicht kalt. Sie knabberte am Nougatriegel aus der Kampfration und beobachtete weiter. Sie war bereit, umgehend aufzubrechen, sobald die Typen unten in der Schlucht sich in Bewegung setzten. Vielleicht ergab sich ja eine Gelegenheit, an ihren Retter heranzukommen oder wenigstens herauszufinden, was die sonderbaren Typen mit ihm vorhatten. Immerhin hatten sie ihn am Leben gelassen und nicht einfach über den Haufen geschossen.
× × ×
Kérmorvan beschloss, sich auszuruhen und zu schlafen. Er war im Augenblick einfach zu müde und zu zerschlagen, um Fluchtpläne zu schmieden. Außerdem hatten sie ihn mit dünnen Kabelbindern gefesselt, und selbst für einen Mann wie ihn, dem man sorgsam alle nur erdenklichen Tricks beigebracht hatte, sich aus den übelsten Situationen zu befreien, war es fast unmöglich, diese Dinger loszuwerden. Je mehr man sich wehrte, desto fester zogen sie sich zusammen. O’Shaughnessy, der Anführer der Truppe, traute ihm nicht über den Weg. Der Brite beobachtete ihn, die entsicherte Waffe im Anschlag, wie ein Kaninchen die Schlange. Er gab dem Mann sogar recht. Er würde sich selbst auch nicht über den Weg trauen. Nachdem er allerdings noch am Leben und relativ unbeschädigt war, vermutete Kérmorvan, dass der eigentliche Plan darin bestand, ihn am nächsten Morgen zu diesem geheimnisvollen Camp im Hochtal zu schaffen, um ihn dann dort nach allen Regeln der Kunst auszuquetschen. Diese Aussicht begeisterte ihn nicht. Er hatte seine kleinen Schwächen, aber masochistische Tendenzen zählten nicht dazu. Andererseits war das vielleicht eine einzigartige Gelegenheit, diesen sonderbaren Ort und seine unorthodoxe Bevölkerung einmal genauer in Augenschein nehmen zu können. Er musste herausfinden, was in dem Hochtal wirklich vor sich ging.
Sie waren vor ein paar Tagen bei ihrer Suche nach den verschwundenen Kampf-Drohnen und Soldaten zufällig über den Ort gestolpert, der auf seiner Karte nicht verzeichnet war. Was sie dort beobachtet hatten, war zutiefst verwirrend. Kérmorvan selbst hatte es im ersten Moment überhaupt nicht wahrgenommen, aber zwei seiner Männer hatten schnell begriffen und ihn sozusagen mit der Nase darauf gestoßen. Er wusste, dass er gelegentlich betriebsblind sein konnte. Ihm fehlte das, was man kreative Fantasie nannte.
»Das sieht aus, wie eine archäologische Ausgrabung, Patron!«, hatte Durand ihm zugeflüstert.
LeGoff hatte dann auf eine kleine Gruppe gedeutet, die mit Pinseln und Bürsten eine Stele säuberten.
»Sehen Sie mal, Chef – die haben etwas wirklich Außergewöhnliches gefunden!«
Anschließend hatte Kérmorvan bemerkt, dass weite Teile des Hochtals mit Richtschnüren sorgfältig in regelmäßige Quadrate aufgeteilt waren. Einige dieser Segmente schienen bereits ausgegraben und aufgegeben, andere waren wohl noch in Arbeit. Eine Stelle war mit Kunststoff-Paneelen auf Trägern abgedeckt. Die Leute, die sie dort beobachteten, trugen zwar ganz eindeutig lokale Kleidung und waren bärtig, doch sie hatten auch moderne Schutzhelme auf den Köpfen und brandneu wirkendes Gerät in Händen. Alle arbeiteten geschickt und sehr professionell.
Das war kein Verein von Amateuren, die eine kleine Raubgrabung veranstalteten, um in einer Kampfpause den schnellen Dollar zu machen! Das Ganze erweckte vielmehr den Anschein, in großem Stil durchdacht und konsequent aufgezogen zu sein. Das Gelände erinnerte Kérmorvan an die großen Ausgrabungen von Gisacum in der Nähe von Évreux, wenn in der sommerlichen Grabungssaison sämtliche Experten der Universitäten von Caen, Rouen und Paris gleichzeitig aufschlugen. Er selbst trieb sich natürlich nicht nur aus Jux und Tollerei in Évreux herum, auch wenn er leidenschaftlich gerne die allerneuesten Entdeckungen von Gisacum bewunderte. Die alte Stadt in der Haute-Normandie beherbergte neben einer gut erhaltenen gallo-römischen Tempelanlage vor allem die Airbase 105. Die dort stationierten Flugzeuge und Helikopter gehörten dem Service Action der DGSE.
Beim Gedanken an Évreux und die dortigen Funde aus der Zeit der Eburoviken verstand Kérmorvan dann mit einem Mal: Gisacum wurde auf vierhundert Hektar geschätzt; zu groß, um alles zu sichern und zu überwachen. Es war ein gewaltiges Problem, zu verhindern, dass sich Hinz und Kunz an archäologischen Funden aus dem zweiten Jahrhundert vor der Zeitrechnung bedienten. Viele Jahre hatte man auf den lokalen Flohmärkten verhältnismäßig wertvolle Stücke finden können – Münzen, Schmuck und kleinere Statuen aus Bronze. Und dabei war Frankreich ein gut organisiertes Land im Frieden, mit einer Gesetzgebung, die jede Form von Raubarchäologie unter Strafe stellte, und einer rund zweihundert Mann starken Spezialeinheit der Polizei, die auf den Schutz von Kulturgütern spezialisiert war. Sogar gesetzestreue Bürger wie er selbst hatten unbefangen und ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen von der Unmöglichkeit der Überwachung profitiert. So hatte er auf einem Flohmarkt in Glos-la-Ferrière eine sehr gut erhaltene Statue der Reiter- und Pferdegottheit Epona gefunden, die inzwischen den Eingang zu den Pferdeställen auf dem Hof seiner Eltern zierte. Und wie ihm, ging es den anderen – die meisten dachten wohl gar nicht darüber nach, woher eine Antiquität stammte und ob sie legal oder illegal ausgegraben worden war. Er selbst hatte sich damals auch nicht gefragt, woher die hübsche Epona stammte, sondern sich einfach über den außergewöhnlichen Fund gefreut und dem Trödelhändler die Statue ohne groß zu verhandeln abgekauft. Die Leute sammelten munter drauf los. Das waren in der Regel keine echten, ernsthaften Sammler, sondern Geschichts-Freaks, Menschen, die von einer gewissen Ästhetik angesprochen wurden, oder auch solche, die einfach außergewöhnliche Dekorationsobjekte suchten – durchschnittliche Leute also. Und zu dieser unüberschaubaren Gruppe gesellten sich noch die Spezialisten, echte Sammler, Galeristen und Kuratoren von privat finanzierten und staatlichen Museumseinrichtungen weltweit! Der Markt war riesig, unübersichtlich und völlig unkontrollierbar. Und es ging um riesige Geldsummen.
Zuerst die ehemaligen russischen SpezNas in amerikanischer Hightech-Tarnkluft, dann ein Dutzend Amerikaner und ein Brite, genauso einheitlich uniformiert und ausgerüstet, die mit einem sündhaft teuren, französischen MANPADS einen MedEvac-Helikopter der ISAF abschießen. Diese zusammengewürfelte irreguläre Truppe operierte völlig ungestört mitten im Herzland der Hochburg eines der gewalttätigsten und skrupellosesten Kriegsherren der Taliban: Dadullah Khan. Hier musste etwas mehr auf dem Spiel stehen, als ein paar alte Tonscherben oder ein bisschen baktrischer Goldschmuck. Und was auf dem Spiel stand, war kein Rauschgift. Das war vielleicht die einzige echte Auffälligkeit dieser scheinbar völlig von den Taliban kontrollierten Gegend: Es gab hier keine Opiumfelder! Er hätte es eigentlich sofort selbst bemerken müssen. Keine Opiumfelder und relativer Wohlstand inmitten einer vom Krieg erschütterten Region! Das hätte ihnen zuvor längst auf den von den Drohnen übermittelten Aufnahmen auffallen müssen, aber niemand hatte es richtig wahrgenommen.
Betriebsblindheit, dachte Kérmorvan frustriert, das war echte Betriebsblindheit, und jetzt bekommst du die Rechnung präsentiert.
Er überlegte kurz, ob O’Shaughnessy und sein wilder Haufen ihm den ganzen Schwachsinn abgekauft hatten, den er ihnen da gerade aufgetischt hatte. Er konnte sich um Kopf und Kragen geredet haben, aber er wusste auch, dass er keine andere Wahl hatte. Die Sache musste nun durchgezogen werden. Kein Grund zur Panik. Das Gespräch mit seinen Häschern lief immer noch ganz gut!
Die kräftig gebauten Kerle, die ihn geschnappt hatten, waren natürlich alle muskulös und körperlich in Bestform. Wenn er sich mit seinen eigenen lausigen fünfundsechzig Kilo bei 1,85 Metern im Spiegel betrachtete, gruselte ihn regelmäßig. Irgendwie rekrutierten die Amerikaner und Angelsachsen andere Typen von Männern für ihre Spezialeinheiten als die Franzosen. Aber diese Schwachköpfe verhielten sich nicht besonders professionell. Es mangelte ihnen sichtbar an militärischer Disziplin und sie spielten sich auf wie andalusische Zwerghühner! Seine Eltern hielten die seltene Rasse seit ein paar Jahren zur Dekoration auf ihrem Bauernhof bei Dol in der Bretagne. Bildhübsche Tiere, aber schrecklich von sich eingenommen. Dabei legten sie höchstens drei mickrige Eier pro Woche.
Die Muskelmänner, die sich an Kérmorvan zu schaffen machten, redeten etwas viel. Er hatte im Verlauf der letzten Stunden mehr über den ganzen wilden Verein erfahren, als sie über ihn – und dabei war doch er es, der die Prügel bezogen hatte.
O’Shaughnessy war dem Akzent nach zu urteilen ein typischer Brite der Unterschicht aus irgendeinem schmuddeligen Housing Estate im Norden Englands. Alle anderen waren klassische Ausschussware der US-Streitkräfte aus dem »poverty belt« und dem »farm belt« im Mittleren Westen: waschechte »rednecks«, stereotypischer »white trash«, der ihm umgehend Dorothy Allisons Roman Bastards Out of Carolina in Erinnerung rief. Und passend zu ihren lächerlichen Macho-Allüren hatten sie auch noch die einschlägigen geschmacklosen Tätowierungen auf den Armen. Ehemalige Fallschirmjäger, Ranger, Marines: Kérmorvan kannte diesen Typ von Freelance-Kämpfern. Überall auf der Welt waren sie vom gleichen Schlag.
Mehrheitlich stammten sie aus dem angelsächsischen Kulturkreis. Sie quittierten den regulären Dienst, weil es ihnen dort entweder zu bürokratisch zuging oder weil sie nicht genug verdienten. Andere waren wegen irgendeiner Verfehlung an die frische Luft gesetzt worden. Wieder andere hatten am Ende ihrer Dienstzeit nicht verlängert und die reguläre Armee lediglich als Ausbildungscamp für eine lukrative und abwechslungsreiche Karriere in der boomenden, militärischen Privatwirtschaft betrachtet. Diese Söldnertypen kotzten ihn an, und wer sie ganz besonders gerne für miese Drecksarbeit benutzte, waren die staatlichen, amerikanischen Stellen: die unzähligen US-Geheimdienste oder das Pentagon.
Die Tatsache, dass sie sich seit dem zweiten Golfkrieg 1990-1991 hinter organisierten Strukturen verbargen, die man Private Military Companies oder PMCs nannte, änderte allerdings auch nichts daran, dass sie für Geld kämpften und sich ohne tiefe innere Überzeugung verkauften. Die absolute Mehrheit der PMCs waren traditionell Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Südafrika. Die Gesetzgebung in diesen Ländern erlaubte es, Krieg ganz offen als Dienstleistung anzubieten. Diese Firmen waren lediglich an ihre Verträge gebunden und arbeiteten in einer Grauzone des Kriegsvölkerrechts, das für reguläre Truppen bindend war. Im Irak entwickelten sie sich zu einer Landplage fast schon biblischen Ausmaßes: Wie hungrige Heuschrecken fraßen sie sich an den lukrativen Aufträgen des US Department of Defense satt. Die Übergänge zwischen der Ausübung staatlicher Gewalt und wildwütiger Freibeuterei wurden dabei immer fließender. Afghanistan war diesbezüglich zu einem ebenso einträglichen Spielplatz geworden wie die Gegend zwischen Euphrat und Tigris.
Als er sich vor vierzehn Tagen unten in Spin Boldak diskret und unter der Hand sechs zuverlässige und kampferprobte Männer aus dem 1. Fallschirmjäger-Regiment der Marineinfanterie, dem 1er RPIMa, bei seinem alten Kumpel Major Thierry Sénéchal ausgeborgt hatte, um mit ihnen seine eigenen, geheimdienstlichen Zwecke zu verfolgen, ohne gleich die Aufmerksamkeit von NATO und Amerikanern auf sich zu ziehen, hatte er natürlich mit jeder Menge Ärger gerechnet, aber nicht mit dieser bösen Überraschung. Die Jungs aus dem 1er RPIMa waren offiziell und auf dem Papier für das CENTCOM in Bagram lediglich auf einer gewöhnlichen Standard-Patrouille unterwegs gewesen. Natürlich heuerten etablierte, terroristische Organisationen immer wieder gerne unabhängige Dienstleister zur taktisch-operativen Beratung an. Das war nichts Neues. Schon seit den Tagen des Untergangs des Dritten Reiches kommerzialisierten Ehemalige der etablierten Geheimdienste, den Regeln der Marktwirtschaft folgend, ihre gesammelten Erfahrungen und Kompetenzen. Diskret und gegen harte Dollar oder Euro boten sie Know-how im Bereich operative Sicherheit an, bildeten im geheimdienstlichen Handwerk aus, oder leisteten technische und logistische Unterstützung bei vielerlei Operationen. Manche arbeiteten auch für Wirtschaftsunternehmen und nannten sich bescheiden »Sicherheitsberater«, andere für klassische kriminelle Organisationen und wieder andere verkauften ihre Dienstleistungen meistbietend den staatlichen Geheimdiensten selbst, sozusagen als Unterauftragnehmer. Auch sein eigener Dienst hatte vor ein paar Jahren mit der Firma Alyzée ein kommerzielles Outlet eingerichtet. Diese Equipe bot frankofonen Ländern und großen, europäischen Firmen, die in Krisengebieten arbeiteten, eine qualitativ hochwertige, kostenpflichtige Kriegsdienstleistung an. Damit entlasteten sie »Offizielle«, wie ihn selbst, damit diese sich aufs Wesentliche konzentrieren konnten. Allerdings machten sein Ex-Kollege Olivier Patrick und die Jungs von Alyzée keinen großen Unfug, sondern gingen brav dorthin, wo es den Auftraggebern im Élysée oder am Quai d’Orsay nützlich schien.
Was Kérmorvan hier vor sich sitzen sah, war jedoch eine Neuerung: eine unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten geschmiedete Allianz zwischen einer Talibangruppe und einer Söldnertruppe, in der sich sowohl Russen als auch Angelsachsen befanden. Die Taliban kauften eigentlich kein externes Know-how ein, da sie seit vielen Jahre Gratisberatung und taktische Unterstützung vom pakistanischen Geheimdienst bekamen. Dessen Service war zwar nicht erstklassig, aber dafür billig und leicht verfügbar.
Natürlich arbeiteten Söldner und militärische Dienstleister nicht umsonst. Bei einem durchschnittlichen Tagessatz zwischen sechshundert und achthundert steuerfreien US-Dollar pro Mann war allein die Tracht Prügel, die Kérmorvan am Spätnachmittag bezogen hatte, knapp zehntausend US-Dollar wert – ein stolzer Preis für ein paar blaue Flecken! Er schloss die Augen und drehte den Kopf zur Seite. Er musste erst einmal ganz in Ruhe nachdenken, diese Geschichte verdauen und sich die Karten legen. Die Story, dass er Arzt war und zum Rettungsteam gehört hatte, würde er den Söldnern, die ihn geschnappt hatten, problemlos weitererzählen können.
Kérmorvans Mutter war Hebamme, und er hatte aufgrund dieser familiären Prädisposition schon bei den Spezialeinheiten der Marine und im Commando de Penfentenyo immer als Notfall-Sani herhalten müssen. Jeder Pierre, Paul und Jacques seiner Hierarchie war felsenfest davon überzeugt gewesen, dass er als Bauernsohn für diese unappetitliche Special-Forces-Combat-Medic-Ausbildung geschaffen war, nur, weil er bereits vor dem ersten Kurs gewusst hatte, wie man Fohlen und Kälber im Bauch der Mutter umdrehte, Katzen- oder Hundewelpen auf die Welt holte, Weideverletzungen bei Nutztieren versorgte und beschädigte Pferdebeine sauber bandagierte. Am Ende hatte er es nicht bereut. Es war gar nicht schlecht, wenn man sich in seinem Job etwas besser mit medizinischen Dingen auskannte. Abgesehen von einer Reihe Kameraden, die Kérmorvan ihr Leben oder ihre weiter bestehende Einsatzfähigkeit verdankten, hatte er sich selbst auch schon mehrfach zusammengeflickt.
Seine Story vom Militärarzt, die er den Contractors, die ihn verhörten, aufgetischt hatte, war also glaubhaft. Zum Glück war er trotz der robusten Behandlung, die ihm zuteilwurde, noch in guter körperlicher Verfassung. Seine Kampfmoral hatte nicht gelitten und er wollte irgendetwas Greifbares über diesen mysteriösen Ort in Erfahrung bringen, bevor er sich auf den Heimweg nach Frankreich machte.
Sowohl die verschwundenen Soldaten als auch die EADS-Drohnen, und schließlich seine Gruppe aus dem 1er RPIMa, sie alle waren wohl diesem abgeschirmten Ort hoch oben in den Großen-Suleiman-Bergen und seinem marktwirtschaftlichen Anreiz zu nahegekommen. Der »marktwirtschaftliche Anreiz«, der die Geschäftsgrundlage zwischen den Taliban der Gegend und diesen Söldnern darstellte, war außergewöhnlich attraktiv. Sie buddelten in dem Hochtal, das er mit den Männern aus dem 1er RPIMa zufällig entdeckt hatte, gemeinsam nach Antiquitäten für den grauen und schwarzen Markt.
Das Thema Blutantiquitäten war so alt wie der Krieg und die Kulturgüter selbst. Zwar gab es in der Mehrheit der Länder der Welt inzwischen Gesetze, die entsprechende Plünderungen und Raubzüge verhindern sollten, doch das Problem wurde damit nicht beseitigt. Genauso wenig, wie das Problem der Blutdiamanten oder das der Konfliktrohstoffe. Kérmorvan hatte irgendwo einmal gelesen, dass der Handel mit geraubten Altertümern aus Kriegsgebieten sich zu einem Milliardengeschäft entwickelte und nur noch vom Menschen- und Rauschgifthandel übertroffen wurde. Diverse Terrorgruppen finanzierten sich inzwischen zu einem großen Teil aus dem Verkauf antiker Artefakte. Sammler weltweit zahlten bereitwillig hohe Summen und finanzieren so den internationalen Terrorismus.
Diese Summen ließen sich kaum nachverfolgen, denn Verkäufe von gestohlenem Kulturerbe gingen auf verschlungenen Pfaden auch an seriöse Institutionen wie Museen oder Galerien. Damit wurde viel schwarzes Geld blütenweiß gewaschen. Für Terroristen auf allen Kontinenten waren Antiquitäten eine sichere Quelle für die Finanzierung ihrer Untaten geworden. Jeder neue Krieg, jeder neue Konflikt, die zahllosen »Failed States«, gescheiterten Staaten: In diesem Sumpf war es einfach für Terroristengruppen, das Business weiterzuentwickeln und auszubauen.
»Und für die verdammten Amerikaner!«, ging es Kérmorvan durch den Kopf. Jetzt, wo er konzentriert über das Thema nach- dachte, kamen auch die Erinnerungen zurück. Er hatte bereits während früherer Einsätze solche Zwischenfälle beobachtet. An drei, die mit dieser Thematik der Blutantiquitäten im Zusammenhang standen, konnte er sich besonders gut erinnern.
Möglicherweise waren die mysteriösen Vorfälle, deren Zeuge und Opfer Kérmorvan in diesem Moment war, weitaus weniger mysteriös als er zuvor geglaubt hatte. Doch in den letzten Monaten waren hier viel zu viele Männer einfach spurlos verschwunden. Die unwegsame Gebirgsregion zwischen Qalat-i-Ghilzai und den westlichen Suleiman-Bergen im Distrikt Shinkay an der Grenze zu Pakistan und der afghanischen Provinz Kandahār ähnelte dem Bermuda-Dreieck. Allein seit Anfang des Jahres hatten sie in dieser Gegend acht französische Special-Forces-Soldaten aus Fernspähereinheiten verloren: vier vom 13. Régiment de Dragons Parachutistes – 13ème RDP – und vier weitere aus seiner ehemaligen Truppe, dem Commando de Penfentenyo. Allerdings waren es erst die beiden spurlos verschwundenen experimentellen Hunter-Killer-Drohnen von EADS gewesen, die die Aufmerksamkeit seiner Chefin Madame le Juge erweckt hatten.
Madame le Juge wurde für gewöhnlich nicht schnell nervös. Die acht Spezialeinsatzkräfte des Commandement des Opérations Spéciales, die verloren gegangen waren, hatte sie elegant damit wegargumentiert, dass dieses Grenzland der autonomen Stammesgebiete eben eine unglaublich gefährliche Gegend war, und Special Forces im Allgemeinen eben einem unglaublich gefährlichen Geschäft nachgingen. Sie hätte alles am liebsten Dadullah Khan, dem Ober-Taliban der Gegend, und seiner international anerkannten Lust am Köpfen und Massakrieren in die Schuhe geschoben, wenn da nicht die beiden Drohnen gewesen wären. Die Dinger hatten sich, genau wie die Special Forces aus dem COS, mit einem Streich in Luft aufgelöst. Gerade noch übermittelte der Hunter ihres allwetterfähigen Drohnen-Paares wunderbar klare und präzise, wenn auch nur beschränkt interessante Bilder aus einer diskreten Flughöhe, während ihn sein Killer-Freund treu begleitete, um im entsprechenden Augenblick zu tun, was Killer-Drohnen eben tun. Und plötzlich – pouff! – war der Bildschirm schwarz, wobei nicht nur eine Drohne verschwand, sondern gleich beide! Radiofrequenz-Jamming im Breitband war allerdings keine Spezialität der Taliban, genauso wenig, wie das sogenannte »signal spoofing«. Damit konnte man Drohnen überzeugen, Dinge zu tun, die der fernsteuernde Pilot in seinem weit entfernten Kommandoposten nicht tun wollte. Aber das war genauso kompliziert wie das Jamming. Man brauchte nicht nur entsprechendes Equipment, sondern auch sehr gut ausgebildete Experten, die wussten, wie es funktionierte, und darüber hinaus Informationen, die man sich nicht einfach so im Internet herunterladen konnte. Die Taliban hatten es trotz pakistanischer Hilfe nicht einmal geschafft, erbeutete sowjetische Hubschrauber flugfähig zu machen.
Um Drohnen vom Himmel zu pusten, brauchte man auch ein bisschen mehr als eine uralte Panzerfaust aus sowjetischer Massenproduktion. Selbst mit der berüchtigten amerikanischen Stinger-Luftabwehrrakete klappte es nicht so einfach, zwei Luftfahrzeuge auf einen Streich zu erwischen. Dafür waren ihre Drohnen mit knapp fünftausend Metern auch fast schon zu hoch geflogen. Kérmorvan seufzte leise. Es musste sich hier um ein außergewöhnlich einträgliches Geschäft handeln, an dem viele Leute aus der Gegend mitverdienten? Sie alle waren daran interessiert, die OEF und die ISAF auf Abstand zu halten. Für Dadullah Khan war dieses einträgliche Geschäft wahrscheinlich gleichzeitig eine Art Lebensversicherung, denn sein Kopf war den Amerikanern bereist fünfhunderttausend US-Dollar wert. Das war hier in der Gegend eine Menge Geld und eine große Versuchung für potenzielle Verräter. Dank dem guten Geld, das er aus den Einkünften der Blutantiquitäten wahrscheinlich verteilte, war gefährlicher Verrat weniger attraktiv, als ungefährliches regelmäßiges Abkassieren.
Es musste sich gleichzeitig um ein streng geheimes Geschäft handeln, denn normalerweise hätte Dadullah die Gefangennahme von Mitgliedern westlicher Special Forces in den Medien ausgeschlachtet und mit der Veröffentlichung einer Reihe blutrünstiger Videos auf YouTube und Dailymotion gefeiert.
Natürlich war es möglich, dass eine geheime Ausgrabungsstätte in den Bergen wesentlich mehr einbrachte als das Kopfgeld für Dadullah – vor allem dann, wenn in diesem Hochtal nicht nur außergewöhnliche Stücke zu Tage gefördert wurden, sondern auch gute, kommerzielle Sachen, die unauffällig genug waren, um durch die Auktionshäuser der Welt zu gehen oder in den Vitrinen von Antiquitätenhändlern aufzutauchen. Eine Million Dollar oder Euro mit Antiquitäten – das war schnell erreicht.
Kérmorvan ging in seiner freien Zeit selbst gerne zu Versteigerungen. Vor allem die großen Themenauktionen im berühmten Pariser Hôtel Drouot im IX. Arrondissement waren oftmals interessanter und abwechslungsreicher als jeder klassische Museums- besuch. Natürlich gestattete ihm sein Sold, obwohl der durch sein Dienstalter, diverse Gefahrenzulagen des Service Action sowie seine OPEX-Bezüge für Auslandseinsätze weit über dem Sold eines gewöhnlichen Fregattenkapitäns der französischen Kriegsmarine lag, nicht, einem solch exotischen Hobby zu frönen wie dem gezielten Sammeln wertvoller Antiquitäten. Aber das Thema interessierte ihn, und gelegentlich fand sich inmitten einer spektakulären Auktion eben auch eine interessante historische Reisebeschreibung aus dem Orient, alte Landkarten oder kleine Aquarelle von Orientalisten aus dem neunzehnten Jahrhundert, die weder die professionellen Einkäufer der Museen, noch die großen Privatsammlungen interessierten. Die Wochenzeitschrift La Gazette Drouot veröffentlichte die Preise, die im Rahmen der Auktionen erzielt wurden. Kérmorvan erinnerte sich, einmal gelesen zu haben, dass ein klassisches Isis-Amulett aus dem Ägypten der achtzehnten bis zwanzigsten Dynastie zwischen zehntausend und fünfzehntausend Euro einbrachte. Das war schon ein bisschen Geld, vor allem, wenn man sich vor Augen führte, wie einfach sich ein solch kleines und recht unscheinbares Amulett transportieren ließ. Und kein Flughafensicherheitssystem reagierte, kein gut ausgebildeter Polizeihund schlug lautstark an. Selbst der Zoll wusste meist nicht, ob ein Amulett echt war, oder nur eine billige Kopie für Touristen. Dazu brauchten die Zöllner meist erst einen Spezialisten, der von einer Uni oder aus einem Museum geholt werden musste und außerdem noch Geld für seine Dienstleistungen als Berater einforderte.
Kérmorvan konnte sich durchaus vorstellen, dass Dadullah in einem Geschäft mit illegalen Ausgrabungen und Antiquitäten etwas zu sehen vermochte, das vielen anderen Taliban aufgrund ihrer rückständigen Einstellung zum Leben entging. Im Gegensatz zu seinem weltfremden, scheuen und zurückhaltenden Chef Mullah Omar war der Warlord, der in der Provinz Zabul sein Unwesen trieb, ein echter Showman, der Auftritte vor laufender Kamera liebte. Dadullah akzeptierte sogar immer wieder Telefoninterviews mit Vertretern der westlichen Presse oder kontaktierte selbst Redakteure. Er war bereit gewesen, über mehrere Wochen mit einem bekannten pakistanisch-amerikanischen Sachbuchautor zusammenzuarbeiten, der ein Werk über die sowjetische Invasion Afghanistans schrieb, und hatte sich dabei als geopolitisch wohlinformiert erwiesen. Und im Gegensatz zu vielen anderen hochrangigen Taliban sprach der Mann ganz ausgezeichnetes Englisch. Sie wussten auch, dass er zu verschiedenen Grundsatzfragen, die das Gros seiner Gruppierung als obskurantistische Steinzeit-Islamisten erscheinen ließ, erstaunlicherweise sehr liberal eingestellt war. Sie wussten, dass er Anfang der Achtzigerjahre sogar mehrfach ins Ausland gereist war; unter anderem nach Großbritannien und in die USA. Während des sowjetischen Krieges in Afghanistan war er ihnen nie ins Auge gesprungen, was auch daran gelegen haben mochte, dass er damals zu keiner der radikal-islamischen Gruppierungen gehört hatte, sondern mit seinen Gefolgsleuten für Sibghatullah Mojaddedis Nationale Befreiungsfront, die Dschabha-yi Nidschāt, gekämpft hatte. Kérmorvan hatte es immer als sonderbar empfunden, dass ausgerechnet dieser weltoffene Mann, der gereist war und offensichtlich auch über eine gute Bildung verfügte, sich am Ende einer so reaktionären Gruppierung wie den Taliban angeschlossen hatte.
Genau aus diesem Grund war Kérmorvan jetzt auch wild entschlossen, herausfinden, was hier wirklich ablief und wer hinter den russischen und den angelsächsischen Söldnern steckte, die mit dem berüchtigten Taliban-Warlord gemeinsame Sache machten. Er wusste, dass er dabei sehr vorsichtig sein musste und nicht seiner üblichen Paranoia anheimfallen durfte, hinter jedem Baum und Strauch gleich die schmutzigen Hände der intriganten amerikanischen Geheimdienste zu sehen. Seine Chefin wollte wissen, was mit ihrem experimentellen Hunter-Killer-Drohnenpaar passiert war, und als Offizier und Ehrenmann schuldete er den Familien der sechs toten Special-Forces-Soldaten, die ihn begleitet hatten, die Wahrheit. Die Wahrheit um jeden Preis.
Kérmorvan hoffte, dass die niedliche Bundeswehrärztin seinen kurzen Wink verstanden und sich umgehend aus dem Staub gemacht hatte. Dies hier war weder ihr Kampf noch ihr Krieg. Seitdem er sie in dem Black-Hawk-MedEvac wahrgenommen hatte, fühlte sich ein Teil von ihm schuldig, weil er die Kleine und ihre Kollegen von der ISAF Medical Task Force Kandahār herbeigefunkt hatte, ohne den Ärzten ehrlich zu sagen, welche Gefahren sie vor Ort erwarteten.