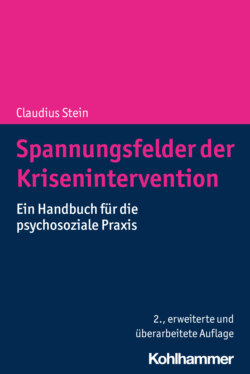Читать книгу Spannungsfelder der Krisenintervention - Claudius Stein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Kurze Geschichte der Krisenintervention
ОглавлениеWenn wir uns die Frage nach den Wurzeln der Kriseninterventionsarbeit stellen, so lassen sich im Wesentlichen fünf Entwicklungstendenzen finden, auf denen die aktuelle Theorie und Praxis aufbaut. Diese werden in einem kurzen historischen Rückblick dargestellt.
Die ersten beiden Entwicklungslinien finden sich in der theoretischen und praktischen Beschäftigung mit akuten Traumatisierungen und den Folgen schwerwiegender Verluste ( Kap. 3.1 und Kap. 3.4.2). Dementsprechend sind heute die Begriffe Trauer und Traumatisierung eng mit Konzepten zum theoretischen Verständnis von Krisen und Krisenintervention verknüpft. Eric Lindemann (1944), der 1942 nach der Brandkatastrophe von Coconut-Grove, bei der 140 Menschen in einem Tanzlokal umkamen, Hinterbliebene und Überlebende betreut und untersucht hat, kann diesbezüglich als einer der Pioniere gelten. Seine dabei gewonnenen Erfahrungen ließen ihn zu der Überzeugung gelangen, dass Menschen, die von derart schwerwiegenden Belastungen betroffen werden, unbedingt ein gezieltes psychiatrisches, psychologisches oder psychotherapeutisches Hilfsangebot benötigen. Gerald Caplan (1964) entwickelte diese Ansätze in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts weiter. Sein sozialpsychiatrisch-präventiver Ansatz zielte vor allen Dingen auf die Vermeidung unnötiger psychiatrischer Krankenhausaufenthalte ab. Auf der Basis ihrer Erfahrungen vertraten Lindemann und Caplan die Auffassung, dass im Sinne sekundärer Prävention Krisen möglichst frühzeitig bearbeitet werden sollten, und gründeten folgerichtig das erste Community Crisis Center.
Erik H. Erikson stellte in seinem 1959 erschienenen Buch »Identity and the Life Cycle« (deutsch: Identität und Lebenszyklus 1966) sein Konzept der Entwicklungskrise vor, das sich vorwiegend mit der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung des Individuums beschäftigt. Erikson stellt fest, dass jeder Mensch während seines Lebens bestimmte kritische Phasen durchlebt, in denen er mit existenziellen, neuen Aufgaben konfrontiert wird. Nur eine erfolgreiche Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben ermöglicht Reifung und Wachstum ( Kap. 3.3.1).
Da Suizidalität neben Gewalthandlungen die dramatischste Zuspitzung von Krisen darstellt, waren Konzepte zur Suizidprävention von Beginn an eng mit denen der Krisenintervention verknüpft, wobei Einrichtungen zur Suizidprophylaxe lange vor den ersten Kriseninterventionszentren gegründet wurden. Diese wurden zunächst von nichtärztlichen, karitativen Einrichtungen betrieben. Die erste Telefonseelsorge entstand 1895 in London. 1906 richtete die Heilsarmee in London eine Stelle zur »Selbstmordbekämpfung« ein. In den USA gilt der New Yorker Pfarrer Warren als der erste, der zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts einen Notruf für Suizidgefährdete gründete. 1927 wurden in Wien vom Fürsorgeamt der Wiener Polizeidirektion Maßnahmen für Menschen nach einem Suizidversuch entwickelt. Der Philanthrop Wilhelm Börner, Leiter der »Ethischen Gemeinde«, gründete kurz darauf ebenda eine Lebensmüdenstelle mit 60 ehrenamtlichen Mitgliedern (u. a. Viktor E. Frankl). Diese war Vorbild für ähnliche Einrichtungen in mehreren Ländern Mitteleuropas (Sonneck et al. 2008). 1938 verboten die Nationalsozialisten nach dem Anschluss Österreichs die Tätigkeit der Lebensmüdenstelle. In dieser Zeit galt der »Selbstmord« als »gesunder Reinigungsprozess des Volkes von minderwertigen Elementen«. Anstrengungen zur Suizidverhütung waren somit unerwünscht.
Erst 10 Jahre später (1948) wurde im Rahmen der Caritas der Erzdiözese Wien von Erwin Ringel wieder ein Selbstmordverhütungszentrum – »die Lebensmüdenfürsorge« – gegründet, die es sich zur Aufgabe machte, Personen nach einem Suizidversuch und Hinterbliebene von Menschen, die sich suizidiert hatten, zu betreuen. Ähnliche Einrichtungen folgten in ganz Europa. Chad Varah gründete 1953 in London »The Samaritans«, eine Organisation, die bis heute Suizidgefährdete telefonisch und persönlich unterstützt. In Deutschland richtete Pater Leppich 1954 eine telefonische Seelsorge in Nürnberg ein, deren Angebot auch für selbstmordgefährdete Personen gedacht war. 1956 wurde die ärztliche Lebensmüdenfürsorge Berlin (Klaus Thomas) gegründet und nach deren Vorbild in weiteren deutschen Städten telefonische Seelsorgedienste. In den USA entstand 1958 auf Initiative von N.S. Farberow das erste Suicide Prevention Centre in Los Angeles (Sonneck 2008).
Allmählich setzte sich die Erkenntnis durch, dass isolierte Suizidprävention zu kurz greift. Krisen stellen häufig Situationen dar, in denen Menschen aufgrund der emotionalen Zuspitzung suizidal werden. Somit war es naheliegend, Konzepte der Suizidprävention mit denen der Krisenintervention zu verbinden. Aus der Lebensmüdenvorsorge Wien ging das Kriseninterventionszentrum Wien (KIZ) hervor, eine der ersten derartigen Institutionen in Europa. Auch dieses verstand sich zunächst als Einrichtung, die ihre zentrale Aufgabe in der Suizidprävention bzw. der Nachbetreuung von Menschen nach Suizidversuchen sah. Erst nach und nach entwickelte sich daraus ein umfassenderes Verständnis von Krisenintervention mit einem präventiven psychotherapeutischen Ansatz.
Schließlich hat auch die sozialpsychiatrische Reformbewegung der 1970er Jahre wesentlich zur Entstehung der ersten Kriseninterventionszentren im deutschsprachigen Raum beigetragen. Das Verständnis, dass psychische Krisen eine zentrale Bedeutung bei der Entstehung psychischer Störungen haben, bzw. deren Verlauf beeinflussen, erforderte therapeutische Konzepte abseits der gängigen psychiatrischen Versorgungseinrichtungen, um durch rechtzeitige Intervention präventiv handeln zu können. Dies führte daher zur Gründung von Institutionen, die zwar eng mit ambulanten und stationären Einrichtungen der Psychiatrie vernetzt sind, aber aufgrund ihrer organisatorischen Unabhängigkeit ein niedrigschwelliges Angebot für jene Betroffenen darstellen, die nicht primär psychiatrischer Hilfe bedürfen. Die Abgrenzung von Krisenintervention und Notfallpsychiatrie bleibt allerdings ein bis heute noch nicht ganz befriedigend gelöstes sowohl theoretisches als auch behandlungsrelevantes Problem. Damit ist auch die Frage verbunden, ob eine Krise in gleicher Weise Folge innerer wie auch äußerer Belastungen sein kann. Die klassische Krisendefinition sieht primär äußere Belastungen als krisenauslösend an und schließt somit psychische Krankheit explizit als Krisenanlass aus. Gleichwohl ist die innere Reaktionsbereitschaft des Betroffenen von entscheidender Bedeutung dafür, ob eine Krise entsteht und welchen Verlauf sie nimmt. Klinische Erfahrungen zeigen, dass es zwar nicht immer einfach, aber dennoch sinnvoll ist, Krisenintervention und Notfallintervention auseinanderzuhalten, da die erforderlichen Interventionsstrategien deutlich voneinander abweichen ( Kap. 3.3.5). Klarerweise gibt es viele Überschneidungen. Krisen können eskalieren und sich zu Notfällen entwickeln und umgekehrt können psychiatrische Notfälle und ihre Folgen psychosoziale Krisen auslösen. Es ist wichtig, dass leidende Menschen im Sinne präziser Indikationsstellung die jeweils richtige, für sie passende Hilfe erhalten. Gleichzeitig ist aber eine enge Kooperation der mit diesen Aufgaben befassten Institutionen unerlässlich.
Tab. 1.1: Wurzeln der Krisenintervention
Seit den 1970er Jahren haben sich im deutschsprachigen Raum erfreulicherweise in vielen Großstädten sowohl Kriseninterventionseinrichtungen wie auch rund um die Uhr erreichbare psychiatrische Notdienste als fixe Bestandteile psychosozialer Versorgungsnetze etabliert. In diesem Buch wird in weiterer Folge wiederholt Bezug auf diese fünf Entwicklungslinien genommen ( Tab. 1.1).