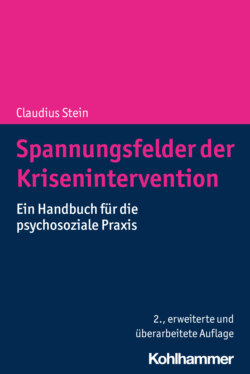Читать книгу Spannungsfelder der Krisenintervention - Claudius Stein - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Einführung und Krisendefinition
Оглавление»Warum fallen wir? – Damit wir lernen können, uns wieder aufzurichten« (»Batman begins«, Christopher Nolan 2005)
Krisen gehören selbstverständlich zum Leben. Jeder Mensch kann in jeder Lebensphase und in jedem Lebensalter von außergewöhnlichen Belastungen betroffen sein, die wesentliche Lebensziele in Frage stellen. Es kann sein, dass man nahestehende Personen durch Trennungen oder Tod verliert, dass man ernsthaft erkrankt oder seinen Arbeitsplatz verliert. Man muss sich den unausweichlichen Veränderungen des Lebens stellen und ist dazu manchmal besser und manchmal schlechter in der Lage. Belastungen und Herausforderungen führen nicht notwendigerweise zu Krisen. Erst der Verlust der inneren Überzeugung, dass die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen ausreichen, um mit dem Problem in adäquater Weise umgehen zu können, lässt die Situation subjektiv so bedrohlich werden, dass es zu einer massiven innerpsychischen und sozialen Destabilisierung kommt. Dieses vorübergehende Ungleichgewicht zwischen äußeren belastenden Ereignissen oder Lebensumständen und den individuellen Problemlösungsstrategien und Ressourcen ist das zentrale Element der Krisenentstehung und führt in der Folge zu all den unangenehmen Gefühlen und Symptomen, die so charakteristisch für Krisen sind: Angst, Überforderung, Spannung, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Der Betroffene hat den Eindruck, das eigene Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Man kann nicht schlafen, nicht essen, weiß weder ein noch aus, fühlt sich blockiert und antriebslos oder verfällt in hektische Betriebsamkeit. Viktor von Weizsäcker (1940) beschreibt die Krise als eine Unterbrechung der Ordnung. Die Fundamente werden erschüttert und das Selbstwertgefühl und Identitätserleben sind in Frage gestellt. Das normale psychische Funktionsniveau kann erheblich beeinträchtigt sein. Alle Lebensinhalte, die nicht mit der Krise zu tun haben, treten in den Hintergrund.
Eine psychosoziale Krise ist zeitlich begrenzt. Alle relevanten Theorien und die daraus abgeleiteten Interventionsstrategien gehen von einem Zeitraum von einigen Wochen bis maximal drei Monaten aus (z. B. Lindemann 1944, Jacobson 1974, Ulich 1987, Sonneck 2012, Kap. 5.1.3). Dies lässt sich so erklären, dass niemand einen derartigen emotionalen Ausnahmezustand und den massiven inneren und äußeren Druck über einen längeren Zeitraum ertragen kann. Betroffene unternehmen größte Anstrengungen, um diesen Zustand zu beenden und wieder ihr Gleichgewicht zu finden.
Wie man versucht, mit der Erschütterung umzugehen, stellt wichtige Weichen für die Zukunft. Die Bewältigungsstrategien, die dabei eingesetzt werden, können konstruktiv wie destruktiv sein. Oft ist die Bereitschaft, sich Unterstützung zu holen, Hilfe anzunehmen, über die Probleme zu sprechen und Neues auszuprobieren, hoch. Eine konstruktive Bewältigung stellt einen wichtigen Reifungsschritt dar, der den Betroffenen auch für spätere Anforderungen im Leben stärken kann. Man hat gelernt, »sich wiederaufzurichten«. Scheitern aber die Bewältigungsversuche oder überwiegen schädigende Copingstrategien, kann die Krise zum Auslöser für psychische und psychosomatische Störungen werden und so chronifizieren. »Man bleibt liegen, statt sich wieder aufzurichten.«Im schlimmsten Fall stellt sich ein Gefühl von Hoffnungs- und Aussichtslosigkeit ein und es kommt zu katastrophalen Zuspitzungen, suizidalen Entwicklungen oder Gewalthandlungen, die den Betroffenen unter Umständen noch »tiefer fallen lassen«.
Krisen stellen also gleichzeitig eine Gefahr und eine Chance für das Individuum dar. Die Dringlichkeit und Zuspitzung, die einerseits besonders unangenehm und bedrohlich ist, birgt auch die besondere Chance zur Veränderung. Ein sehr treffendes Symbol für diese Doppelgesichtigkeit ist der chinesische Begriff für Krise, der sich aus zwei Schriftzeichen Wei und Ji zusammensetzt. Wei steht für Gefahr, Ji für Chance ( Abb. 2.1).
Abb. 2.1: Chinesisches Schriftzeichen für »Krise«
Das Wort krisis stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet Wende, Höhepunkt, Umschlagpunkt oder Entscheidung. Genau genommen ist es der richtungsweisende Wendepunkt in einem Entscheidungsprozess.
In der somatischen Medizin beschreibt der Begriff den Wendepunkt im Verlauf einer Krankheit, an dem sich entscheidet, ob es zur Heilung oder zur Verschlechterung des Zustands kommt. Es handelt sich dabei um ein besonders heftiges, anfallsartiges Auftreten von Krankheitszeichen mit ungewissem Ausgang.
Eine psychosoziale Krise ist somit nicht primär ein pathologisches Geschehen, wenn sie auch Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Fehlentwicklungen sein kann. Folglich findet sich der Begriff auch nicht in den gebräuchlichen psychiatrischen Diagnosemanualen ( Kap. 2.5). Natürlich treffen Krisen häufiger Menschen, die generell Schwierigkeiten haben, ihr Leben zufriedenstellend zu meistern, z. B. jene, die etwa durch psychische Störungen oder soziale Benachteiligung vorbelastet und daher verletzbarer sind. Aber auch Menschen, die üblicherweise gut mit sich und ihrer Umwelt zurechtkommen, können durch eine entsprechende Belastung in einen psychischen Ausnahmezustand geraten. Krisen stellen also ein Phänomen dar, das an der Nahtstelle zwischen Normalität und Krankheit liegt (Erikson 1966).
Leider ist die Verwendung des Begriffs »Krise« im psychotherapeutisch/psychiatrischen Kontext mitunter recht ungenau. Die Bezeichnung »psychosoziale Krise« stellt den Versuch einer Präzisierung und Eingrenzung dar, um so eine exaktere Indikationsstellung für psychosoziale Krisenintervention zu ermöglichen. Besonders die drohende Entwicklung oder Dekompensation schwerer psychischer Störungen, wie etwa einer Psychose (»psychotische Krise«) ist von psychosozialen Krisen zu unterscheiden. In diesem Fall ist es – auch im Hinblick auf die notwendigen Interventionsstrategien und Maßnahmen – sinnvoller, von einem psychiatrischen Notfall zu sprechen ( Kap. 3.3.5).
Mit Krise werden auch unterschiedlichste Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Natur beschrieben. Oft hat dies nichts mit einer Krise im beschriebenen Sinn zu tun. Tatsächlich gibt es aber gesellschaftliche Situationen, die zu Phänomenen und Zuspitzungen führen, wie man sie auch bei individuellen Krisen findet. So belastende äußere Ereignisse, wie Kriegshandlungen, Naturkatastrophen oder wirtschaftliche Krisen stellen die zentralen Übereinkünfte eines Gemeinwesens in Frage und häufig sind Gesellschaften in ihrer Gesamtheit dann zeitweise nicht mehr in der Lage, die damit verbundenen Probleme zu bewältigen. Solche Situationen haben natürlich erhebliche Auswirkungen auf das Individuum. Veränderungsprozesse erfahren unter Umständen im Individuum ihre krisenhafte Zuspitzung. Dessen Destabilisierung kann wiederum gesellschaftliche Verhältnisse sichtbar machen (Stromberger 1990) und hat dann Einfluss auf die Gesellschaft, wie z. B. in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit.
Die an die Arbeiten von Caplan (1964) und Cullberg (1978) angelehnte klassische Definition psychosozialer Krisen von Sonneck (2000; S. 15) lautet:
»Unter psychosozialen Krisen versteht man den Verlust des seelischen Gleichgewichtes, den ein Mensch verspürt, wenn er mit Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann, weil sie von der Art und dem Ausmaß her seine durch frühere Erfahrungen erworbenen Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel zur Erreichung wichtiger Lebensziele oder zur Bewältigung seiner Lebenssituation überfordern.«
In Erweiterung dieser Definition lassen sich zusammenfassend folgende allgemeine Charakteristika psychosozialer Krisen beschreiben ( Kasten 2.1).
Kasten 2.1: Charakteristika psychosozialer Krisen
• Der Betroffene wird mit belastenden Ereignissen oder neuen Lebensumständen konfrontiert, die wesentliche Lebensziele in Frage stellen.
• Gewohnte Problembewältigungsstrategien versagen.
• Dies macht die Situation rasch bedrohlich und führt zu einer massiven Störung des psychosozialen Gleichgewichts.
• Die emotionale Belastung ist hoch.
• Es kommt zu einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls und des Identitätserlebens sowie zum Verlust des normalen psychosozialen Funktionsniveaus.
• Es können unterschiedlichste psychopathologische Symptome auftreten.
• Der Vorgang ist zeitlich begrenzt – es wird versucht, möglichst rasch ein neues Gleichgewicht herzustellen.
• Wichtige Weichenstellungen für die Zukunft: Je nachdem ob konstruktive oder destruktive Bewältigungsschritte überwiegen, besteht die Chance zur Weiterentwicklung und Reifung. Ansonsten entstehen spezifische Gefährdungen und Fehlentwicklungen.