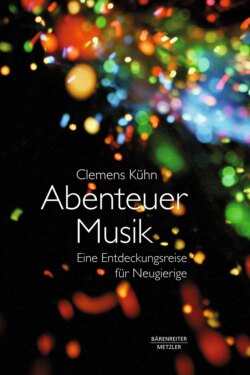Читать книгу Abenteuer Musik - Clemens Kühn - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Kunst und Leben
ОглавлениеIn der Schule durfte ich es mehrfach erfahren: Vermittlungen haben zu tun mit der Persönlichkeit, der Ausstrahlung und der Glaubwürdigkeit des Vermittlers. Der Deutschlehrer, der es verstand, so in die poetische Welt von Gedichten einzuführen, dass sie für uns Jugendliche nichts Verstaubtes mehr hatten. Der Kunstlehrer, der unsere Augen öffnete für Formen und Farben in der Malerei. Der Griechischlehrer, der keine Grammatik büffeln, sondern durch die Sprache hindurch etwas ahnen ließ von Geist und Kultur der Antike – eingebrannt hat sich mir, dass »xenos« im Griechischen »der Fremde« bedeutet, aber auch »der Gast«: Was in uns angerührt oder geweckt wird, geschieht durch die Begegnung mit Menschen. Davon handeln die zwei folgenden Abschnitte aus der Perspektive musikalischer Unterweisung, weil sie besonders anschaulich sichtbar macht, wo und wie Leben und Kunst sich berühren.
Ende der 1960er-Jahre hatte ich an einer Gewerbeschule in Hamburg St. Pauli einen Lehrauftrag. Die Klasse: etwa 20 Mädchen im Alter um die 16 Jahre, alle aus schwierigen Verhältnissen, ich als einziger Lehrer inmitten älterer Lehrerinnen, eine Stunde Musik pro Woche neben ansonsten nur hauswirtschaftlichen Fächern. Jung, unerfahren und von der Musikhochschule mit lebensfernen Empfehlungen ausgestattet, hatte ich Rosinen im Kopf: der Klasse erst einmal beizubringen, was »Sonate« und »Fuge« sind. Das ging natürlich gründlich schief, die erste Zeit war ein schieres Desaster. Dann kam die erlösende Idee, von etwas auszugehen, was keine Barrieren bietet: von Sprache. Sie ist, gleichgültig auf welchem Niveau, jedem zugänglich. So fingen wir an mit Beispielen konkreter Poesie, voran mit Ernst Jandls Sprachwitz. Wir spielten mit Sprache, mit Texten, dann auch mit Zahlen. Von da an ging es bergauf, und die bewegende Erinnerung bleibt, dass es gelang, zwei Jahre später mit der ganzen Klasse ein Konzert in der Hamburger Musikhalle zu besuchen. Es gelang, weil sich die Mädchen als Personen angenommen wussten und dadurch den Mut gewannen, sich einer ihnen fremden Welt zu öffnen. Das war die unvergessliche Lektion, die nicht nur für »Unterricht« gilt: Ein Unterricht hat sich zunächst an den Menschen zu bewähren, die ihm anvertraut sind.
In einem Seminar, das sich an künftige Musikpädagogen wendete, sprachen wir einmal über Idee und Form des Sonatensatzes, einer Hauptform in klassischer Musik. Hinterher bemerkte eine Studentin, ihr sei ein Gedanke gekommen, wie man dies Schülern vermitteln könne. Hier ihr Einfall: Sie geht von der Vorstellung einer Stadt aus. Der ganze Sonatensatz ist wie eine Stadt. Die unterschiedlichen Themen sind den Stadtbezirken vergleichbar. Straßen bilden musikalische Phrasen [kurze Sinneinheiten], und die einzelnen Häuser sind die Motive [kleinste musikalische Bausteine].
Für Musik sind Bilder von unschätzbarem Wert, wenn sie sich auf lebensgestützte Erfahrungen beziehen. Der Begriff der Lebenswelt, von Philosophen entlehnt, ist seit den 1980er-Jahren in der Musikpädagogik zu Hause. Dahinter steht die Idee, Musik für die Lebenssituation der Schüler zu erschließen, indem persönliche Grunderfahrungen wie Trauer, Stille, Nacht, Abschied, Zuneigung, Glück in Beziehung gesetzt werden zu entsprechenden Werken: um etwas von der Musik, aber auch von sich selbst zu erfahren. Das Konzept der Lebenswelt wurde inzwischen, wie es allen wegweisenden Begriffen widerfährt, verschiedentlich problematisiert. Doch ohne Frage bleibt es ein tragfähiger Ansatz, der zutiefst menschlich ist. Er macht das Zusammensein von Kunst und Leben fassbar – nicht nur für Schüler.
* * *
Was für Vermittlung von Musik gilt, gilt für Musik insgesamt: Sie hat zu tun mit dem Leben, faktisch, indem Musik einen Teil des Lebens abgibt, ideell, indem Musik das tatsächliche Leben in vielfältiger Weise in sich spiegelt. Sie spricht von uns. Gustav Mahler hat das wunderbar formuliert. Im Zusammenhang mit seiner Dritten Sinfonie (1895/96) bekundete er, »Symphonie« heiße für ihn, »mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufbauen«, und in einem Brief schrieb er: »Wenn man musizieren will, darf man nicht malen, dichten, beschreiben wollen. Aber was man musiziert, ist doch der ganze (also fühlende, denkende, atmende, leidende etc.) Mensch.«
Es gibt Verhaltensweisen und emotionale Befindlichkeiten, die dem Menschen eigen sind, unabhängig von der Zeit, in der er lebt. Wie Menschen mit ihnen umgehen, wandelt sich, nicht aber die Eigenschaften selbst: Der moderne Rechtsstaat untersagt archaisches Rache üben – aber Rachegelüste können dennoch bestehen. Bezogen auf Musik bedeutet »mit ihnen umgehen«, wie etwas in Töne gesetzt wird. »Liebe« bewegt alle zu allen Zeiten, von ihr handelt ein Madrigal [im 16./17. Jahrhundert ein mehrstimmiges Vokalstück] ebenso wie ein Lied Franz Schuberts. Die Haltungen und die Sprachmittel aber unterscheiden sich. Die Selbstverliebtheit und die exzentrische Sprache des Madrigals sind nicht vergleichbar mit der Hingabe und Wärme von Beethovens Klavierlied Ich liebe Dich oder dem glühenden Ton und der Wehmut in Richard Strauss’ Orchesterlied [vom Orchester statt vom Klavier begleitet] Im Abendrot. Liebe, Überschwang, Hass, Freude, Wut gehören dem Menschen zu, und solche Gefühlswelten spiegeln sich in Musik. Im Barock nannte man sie Affekte, auch »Leidenschaften der Seele« und »Gemütsbewegungen«. Musik, heißt es in musikalischen Lehrwerken, solle »die Leidenschaften bald erregen« und »bald wieder stillen«, sie solle »durch harmonische und melodische Figuren« [ausdruckserfüllte Gestalten] »zum Beispiel die Raserey, den Zorn oder andere gewaltigen Affeckten vorzustellen suchen«, und der Spieler müsse »hinlängliche Einsichten in den Affeckt eines Stückes« haben.
Noch im ausgehenden 18. Jahrhundert klang diese Vorstellung nach, doch drängten sich andere Vokabeln vor. Aufregend zu sehen ist hier im Bereich der Musik, was auch allgemein bei politischen und gesellschaftlichen Veränderungen zu beobachten ist: dass sich im Wandel der Begriffe ein Wandel des Denkens abzeichnet. Im zweiten Band (1787) seiner Kompositionslehre sagt Heinrich Christoph Koch, »die eigentliche Absicht der Tonkunst« sei es, »Empfindungen zu erwecken«, die »den Geist oder den innern Character des Tonstücks« ausmachen. Koch spricht, wie nun andere Autoren auch, vom Charakter, sein Musikalisches Lexikon von 1802 widmet dem Stichwort »Charakter« sogar einen eigenen Artikel.
Im 19. Jahrhundert tritt das Wort von der kompositorischen Idee hinzu. Robert Schumann zählt zu den »Gesichtspuncten, unter denen man ein Musikwerk betrachten kann«, die »besondere Idee, die der Künstler darstellen wollte«.
Im 20. Jahrhundert stellt Arnold Schönberg 1935 den musikalischen Gedanken heraus: Er schildert Musik als »die Darstellung musikalischer Gedanken eines Musik-Dichters, eines Musik-Denkers; diese musikalischen Gedanken müssen den Gesetzen der musikalischen Logik entsprechen; sie sind ein Teil dessen, was der Mensch geistig wahrnehmen, durchdenken und ausdrücken kann.«
Affekt – Charakter – Idee – Gedanke: Jedes Jahrhundert hebt eine andere Qualität hervor, immer aber ist sie Ausdruck des Menschen.
Dies zeigt sich auch an der Art, wie über Musik geredet wird. Einerseits gibt es Fachbegriffe, wie »Punktierung«, »Tonika«, »Homophonie«, »Tutti«; das ist nicht anders als in anderen Disziplinen – das Vokabular in medizinischen Diagnosen gibt ein drastisches, allen bekanntes Beispiel für Begriffe, die keiner außer den Ärzten versteht. Andererseits haben Beschreibungen von Kunst die Besonderheit, dass sie lebensnahe Begriffe benutzen. Autoren des 18. Jahrhunderts sind darin unübertroffene Meister. Wenn Daniel Gottlob Türk in seiner Klavierschule von 1789 »einige Charaktere« in der Musik vorstellt, klingt das so: »Tonstücke« sind »von einem muntern, freudigen, lebhaften, erhabenen, prächtigen, stolzen, kühnen, muthigen, ernsthaften, feurigen, wilden, wüthenden Charakter, [oder] von einem sanften, unschuldigen, naiven, bittenden, zärtlichen, rührenden, traurigen, wehmüthigen Charakter.« »Der ganze Mensch«, um mit Gustav Mahler zu sprechen, ist in Türks musikalischen Charakteren enthalten.
Der Dirigent Daniel Barenboim stellte eine Position dagegen, die zum Nachdenken herausfordert. In einem Interview im Jahr 2005 kehrte Barenboim die Vorstellung vom »Leben«, das in »Musik« eingeht, radikal um: »Es wird als Selbstverständlichkeit angenommen, dass wir erst vom Leben lernen müssen, um Musik spielen zu können. Man sagt: Wer im Leben Erfahrungen gesammelt hat, kann sie auch in Klang umsetzen. Das ist aber falsch. Ich selbst habe erfahren, dass die Musik eine künstliche Imitation von Leben und Natur darstellt. […] Also behaupte ich, von der Musik viel mehr für das Leben gelernt zu haben als vom Leben für die Musik.«
* * *
Gleich wie man ihr Verhältnis zueinander einschätzt, in zwei Qualitäten geht »Musik« – besser: alle bedeutende Kunst – nicht im »Leben« auf, sondern steht ihm gegenüber: Ein geglücktes Kunstwerk besitzt eine Schönheit und Vollkommenheit, die es vom realen Leben absetzt. Es dürfte kein Zufall sein, dass unter den Musikliebhabern gerade die Ärzte eine ausgeprägte Affinität zur Musik haben; nicht ohne Grund gibt es auch so zahlreiche Ärzteorchester. Ärzte haben Tag für Tag mit Krankheit zu tun, mit Leiden, Schmerzen, Bedrückendem, Hässlichem. Musikern ist es geschenkt, mit Schönem umgehen zu dürfen. Musik ist das Andere: Ärzte finden darin eine Gegenwelt. Und genauso ergeht es – aus jeweils eigenen Motiven – unendlich vielen Menschen.