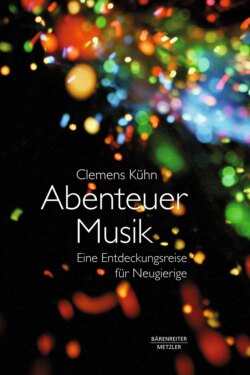Читать книгу Abenteuer Musik - Clemens Kühn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Melodien gehen ins Herz, Rhythmus geht in den Körper
ОглавлениеBeethovens Siebte Sinfonie beginnt auf wunderschöne Weise. Bläser reichen einander ihre zweitaktige Melodie weiter, jede Übergabe ist durch einen Akkord [Zusammenklang von drei oder mehr Tönen] markiert, dem in den Streichern ein leiser Klang folgt. Die melodischen Bögen wechseln ihre instrumentalen Farben: von der Oboe zu den Klarinetten und Hörnern und dann verbreitert zu sieben Stimmen. Das Ganze ist so eigen wie tief berührend. Die Kraft des Melodischen, noch durch die Klangfarben bereichert, rührt die Hörer an. [»Klangfarbe« heißt der spezifische Klangcharakter, den ein Instrument mit sich bringt.]
Ganz anders Beethovens Fünfte Sinfonie. Verschiedene Versionen ihres Anfangsmottos sind im folgenden Beispiel nebeneinandergestellt:
Version (a) ist das Original; (b) macht aus dessen Fall einen Schritt; (c) fällt tiefer als a; (d) schreitet nach einmal Tonwiederholung abwärts, (e) schreitet nach einmal Tonwiederholung aufwärts. Später folgen noch andere Fassungen. Jeder Hörer wird sie als verwandt wahrnehmen, ohne die skizzierten Unterschiede im Detail zu registrieren, dazu gehen die Figuren zu schnell vorbei. Doch kein Hörer wird – anders als bei der Siebten Sinfonie – versucht sein, die verschiedenen Gestalten singen zu wollen.
Ein eigentümliches Notenbild ergäbe sich, beherrscht von immer »derselben« Figur, würde man für den ganzen Satz lediglich ihre rhythmische Gestalt notieren; hier eine Stelle, wo sie zweimal von oben nach unten durch die Streichinstrumente wandert:
Im ersten Satz von Beethovens Fünfter Sinfonie hat die Kraft des Rhythmischen den Hörer im Griff. Eigentlich ist es kaum zu glauben: Eine einzige rhythmische Idee, die für sich genommen noch nicht einmal originell ist, durchzieht und verklammert nahezu den ganzen Satz. Der Grundrhythmus der Anfangsidee ist das Bindeglied sämtlicher weiterer Fassungen: Identischer Rhythmus kann aus unterschiedlichen melodischen Verläufen das »Gleiche« machen.
Eine Musikliebhaberin sagte einmal, beim zweiten Satz, dem Adagio [langsam], von Beethovens Fünftem Klavierkonzert bekomme sie Gänsehaut. Auf die Frage, was daran sie berühre, gab sie die so schlichte wie musikalisch treffende Antwort: »die Melodie, der Klang«. Melodie bringt Emotion, Rhythmus stimuliert. Sie können das an sich selbst überprüfen. Beethoven, Erstes Klavierkonzert: Hören Sie sich bitte den Anfang des langsamen zweiten Satzes an, der Largo [breit] überschrieben ist, und danach den Anfang des schnellen dritten Satzes, Allegro [schnell] scherzando [scherzend]. Beide Sätze werden vom Klavier allein eröffnet, jeweils mit einem Thema; zur Orientierung: das Thema des Largo ist zweiteilig, das Thema des Schlusssatzes dreiteilig. Zu vermuten ist, dass Sie instinktiv beim Largo innerlich mitsummen werden, auch wenn Sie das Thema noch gar nicht kennen, beim Allegro aber körperlich mitgehen; jeder kennt die Erfahrung, dass bei einer flotten Musik die Beine oder Hände zu zucken beginnen. Das getragene Largo ist Melodie, ist Empfindung, das schmissige Allegro ist Rhythmus, ist Bewegung. Der Einwand, das sei nicht weiter verwunderlich, da schon die Tempi grundverschieden seien, zählt nicht wirklich: Auch langsame Sätze können rhythmisch prägnant sein, so der Trauermarsch, Marcia funebre, aus Beethovens Klaviersonate As-Dur op. 26; auch schnelle Sätze können melodisch fesseln, so Rossinis sprühende Opernouvertüren. Von Beethovens Largo behalten Sie die Melodie, vom Allegro wird der Rhythmus in Ihnen weiterpochen.
Rhythmus ist jene Eigenschaft von Musik, die physisch unmittelbar packt. Filmmusik unterstützt damit die Handlung und die Wirkung der Bilder, so die Musik von John Powell zu den Action-Filmen um Jason Bourne oder John Barrys Musik zu James-Bond-Filmen. Umso ungewöhnlicher ist dieser Einfall: Wer Wolfgang Petersens Film Troja (2004) gesehen hat, hat vielleicht einen Kunstgriff des Komponisten James Horner bemerkt: Dem entscheidenden Kampf zwischen Hektor und Achill unterlegt Horner keine Musik, sondern bloße Rhythmen. Der – dadurch im Zuschauer aufgeputschte – Kampf dauert lang: zweieinhalb Filmminuten. Die Wirkung ist genau kalkuliert: Schlagartig in dem Moment, in dem Hektor getroffen wird, setzt die Gesangsstimme ein.
Rhythmus ist eine Urkraft von Musik. »Am Anfang war der Rhythmus«, behauptete der Dirigent Hans von Bülow (1830–1894), in gewagter Abwandlung des theologischen Satzes aus dem Johannes-Evangelium: »Im Anfang war das Wort.« Und Eduard Hanslick definierte in seiner Schrift Vom Musikalisch-Schönen (1854) das »Wesen« von Musik »im Großen« wie »im Kleinen« als »Rhythmus«. Beide Äußerungen lassen sich infrage stellen: »Am Anfang« von Musik kann auch der menschliche Gesang gestanden haben, und nicht jede Musik ist gekennzeichnet durch einen »Rhythmus im Großen«, den Hanslick als »die Übereinstimmung eines symmetrischen Baus« versteht. Aber die Äußerungen fassen zugespitzt den elementaren Rang von »Rhythmus«.
Vom Rhythmus sind der Takt und das Metrum zu unterscheiden. An den ersten 16 Takten von Johann Strauß’ berühmtem Walzer An der schönen blauen Donau – zu dem kein Geringerer als Johannes Brahms schrieb: »leider nicht von mir« – seien alle dazu gehörigen Sachverhalte demonstriert:
Ein Takt, angezeigt durch Taktstriche, ist eine Maßeinheit für Notenwerte. Ihre Menge hängt von der Taktart ab. Ein »Dreivierteltakt«, Merkmal eines Walzers, enthält insgesamt die Dauer von drei Vierteln. Der Takt gibt die abstrakte Einheit vor, der Rhythmus bildet darin konkrete Gestalten aus. Die Taktzählung erfolgt durch Zahlen über den Takten. Jeder Takt enthält innere Zählzeiten, hier drei Viertel als Zählzeit 1, 2, 3. Und grundiert wird ein Takt durch das Metrum, im Notenbeispiel *: einen spürbaren, unterschiedlich schnellen Puls im Hintergrund der Musik; das erwähnte Zucken des Körpers bei flotten Rhythmen gibt meist, ohne dass es einem bewusst würde, das Metrum wieder.
Ein Takt hat abgestufte Betonungen: In einem Dreivierteltakt ist die Zählzeit 1 betont, die 2 und 3 sind unbetont. Mit einer ziemlich sicheren Methode kann man deshalb eine Taktart erkennen: Im Tempo der Musik zählt man zum Beispiel innerlich 1-2-3 und betont dabei die 1; geht die Zählung auf, ist es ein Dreivierteltakt; entsprechend macht man es beim Viervierteltakt.
Das nachhaltig Beschwingte im Walzer von Strauß wird durch den beibehaltenen Rhythmus besorgt, der zugleich die kleinen melodischen Abwandlungen verbindet: Der Rhythmus der Takte 1 bis 4 wird ständig wiederholt und bleibt noch in den nicht mehr abgebildeten Takten 17 bis 24 unverändert! Wenn ich Ihnen aber den folgenden Rhythmus aus lauter Sechzehnteln vorlege
und behaupte, nur daraus könne man zwei verschiedene, längere Stücke machen, werden Sie das entweder für einfallslos oder für verrückt halten. Tatsächlich stammen die Sechzehntel von – Johann Sebastian Bach, und von den »zwei längeren Stücken« habe ich gerade mal den Rhythmus der ersten beiden Takte genommen. Das eine Stück bestreitet damit geschlagene 34 Takte, das andere 33 Takte. Die Stücke eröffnen Das Wohltemperierte Klavier Bachs, eine zweibändige Sammlung von Präludien [Vorspielen] und Fugen [zur Fuge siehe Station 17] in allen Dur- und Molltonarten [eine Tonart gibt den Klangraum einer Musik an, Dur und Moll ihr »Tongeschlecht«, das den Charakter mitprägt]. Die beiden ersten Präludien, in C-Dur und in c-Moll, beruhen durchgehend auf Sechzehnteln, die fließend Akkorde entfalten bzw. mit benachbarten Noten auszieren:
Bachs Musik ist generell motorisch. Die Motorik gibt ihr einen manchmal unerbittlich wirkenden Sog. Typisch für Stücke Bachs ist, dass sie nach einer kleinen Pause beginnen, wie die erste Fuge des Wohltemperierten Klaviers, und durch diese wie einatmende Pause () das Folgende in Schwung setzen:
Bachs Motorik ist niemals starr mechanisch; das spöttische Bild von der »Nähmaschine«, das gelegentlich für das c-Moll-Präludium benutzt wurde, geht an der Musik vorbei. Der französische Pianist Jaques Loussier (* 1934) war es, mit dem von ihm gegründeten »Play Bach Trio« aus Klavier, Schlagzeug, Kontrabass, der den rhythmischen Nerv der Bach’schen Musik traf, eigentlich müsste man sagen: freilegte. In den 1960er-Jahren veröffentlichte das Trio fünf Schallplatten Play Bach; es entdeckte in Bach gleichsam den Jazzkomponisten. Ich weiß noch, wie wir damals als junge Menschen gebannt waren vom Spiel des Trios. Es tat Bach niemals Gewalt an. Der Notentext wurde gern einfach übernommen, durch das Klavier hörbar und fühlbar gemacht in seinem rhythmischen Leben, durch den Kontrabass in der Art seines Bassfundamentes und durch das Schlagzeug in seiner inneren Erregtheit, und dann wurde der Notentext in eine – dezente – Jazz-Fassung überführt. Bachs Musik hat Swing. Dieses Erlebnis war seinerzeit atemberaubend und ist immer noch aktuell.
Ein radikales Gegenteil von Bachs unbeirrt durchgehenden Sechzehnteln ist dieser vertrackte rhythmische Verlauf:
Die Verwirrung ist komplett: Dreisechzehntel, Zweisechzehntel, Dreisechzehntel, Zweiachtel …: Ständig wechseln die Taktart und die Notenwerte Sechzehntel und Achtel; bis auf den letzten Takt beginnt keiner der Takte betont auf seinem Anfang, sondern nach einer Sechzehntelpause; eine Ordnung wird angedeutet (die Takte 3 bis 5 und 7 bis 9, im Beispiel mit Punkten versehen, sind rhythmisch gleich), aber wieder aufgehoben. Den gewaltigen, zuvor noch nie gewagten Effekt sieht man dem Beispiel nicht an: Das ganze Orchester spielt zusammen, zu heftigen Schlägen gebündelt, als ob es ein einziges riesenhaftes Instrument wäre. Mit solchem rhythmischen Zickzack beginnt der Schlusssatz Danse sacrale von Igor Strawinskys Ballett Le Sacre du printemps, durchweg nur Sacre genannt, dessen Uraufführung 1913 einen legendären Skandal auslöste, mit Tumulten und Handgreiflichkeiten im Publikum: Die Musik wirkte, vor allem in ihrer klanglich-rhythmischen Härte, genauso unerhört wie das Thema des Balletts: das heidnische Ritual, dem Frühlingsgott eine Jungfrau zu opfern.
Zum Vergleich sei eine andere rhythmische Anlage dagegengehalten. Probieren Sie dieses Beispiel bitte einmal selbst aus:
Mit der linken Hand (l) klopfen Sie fortwährend, ohne abzusetzen, gleichbleibende Pulse (), dazu dann mit der rechten Hand (r) verschobene Akzente () und zwei Schläge () pro Puls, alles zunächst langsam, dann schneller, pro Sekunde etwa vier . Linke und rechte Hand können Sie natürlich auch vertauschen, wenn Ihnen das angenehmer ist.
Erst danach hören Sie sich den zweiten Satz des Sacre an, Danse des adolescentes. Sie hatten seine anfängliche Rhythmik umgesetzt: Das rhythmisch immergleiche entspricht den Streichern, die Akzente den acht (!) Hörnern, die verdoppelten Schläge den Fagotten [tiefe Holzblasinstrumente]. Gegenüber unberechenbaren rhythmischen Ausbrüchen kennt der Sacre auch die andere Seite: die Wucht gleichbleibender Bewegung.
Dass »Takt« auch auf weniger drastische Weise ausgehöhlt werden kann, zeigt Musik der Romantik. Robert Schumanns Impromptu (1838), Nr. 9 der Albumblätter op. 124 für Klavier, ist aus vier Stimmen gewebt. Hier sind, untereinandergestellt, die rhythmischen Anfänge der vier Stimmen von oben nach unten:
Die rhythmischen Zutaten selbst sind simpel. Es kommen nur vor: Achtel allein, zu zweit, zu dritt; Achtel an Achtel gebunden, mit der Dauer also eines Viertels; sowie Viertel. Ihre Taktart jedoch ist völlig unklar. Schumann notiert einen Dreivierteltakt, aber niemand hört ihn, weil alle Stimmen konsequent gegen den Takt gestellt sind. Der »Dreiviertel«-Takt hat keine musikalische Bedeutung – er kippt eher in einen »Sechsachtel«-Takt um –, sondern ist allenfalls eine optische Begrenzung und Lesehilfe. Musikalisch gemeint ist ein vom Takt gelöstes freies Fließen.
Am Ende muss vermittelt werden. »Melodie« und »Rhythmus« agieren keineswegs unabhängig voneinander. Dafür zwei eindrucksvolle Beispiele: Der französische Komponist Charles Gounod (1818–1893) schrieb ein Ave Maria. Bei vielen ist es als kitschig verpönt – zu Unrecht: Kitschig ist nicht das Stück selbst, sondern Kitsch wurde es durch das, was aus ihm gemacht wurde. Gounod hatte den genialen Einfall, in dem rhythmischen Gleichlauf von Bachs oben zitiertem C-Dur-Präludium eine Melodie zu entdecken. Sein Ave Maria macht sie hörbar, indem es Hochtöne des Präludiums zu einer Melodie formt, ergänzt um Töne aus der Mitte der Figurationen. Das folgende Notenbeispiel zeigt exemplarisch den Beginn des Ave Maria, darunter Bachs Präludium, vereinfacht notiert, die entsprechenden Töne im Präludium umkreist.
Richard Wagner sagte über Bachs C-Dur-Präludium, in dessen »Kontinuität« liege etwas, »dem man nicht müde wird zu folgen, wie man einem Strom endlos zusehen kann.« Der »Strom« ist ein Bild für eine zäsurlose, wie unbegrenzt weiterfließende, von gleichförmigen Gliederungen freie Melodie. Wagner hatte sie in seiner Schrift Zukunftsmusik (1860) als unendliche Melodie gepriesen. Er sah dieses Ideal bei Bach vorgebildet. »Die unendliche Melodie ist da prädestiniert«, namentlich im Wohltemperierten Klavier, und dies habe ihn kompositorisch nachhaltig beeinflusst: »Das hat mir meinen Duktus gegeben, […] das hat mich bestimmt. Das ist unendlich! So etwas hat keiner wieder gemacht.« Die Zitate Wagners folgen Tagebucheintragungen seiner Frau Cosima. Was für eine grandiose Vorstellung: Bachs Bewegungen als Inbegriff von Melodie. Hören Sie sich zum Beispiel den Einleitungssatz von Bachs Matthäus-Passion an und das Vorspiel zu Richard Wagners Oper Tristan und Isolde. Die Kombination ist gewagt, da die Werke unvergleichbaren Welten und Sprachen zugehören, der Kirche und dem Theater, und doch lässt ihr Nebeneinander Entscheidendes erleben: Musikalisches Strömen hier wie dort. Unscharf wird, wer den Vorrang hat: Melodik, Rhythmik, Harmonik, alles geht ineinander auf. Zurück bleibt ein Eindruck von Größe und Unbegrenztheit.