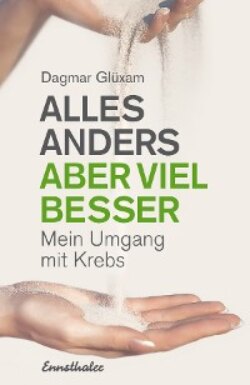Читать книгу Alles anders, aber viel besser - Dagmar Glüxam - Страница 11
Kindheit und Jugend
ОглавлениеIch kam in einem kleinen nordmährischen Dorf mitten im Kalten Krieg auf die Welt. Meine Mutter – zwar eine durch und durch gutmütige, mit ihren Pflichten aber grenzenlos überforderte Frau – musste aufgrund der damaligen gesetzlichen Bestimmungen bald nach meiner Geburt wieder arbeiten gehen. Ich wurde zusammen mit meinem um fünf Jahre älteren Bruder von meiner Großmutter erzogen. Da die Großmutter nach dem frühzeitigen Tod meines Großvaters allein eine kleine Landwirtschaft mit einem riesigen Garten, einem Feld und unzähligen größeren und kleineren Tieren betrieb, hätte sie auch ohne uns Kinder genug zu tun gehabt. So erwartete sie natürlich von meinen Eltern, vor allem von meiner Mutter tatkräftige Unterstützung. Meine Eltern standen täglich um fünf Uhr auf und gingen in die Arbeit – meine Mutter arbeitete als Buchhalterin, mein Vater als Elektrotechniker –; sie kamen um drei oder vier Uhr nachmittags nach Hause, wo nicht nur zwei Kinder und der gar nicht kleine Haushalt, sondern auch die überaus üppige und nach Versorgung rufende Fauna und Flora am Anwesen der Großmutter auf sie warteten, einen Tag nach dem anderen, das ganze Jahr hindurch.
Die Ehe meiner Eltern dauerte mehr als fünfundfünfzig Jahre und galt als vorbildlich, allerdings – wie sogar mein Vater nach dem Tod meiner Mutter freiwillig zugab – vor allem deshalb, weil meine Mutter sich komplett seinen Vorstellungen unterordnete. Sie tat nie oder selten etwas für sich, dafür alles für uns, für ihren Mann, für ihre Mutter. Mit »alles« meine ich vor allem die aufopfernde Befriedigung von Bedürfnissen materieller Art, denn für Liebe und Zuneigung blieb ihr keine Energie mehr. Sie hatte leider keine Geduld und auch keine besonders gute Hand für Kinder. Erst viel später erfuhr ich, dass sie – nicht zuletzt der harten Lebensumstände in der Kohlengrubenregion und der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges wegen – selbst kaum Liebe und Geborgenheit erfahren hatte. Wohl durch die lange Zeit der Entbehrungen bedingt, wurde materieller Besitz (soweit im Kommunismus möglich), Auto, Farbfernseher (schlicht: Sachen und Gegenstände) in meiner Familie mehr geschätzt als Zufriedenheit, Geborgenheit und Liebe. Materiell hat es mir auch nie an etwas gefehlt. Ich lebte mit meiner Familie in einem großen Haus; mein Bruder und ich konnten mehrere Musikinstrumente erlernen, Privatstunden nehmen und studieren, denn sowohl meine Eltern als auch meine Großmutter waren tüchtige und fleißige Menschen. Der Preis für diese Annehmlichkeiten war allerdings hoch. Meine überaus geliebte Oma starb mit siebzig Jahren inmitten ihrer grenzenlosen Latifundien an einem Herzinfarkt; meine Mutter durfte nie erleben, wie sich ein selbstbestimmtes Leben anfühlt.
Schon sehr früh wurde mir beigebracht, meine chronisch überarbeiteten und unter ständigem Arbeitsdruck leidenden Eltern nicht zu stören, sondern Rücksicht zu nehmen. Draußen, im Garten und im Wald, mit unseren Tieren, meinen Katzen und dem Hund, genoss ich uneingeschränkte Freiheit und eine fantastische Kindheit, voll mit Fantasieabenteuern. Zu Hause lernte ich, auf Zehenspitzen zu gehen und möglichst nicht aufzufallen. Ein Ausweg bot sich für mich in geradezu unkontrolliertem Lesen. Ich las alles, was mir in die Hände kam. Wie etwa die dreibändige Autobiografie von Maxim Gorki oder Madame Bovary von Gustave Flaubert, die ich bereits mit elf Jahren verschlang. Mein Wortschatz explodierte und brachte mir in der Schule viel Lob ein; aus heutiger Sicht betrachte ich dieses Verhalten, das mich übrigens fast mein ganzes Leben begleiten sollte, als eine Art Flucht vor dem Leben.
Ich begriff offenbar schon sehr früh, dass ich – wollte ich meine Eltern, vor allem meine Mutter irgendwie auf mich aufmerksam machen – genau genommen zwei Möglichkeiten hatte: Krankheit oder schulischen Erfolg. So wurde ich häufig, gelegentlich auch ernsthaft krank, wurde eine ausgezeichnete Schülerin, die zwei Instrumente spielte, erfolgreich auf diversen Schulveranstaltungen auftrat und zahlreiche sportliche Wettbewerbe gewann. Sowohl mein Bruder als auch ich lernten nicht nur sehr früh, uns ausschließlich über Leistung und gute Noten zu definieren, sondern auch stets besser als die anderen sein zu müssen; denn das brachte uns relativ verlässlich die Aufmerksamkeit unserer Eltern. Wie ich schnell begriff, reichten normale Leistungen nicht, im Gegenteil, je außerordentlicher, desto besser. Daher wählte ich instinktiv Aufgaben, deren Bewältigung fast einem Wunder ähnelte. So entschied ich mich, Berufsgeigerin zu werden, obwohl ich erst mit zehn Jahren begann, Geige zu spielen und aufgrund der ausgezeichneten Noten viel leichter jedes andere Studium oder jeden anderen Berufsweg hätte wählen können. Trotz der anspruchsvollen Aufnahmeprüfung – die osteuropäischen Konservatorien und Musikakademien waren weltweit für ihr hohes Niveau und ihren Leistungsdruck bekannt – und strenger Auswahlverfahren wurde ich am Konservatorium aufgenommen und beendete die Ausbildung mit Auszeichnung. Gefühlt hatte ich mich die ganze Zeit aber wie ein gehetzter Hund; denn etwa fünf Jahre Musikunterricht, die mir die meisten meiner Schulkollegen voraus waren, mussten irgendwie nachgeholt werden.
Der Drill an der Schule war entsetzlich. Noch Jahrzehnte später erkannte ich die freudlose und auf Leistung getrimmte Ausübung von Musik wieder, als ich den Film »Die Klavierspielerin« nach dem Roman von Elfriede Jelinek gesehen hatte. Von der perversen Beziehung zwischen der Klavierlehrerin und ihrem Schüler abgesehen, erlebte auch ich diesen geradezu vernichtenden Leistungsdruck, der einem die letzten Reste von gesundem Selbstbewusstsein und Selbstachtung raubte. Die zwei größten »Geigerstars« meines Jahrganges, denen damals eine brillante Solokarriere prophezeit wurde, sind heute schwere Alkoholiker. Ich absolvierte das Konservatorium u. a. mit zwei violintechnisch höchst anspruchsvollen Capricen von Niccolò Paganini, dem wohl größten und berühmtesten Geigenvirtuosen aller Zeiten, war aber der festen Überzeugung, nicht Geige spielen zu können.
Schon während der Jahre am Konservatorium dämmerte mir, dass das Unterrichten an einer Musikschule oder eine Orchesterstelle doch nicht das war, was mich erfüllen würde, deshalb musste ich nach einer anderen Ausrichtung suchen. Da ich durch mein Studium am Konservatorium in der beruflichen Auswahl bereits stark spezialisiert, das heißt auch eingeschränkt war, bot sich die Musikwissenschaft als die beste Variante an. Dieses Studium war, wie damals alle universitären Studienrichtungen in der ehemaligen Tschechoslowakei, nicht nur heiß begehrt, sondern auch streng reglementiert. In Hinsicht auf die vorhandenen Stellen – in der Tschechoslowakei gab es im Kommunismus keine arbeitslosen Geisteswissenschaftler – bekamen nur einmal in fünf Jahren lediglich fünf Studenten die Möglichkeit, abwechselnd an den Universitäten in Prag oder Brünn Musikwissenschaft zu studieren. Für mich also gerade exquisit genug. Auch diese Hürde schaffte ich und wurde nach anspruchsvollen und langwierigen Aufnahmetests aufgenommen, trotz der Tatsache, dass bei über vierzig Bewerbern drei der vorhandenen fünf Stellen bereits mit Protektionskindern besetzt waren. Mein Bruder begann ein Technikstudium.
Meine Eltern gaben mit uns beiden an. Konnten aber ihre Freunde regelmäßig davon hören, wie gescheit und begabt mein Bruder und ich waren, hörten wir selbst nur selten Lob oder Anerkennung. Da wir beide damals nie erfuhren, wie es sich anfühlt, von den Eltern geliebt zu werden, ohne dass man sich die Zuneigung zuerst irgendwie verdienen musste, dachten wir, dass unsere Existenz nur durch Leistung begründet sei. Und umgekehrt: Ohne Leistung gibt es kein Recht aufs Leben. Eine fatale Überzeugung, die das Leben meines Bruders mit dreiundvierzig Jahren früh beendete und mich schwer erkranken ließ.
Das ist das Drama der begabten Kinder – es müssen nicht immer Alkohol, Drogen, Vergewaltigung oder Gewalt sein, die dramatische Auswirkungen zu Folge haben. Viel gefährlicher ist diese subtile emotionale Ausbeutung, weil unsichtbar und in ihrer Konsequenz in der Gesellschaft sogar hoch anerkannt (fleißige, ehrgeizige Menschen …). »Burn-out« als die neue Volkskrankheit. Was steckt denn dahinter?
Durch den selbst auferlegten Erfolgsdruck getrieben, absolvierte ich nicht nur die Schule und das Konservatorium, sondern auch die gesamte Universität mit Auszeichnung. Das Problem lag nur darin, dass die guten Noten mit der Zeit irgendwie an Wirksamkeit verloren, ähnlich wie der Ministerempfang auf der Prager Burg, zu dem ich als eine der besten Universitätsabsolventen des Landes eingeladen wurde. Aber meine außerordentlichen schulischen Leistungen waren bereits übersättigend; sie wirkten einfach nicht mehr mit der gewünschten Intensität. Als ich nach meinem letzten Staatsexamen nach Hause kam und die freudige Nachricht (eine »Eins«!) mitteilte, nahm meine Mutter es kaum zur Kenntnis und meinte nur, ich solle mein Zimmer endlich aufräumen.
Meine gesamte Kindheit und Jugend über hatte ich das starke Gefühl, dass ich alles, was ich tat, eigentlich nicht für mich, sondern für meine Eltern tat. Ich musste ihnen Freude machen; ich durfte sie nie enttäuschen. Vielleicht trug auch die damalige politische Situation in der Tschechoslowakei, die kommunistische Diktatur, dazu bei, dass meine Eltern immer irgendwie frustriert und unglücklich auf mich wirkten. Keine Frage, es war nicht einfach, in einer Umgebung von Spitzeln und Geheimpolizei parteilos zu bleiben und das eigene Gesicht zu wahren, die eigenen Kinder politisch zwar aufzuklären, aber doch nicht durch zu viel Freigeist und liberales Denken zu gefährden. (Wer weiß, was sie dann in der Schule erzählen würden …) Ich liebte meine Eltern und wollte auf keinen Fall, dass sie litten. Ja: Ich fühlte mich geradezu verpflichtet, ihre Laune aufhellen, und ich fühlte mich für ihr Wohlergehen zuständig.
Später versuchte ich mehrere Male, mit meiner Mutter und meinem Vater über diese Themen zu sprechen, vor allem mit meiner Mutter, solange sie lebte. Es half nichts. Sowohl sie als auch mein Vater waren fest davon überzeugt, dass sie uns beide bestens erzogen hätten und dass ich mit den Litaneien über mein kindliches Leid grenzenlos übertriebe, denn ich hätte mal einen Krieg erleben müssen … Keine Frage, meine Eltern taten für unseren schulischen Erfolg wirklich alles, was sie konnten. Sie unterstützten uns auch später bei unserer Berufswahl und während des Studiums. Ich aber hätte bedingungslose, uneingeschränkte Liebe und Geborgenheit gebraucht und das Gefühl, dass meine Eltern mich auch dann noch haben wollten, wenn ich mal eine Zwei nach Hause brachte.
Irgendwann gab ich diese zermürbenden Debatten auf. Im Rahmen spezieller geistiger Reisen (der sogenannten »Journeys«), über die ich später berichten werde, hatte ich mich mit meinen Eltern auch ohne ihr physisches Zutun versöhnt. Ich hatte begriffen, dass es nichts bringen würde, Mutter und Vater ein Leben lang die Schuld für mein unbefriedigendes Leben zu geben. Ich war längst erwachsen und mehr als berechtigt, mein Leben selbst und nach MEINEN Vorstellungen zu gestalten. Heute weiß ich, dass meine Eltern mich tatsächlich so gut erzogen hatten, wie sie nur konnten. Sie hatten tatsächlich IHR Bestes gegeben.
Die ständige Sorge um das Wohlergehen meiner Eltern und das Pflichtgefühl ihnen gegenüber, die mich schon seit meiner frühen Kindheit belasteten, waren die ersten Schritte auf meinem Weg der Selbstverleugnung. Weitere boten sich an, als ich älter wurde und mich hie und da verliebte. Es waren IMMER unglückliche, weil stets nur platonische Beziehungen, die sich einerseits durch ungeheure Beständigkeit meiner »Liebe« (oft über Jahre, ganz unerwidert), andererseits durch grenzenlose, absolut unbegründete Hoffnung auszeichneten. Denn ich war es gewohnt, alles für die Liebe zu tun, aber nichts zu bekommen. Und zu warten, auch wenn ich dafür manchmal unsäglich leiden musste. So studierte ich bereits als Vierzehnjährige die Interessen und Bedürfnisse meines Auserwählten und machte sie zu meinen eigenen. Bei meiner ersten Liebe etwa wurde ich eine begeisterte Leichtathletin, die täglich drei bis vier Stunden trainierte, um dann später meinem »Objekt der Zuneigung« mit Erfolgen bei diversen Sportwettbewerben zu imponieren. Abgesehen davon, dass mir Sport ungemein gut tat, frage ich mich heute: »Hatte der junge Mann überhaupt bemerkt, dass ich ihn liebte?« Ich dachte, ich interessiere mich für Sport, in Wirklichkeit interessierte ich mich für diesen Jungen. Es war der Versuch, auch sein Herz durch Leistung zu erobern. (Ein paar Jahre später heiratete der junge Mann ein Mädchen, das gar nicht sportlich, sondern eher kugelrund war …)
Später nahm ich zwar von der platonischen Liebe Abstand, insgesamt betrachtet waren meine Partner jedoch eine Katastrophe. Je komplizierter, unreifer, untreuer, unverlässlicher, desto besser. Das war für mich eine echte, begrüßenswerte Herausforderung, diese Männer auf den »richtigen Weg« zu bringen. Ich liebte Herausforderungen, denn ihre Bewältigung gab mir das Recht auf meine Existenz. Leistung in jeder Lebenslage!
Durch diesen permanenten Leistungsdruck sank meine Fähigkeit, mich selbst zu spüren und zu fühlen, was ich selbst für meine gute Laune und mein eigenes Wohlergehen benötigte. Dafür aber wurden im Lauf der Jahre meine Sensoren für die Bedürfnisse anderer Menschen immer empfindlicher. Als ich meinen zweiten Mann heiratete, der sich als praktischer Arzt schon immer für ganzheitliche Medizin, Homöopathie und Akupunktur interessierte, merkte ich, ohne mich je selbst mit der Materie zu befassen, dass ich spüren und bestimmen konnte, welches homöopathische Mittel ein bestimmter Mensch braucht. Ich konnte sogar gestörte Punkte an seinem Körper spüren, die sozusagen nach einer Akupunkturnadel riefen. Es ist kein Scherz – ich wurde von meinem Mann auf diese Fähigkeit bei unseren sich freiwillig meldenden Familienangehörigen unzählige Male getestet und es klappte immer. Eine tolle Gabe, nicht wahr? Das einzige Problem war nur, dass ich zwar bei allen anderen Menschen sehen und spüren konnte, was sie brauchten und was ihnen fehlte, nicht aber bei mir selbst. Absolut symptomatisch, muss ich heute sagen, denn meine komplette und durch jahrelange Übung bis zur Meisterschaft gesteigerte Sensibilität war nach außen und nicht nach innen gerichtet – weg, ganz weit weg von mir.
Die diversen Botschaften, die mein Körper mir schon früh sendete – etwa eine monatelang leicht erhöhte Körpertemperatur in meinem zwanzigsten Lebensjahr, deren Ursache nie festgestellt werden konnte –, hielt ich für harmlos. Ansonsten hatte ich aber schon immer sehr viel für gesundes Leben übrig. Auf dem Land aufgewachsen, war ich gewohnt, qualitativ hochwertige Nahrung zu mir zu nehmen. Auch aß ich massenhaft Obst und Gemüse und versuchte, mich regelmäßig zu bewegen. In meiner Jugend mochte ich Sport und Bewegung auch dann, wenn ich nicht platonisch verliebt war. Je mehr ich mich aber dem Violinstudium, später den Musikwissenschaften sowie dem Beruf und meiner Familie widmete, desto weniger Zeit nahm ich mir für einen körperlichen Ausgleich. Einige Jahre konnte ich noch aus meinen Reserven schöpfen oder besser gesagt zehren, aber spätestens mit der Geburt meines Sohnes im Jahr 1987 geriet mein Körper aus dem Gleichgewicht.