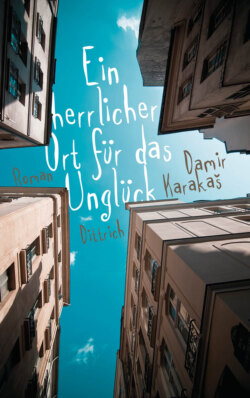Читать книгу Ein herrlicher Ort für das Unglück - Damir Karakaš - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.
ОглавлениеAm Freitagabend bin ich zur Performance »Souvenirs de Sarajevo« eines jungen bosnischen Künstlers in Paris eingeladen.
Ich mache mich direkt vom Pompidou auf den Weg zu dieser Galerie am Saint-Germain und überquere den Pont des Arts.
Der Himmel ist blutrot, beide Ufer der Seine sind überlaufen von Touristen, die laut singen, zu Tangoklängen tanzen, spielen, das Leben feiern. Die Brücke ist ebenfalls voller Touristen: Ein Typ hat einen Tisch angeschleppt, zwei Stühle, einen Kerzenständer und eine Kerze und hat ein Abendessen serviert. Am Tisch sitzen er im Frack und eine Frau in einem langen Spitzenkleid. Sie trinken Champagner aus langhalsigen Gläsern. Einige Clochards kommen mit ihren Plastikbechern dazu, es werden immer mehr, sie betteln um ein wenig Champagner.
Ich stehe einige Zeit an die Brüstung gelehnt dort und sehe dem beleuchteten Schiff zu, das unter der Brücke hindurchfährt, direkt durch meine gespreizten Beine. Es sieht so aus, als würde es gleich mit seinen Schornsteinen an meinen Hoden hängen bleiben.
Zehn Minuten später löse ich mich langsam von der Brücke.
Ich erreiche mein Ziel und treffe vor dem überfüllten Eingang der zweistöckigen Galerie Šejla, die in der bosnischen Botschaft in Paris arbeitet.
Sie war es, die mir vor ein paar Tagen die E-Mail-Einladung zu dieser Performance geschickt hat.
»Na, du Schriftsteller«, sagt sie, während sie gerade eine SMS an irgendjemanden schreibt. »Was gibt’s Neues?«
Ich nicke und lächle und sage: »Alles okay.«
Sie wirft das Haar zurück, das wie ein Wasserfall auf ihren Rücken fällt, klappt ihr Handy zu und macht mich mit ihrer Freundin Ana bekannt.
Dann klingelt ihr zweites Handy.
»Geht schon mal rein«, sagt Šejla, »ich komme gleich nach.«
»Na dann«, sagt Ana und balanciert dabei auf einer Ferse.
Sie schiebt die Zigarette, die sie sich gerade anzünden wollte, zurück in die Packung und gibt mir mit dem Kopf ein Zeichen, dass wir hineingehen sollen.
Nachdem wir gemeinsam die fünfminütige Performance verfolgt haben, in der der Künstler vollständig nackt, nur mit einem Helm auf dem Kopf, um einen Globus läuft und wie ein Mantra laut wiederholt: »Sarajevo, Sarajevo«, während an der Wand wechselnde Aufnahmen der unter Granatbeschuss liegenden Stadt zu sehen sind, frage ich Ana, wie es ihr gefallen hat.
»Leichenfledderei«, sagt sie. »So sollte die Performance heißen.«
»Wie gefährlich du bist«, lächle ich.
»Überhaupt nicht«, sagt sie, »und außerdem ist die Performance schon an sich schlecht.«
»Vielleicht haben wir sie nicht kapiert.«
Sie sagt: »Du vielleicht nicht.«
Ich lache. »Du ärgerst dich über irgendetwas?«
»Keineswegs«, sagt sie. »Es geht mir nur auf die Nerven, dass man heutzutage einen Scheißhaufen in die Ecke setzen und das Ganze dann als hohe Kunst verkaufen kann.«
Ich zucke mit den Schultern.
»Außerdem hat er einen kleinen Pimmel«, sagt sie.
»Oho«, sage ich.
Sie lächelt.
»Was soll’s. Ich bin doch nur ehrlich.«
Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und schaue mich in der Runde um.
»Wenn es was Gutes zu trinken gibt, werden wir ihm verzeihen«, sage ich. »Was willst du?«
Sie fährt sich mit den Fingern durch ihr kurzes Haar, das von grauen Strähnen durchzogen ist: »Rotwein vielleicht?«
Ich nicke und beginne, mich mit der Schulter zu dem Tisch durchzukämpfen, auf dem die Getränke stehen. Dann entdecke ich Šejla mit einem langhaarigen Typen in einem Anzug. Ich will ihr zuwinken, aber sie steht mit dem Rücken zu mir und ich gebe es auf.
Im nächsten Augenblick freut es mich, dass sie mich nicht gesehen hat. Jetzt wirkt es sicher so, als wollte ich über sie lästern, aber Šejla kann wirklich unglaublich nervig sein, vor allem dann, wenn sie ein wenig getrunken hat.
Ich sehe noch einige Bekannte, die aus dem ehemaligen gemeinsamen Staat stammen und die ich am selben Ort kennengelernt habe wie Šejla – bei den Rundek-Konzerten im Club Les Voutes im 13. Arrondissement. Dort pflegt sich die Clique aus dem ehemaligen Jugoslawien zu versammeln, Menschen aller Nationalitäten, man singt, man tanzt, Ćevapčići werden gegrillt, man hat den Eindruck, zu Hause zu sein und nicht im Herzen von Paris.
Ich meide alle Balkan-Cliquen, die sich im Ausland auf nationaler Grundlage versammeln; bevor sie die Kirche betreten, lassen sie ihre Pistolen und Messer im Vorraum zurück, und nach dem Gottesdienst stecken sie sie wieder in den Gürtel, so ungefähr kommen sie mir vor.
»Und wie läuft es so in Paris?«, fragt mich Ana, als ich mit dem Wein zurückkomme. Ich habe die Gläser auf meinem Weg hoch über dem Kopf halten müssen.
Ich sage: »Super.«
Sie lebt in Orléans, einem Städtchen, das mit dem RER in einer Stunde zu erreichen ist.
Sie ist in Zagreb geboren, ihr Mann kommt aus Istrien.
Sie sagt, dass sie vor dem Krieg ein Studium der Malerei an der Zagreber Akademie für Bildende Kunst abgeschlossen hat. Als der Krieg begann, ist sie mit ihrem Mann – einem Theaterregisseur – zuerst nach Paris und dann nach Orléans gegangen.
Sie sagt, dass sich keiner von beiden mehr mit Kunst beschäftigt. Er ist Unternehmer, sie kümmert sich um die Kinder, kocht, lernt mit ihnen, genießt das Leben.
Sie trinkt einen Schluck Wein und blickt über den Glasrand.
»Kinder sind das Schönste im Leben.« Für einen Moment verliert sie sich in ihren Gedanken.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und trinke meinen Wein. Kinder interessieren mich nicht die Bohne, auch Häuser nicht oder eine Familie.
Ich bin vielleicht nicht normal, aber wenn ich Familienhäuser mit ordentlich gemähtem Rasen sehe, verstreut herumliegendes Kinderspielzeug aus Plastik und einen Grillplatz, überkommt mich ein panikartiges Gefühl.
»Und du bist Schriftsteller?«, fragt sie.
»Ja«, sage ich.
»Ich habe nichts von dir gelesen.«
»In Kroatien kannst du in jeder besseren Buchhandlung etwas von mir finden«, sage ich.
»Ich werde in Zagreb etwas kaufen«, sagt sie. »Ist etwas ins Französische übersetzt worden?«
»Bald«, sage ich.
»Und das?« Sie zeigt auf meine Tasche, aus der der Zeichenblock hervorlugt.
»Ich zeichne«, sage ich.
»Du zeichnest?« Sie sieht mich an. »Was zeichnest du denn so?«
»Karikaturen für Touristen.«
Sie lacht, sieht mich wieder an und sagt: »Entschuldigung.«
Dann fragt sie: »Und wie läuft das?«
»Je nachdem«, sage ich. »Das mache ich nur vorübergehend.« Ich trinke meinen Wein aus.
»Ich habe das auch ein paar Wochen lang gemacht«, sagt sie. »Vor allem Portraits.«
»Und wie lief es?«
»Für mich war es Zeitverschwendung. Ist Tito noch da?«
»Welcher Tito?«
»Er bindet sich ein schwarzes Tuch um die Augen und zeichnet ein Portrait von Che Guevara. Er sieht alles durch das Tuch«, sagt sie lächelnd.
»So einen Typen habe ich bislang nicht gesehen.«
»Ein Argentinier, ganz sympathisch.«
Wir schweigen, trinken Wein, und ich habe das Gefühl, dass noch etwas gesagt werden müsste.
Mir fällt nichts Besseres ein, also sage ich: »Es ist besser zu zeichnen, als Kartoffeln zu schälen.«
»Lass uns hier weggehen«, sagt Ana plötzlich, »diese Snobs gehen mir auf die Nerven.«
Wir gehen zu Šejla, die immer noch mit dem langhaarigen Typen spricht.
»Wir gehen ins Café gegenüber«, sagt Ana zu ihr. »Du kannst ja nachkommen.«
»Wir sehen uns dort«, sagt Šejla.
Wir gehen rüber ins Café, in dem eine riesige Wanduhr rückwärts läuft.
Ich denke zuerst, das sei ein Fehler, aber der freundliche Kellner erklärt mir, dass das eigentlich die Attraktion dieses Lokals ist. Wir bestellen eine Flasche Bordeaux und trinken sie ziemlich schnell aus. Nachdem wir noch eine zweite Flasche geleert haben, holt Ana einen Fotoapparat aus ihrem Täschchen.
Sie hantiert kurz daran herum und reicht ihn dann mir.
Ich nehme den Fotoapparat und betrachte auf dem Display einen starken Mann in einem silbernen Trainingsanzug und zwei Jungen neben ihm in genau den gleichen Trainingsanzügen. Die Kinder lachen und halten sich gegenseitig Hasenohren hinter den Kopf.
»Mein Mann und meine beiden Söhne«, sagt sie.
»Sie sehen nett aus«, sage ich.
»Filip, der größere, spielt ganz toll Gitarre. Marko ist sehr sprachbegabt, er ist erst fünfzehn und spricht schon Kroatisch, Englisch, Französisch und Italienisch.«
Ihr Handy klingelt, sie meldet sich und sieht dabei über meinen Kopf hinweg.
»Šejla«, sagt sie. »Sie musste woandershin.«
Wir stehen noch zwei Stunden lang an der Theke, aus dem Lautsprecher kommt Zigeunermusik, ein paar Leute beginnen zu tanzen und auch wir fangen an, unsere Körper zu bewegen. Wir trinken und tanzen, die Zigeunertrompeter beschleunigen den Rhythmus. Etwas später umarmt mich Ana und beginnt zu tanzen. Meine Füße stolpern über ihre, beinahe falle ich hin.
»Du bist nicht gerade ein begnadeter Tänzer«, lacht sie.
Sie lässt mich plötzlich los, hüpft im Rhythmus der in Fahrt gekommenen Bläser herum, hebt ihren roten Rock und zeigt im Tanz entflammt ihre langen, weißen Beine mit kräftigen Waden. Sie umarmt mich wieder: Wir küssen uns. Nach zehn Minuten flüstere ich ihr, während sie in dem Gedränge gleichzeitig tanzt, sich an mir reibt und Jack Daniel’s trinkt, ins Ohr: »Lass uns in die Toilette gehen.«
Wir gehen in die Herrentoilette, da die für Damen besetzt ist, und schließen die Tür ab. Ich greife ihr an die Titten, küsse sie auf den Hals. Irgendjemand will unbedingt aufs Klo. Er beginnt, wild zu klopfen, gibt nicht auf, und wir schlängeln uns an diesem besoffenen Idioten vorbei, der sich kaum auf den Beinen halten kann, und gehen zur Theke zurück.
Wir widmen uns wieder unseren Getränken. Doch schon nach dem ersten Schluck schlägt Ana vor, dass wir mit einem Taxi zu Šejlas Appartement am Odeon fahren sollten. »Ich habe ihren Schlüssel«, sagt sie. »Sie wird heute Abend nicht dort schlafen.«