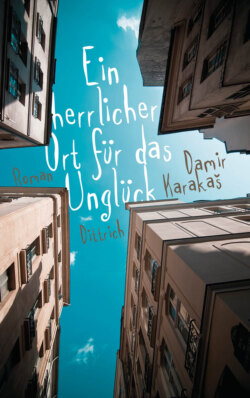Читать книгу Ein herrlicher Ort für das Unglück - Damir Karakaš - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеRöhren aus durchsichtigem Plexiglas, durch die Rolltreppen voller Touristen fahren, rote, senkrechte Röhren, durch die Aufzüge voller Touristen fahren, blaue Röhren, bunte Röhren; der Glaskubus, der den zentralen Teil des Centre Georges Pompidou bildet, reflektiert die Sonne: als würde ich durch ein Kaleidoskop schauen.
Die Touristen quellen von überall her darauf zu, vor allem aus Richtung Les Halles. Es ist ein ununterbrochenes Strömen auf den schrägen Platz Pompidou.
Er ist der einzige Ort in Paris, an dem man frei zeichnen, spielen, jonglieren, vor den Touristen Rasierklingen schlucken und noch allerlei andere Kunststücke vorführen kann … Ich stehe vor zwei zusammenfaltbaren Anglerstühlen und versuche einen Touristen zu erwischen, um eine Karikatur von ihm zu zeichnen.
Ununterbrochen lasse ich den Blick über die Menge schweifen, doch irgendwann breite ich ohnmächtig die Arme aus.
Das Problem besteht darin, dass vor mir schon eine Unmenge von Zeichnern versucht hat, die Touristen zu bearbeiten. Das Problem ist mein beschissener Standort. Ich locke sie von der Mitte des Platzes aus an, doch um mich herum ist alles besetzt, es wimmelt von gierigen Zeichnern.
»Hey, mein Herr!« Ich laufe hinter einem rüstigen, alten Mann her. »Wollen Sie eine Karikatur?«
Er bleibt stehen, wechselt die Brille und betrachtet wie ein versierter Kunstsammler Monsieur Allen.
»Nicht schlecht«, sagt er. »Gar nicht schlecht.«
Seinem Akzent nach vermute ich, dass er Franzose ist.
»Möchten Sie, dass ich auch Sie zeichne?«, frage ich.
»Ich habe keine Zeit«, sagt er freundlich und lächelt.
»Das mache ich in fünf Minuten im Stehen!« Ich laufe neben ihm her und beginne zu zeichnen.
Er sieht mich an, seufzt tief auf und wartet, bis ich mit dem Zeichnen fertig bin. Erneut setzt er die Brille auf, durch die er Woody betrachtet hat, und lächelt. »Arbeiten Sie auch in Farbe?«
Ich taste in meiner Tasche nach einem Päckchen mit Farbstiften. Eigentlich arbeite ich nicht in Farbe, es dauert zu lange, vor allem, wenn man das Gesicht, die Augen und die Hände farbig gestalten muss, was ziemlich kompliziert ist. Doch wenn jemand darauf besteht, kann ich problemlos seinen Mantel, seine Schuhe, seinen Hut und seine Krawatte einfärben, das wird dann etwas teurer. »Ja«, sage ich. »Aber dann wird es teurer.«
»Und was kostet Schwarzweiß?«, fragt er.
»Fünfzehn Euro«, sage ich.
»Ich will es nicht«, sagt er und reicht mir die Karikatur.
»Gut.« Ich laufe hinter ihm her. »Wie viel geben Sie?«
»Lassen Sie es gut sein, ich habe doch gesagt, ich will nicht.«
»Geht es für zehn? Für sieben?«
Er bleibt stehen, zieht zehn Euro aus der Tasche, reicht mir das Geld und nimmt die Karikatur.
Dann sagt er: »Nur weil ich selbst auch Karikaturen zeichne.«
Ich habe ihn nie gesehen, weder hier noch bei Notre Dame. Ich habe von einigen Franzosen gehört, die auf dem Place du Tertre auf dem Montmartre Portraits und Karikaturen zeichnen, aber dort braucht man eine Erlaubnis, die teuer bezahlt wird. Also frage ich ihn: »Und wo zeichnen Sie?«
Er sagt ein wenig verärgert »Au revoir« und geht.
In den folgenden zwei Stunden zeichne ich nur noch eine weitere Karikatur und verdiene zehn Euro.
Manchmal gebe ich sie auch für fünf Euro ab, manchmal gebe ich sie aus Prinzip nicht ab. Wenn jemand unverschämt oder geizig ist, zerreiße ich sie lieber, als sie für ein paar Euro herzugeben.
Manchmal passiert es auch, dass die Touristen die Karikatur nicht haben wollen, weil sie nicht zufrieden sind.
Das bringt mich immer wieder zur Verzweiflung; während man zeichnet, rechnet man schon damit, sich die Kohle in die Tasche zu stopfen, und dann ist es eine Niete. Letzte Woche habe ich an dieser Stelle hundertsiebzig Euro verdient.
Alles hängt vom Tag ab und vom Glück, aber am wichtigsten ist und bleibt der Standort. Wenn ich an einem schlechten Standort an einem Tag hundert Euro verdiene, hätte ich an demselben Tag an einem besseren Ort das Doppelte verdient.
Was das Zeichnen betrifft, so ist es nicht nötig, besonders gut zu sein. Ich habe als Kind schon viel gezeichnet, gemalt und kleine Skulpturen aus Holz geschnitzt. Mein Großvater sagte mir, ich solle den Bleistift nicht abnutzen, denn er diene zum Schreiben; mein Vater wies mich an, die Dachrinnen und Zäune zu streichen, damit ich irgendwie von Nutzen sei. Es störte ihn vor allem, dass mir der Bleistift lieber war als irgendwelche landwirtschaftlichen Gerätschaften. Mein Vater wiederholte ständig: »Aus dem wird nie was.«
Eine Zeitlang hängte ich meine Bilder an die Bäume im Wald.
Das waren meine ersten Ausstellungen.
Danach begann ich Karikaturen zu zeichnen.
Schon zu meiner Schulzeit veröffentlichte ich sie in Zeitungen. Bei der ersten, die in einer Sportzeitung erschien, zeichnete ich einige Läufer auf der Bahn: Der vierte rannte und dachte an Geld, der dritte rannte und dachte an Frauen, der zweite rannte und dachte an die Goldmedaille, doch der erste, der schon weit vorne lag und kurz vor dem Ziel war, dachte nur daran, wie er möglichst schnell auf die Toilette kommen würde.
Der Typ kreist hartnäckig wie eine Schmeißfliege um den Haupteingang des Pompidou: Anzug, Krawatte, am Hals eine lange Narbe. Einige meinen, dass in seinem Land (niemand weiß, wo er herkommt) jemand versucht hat, ihn abzuschlachten; andere dagegen meinen, dass er vor langer Zeit in seinem Land dem Galgen entflohen ist und dass die dunkelrote Narbe daher stammt.
Wie auch immer, der Typ mit der Narbe steht vor zwei Klappstühlen: Er hält seine Zeichenutensilien in der Hand und pafft eine Pfeife. Aber er kann gar nicht zeichnen, und sein Standort ist nicht gut – wenn die Touristen das Pompidou verlassen, wo sie gerade eine erstklassige Ausstellung gesehen haben, dann würden sie es begrüßen, wenn sie von Kokoschka oder Klimt persönlich gezeichnet würden.
Der Typ vor dem Pompidou hat erstaunlicherweise dennoch Erfolg.
Er spricht Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.
Sein Künstlername ist Coca-Cola.
Wenn er sich einen Kunden schnappt, ruft er schnell einen der Zeichner herbei, die gerade frei sind. Später teilen sie dann das Geld.
»Croate!«, ruft er mich.
»Ich komme gleich«, antworte ich, während ich auf einen Schwarzen mit Safarihut einrede.
Der Schwarze ist misstrauisch, er überlegt noch.
Er fragt mich: »Wie viel?«
»Setzen Sie sich.« Ich zeige auf den Stuhl.
»Croate«, ruft Coca-Cola ungeduldig.
»Ich kaufe noch schnell etwas in der Stadt und komme dann wieder«, sagt der Schwarze. Ich reiße ihm den Woody aus der Hand und eile zu Coca-Cola; einmal habe ich schon für ihn gezeichnet.
»Ein großer Künstler!« Coca-Cola zeigt auf mich und bereitet den Stuhl für mich vor.
Er presst die Fingerkuppen seiner beiden Hände gegeneinander und steht ein wenig abseits, mit einem todernsten Gesichtsausdruck, so als erwarte er ein großes Kunstwerk, das die Welt verändern wird.
Auf dem Stuhl mir gegenüber sitzt eine Engländerin voller Sommersprossen. Sie hat eine riesengroße Nase.
Wenn Frauen eine große Nase haben, muss man sie en face zeichnen, damit ihre Nase nicht zu sehr zum Ausdruck kommt.
Bei Frauen muss man außerdem unbedingt auf Falten achten und sie überall geschickt minimieren, die Augen hingegen müssen größer gemacht werden. Die Touristen lieben es, wenn man ihnen große Augen verpasst. Es ist wünschenswert, die Kommunikation mit den Klienten während des Zeichnens nicht abreißen zu lassen und in diesen fünf bis zehn Minuten zu versuchen, die größtmögliche Nähe herzustellen. Steht die Familie daneben: »Sie haben eine wunderbare Familie.«
Sitzt auf dem Stuhl ein Kind: »Man kann bereits erkennen, dass aus Ihrem Kind ein guter Mensch wird.«
Manchmal ist es ratsam, ein wenig zu scherzen: »Wenn Sie die Karikatur Ihrer Frau zeigen, wird sie denken, es ist Mick Jagger, hahaha.«
Mit Frauen Scherze zu machen, ist nicht empfehlenswert; Männer sind empfindlich, wenn es um ihren Penis geht, Frauen bei allem. Wenn Coca-Cola eine Karikatur von einer Frau zeichnet, ist er immer todernst. Gelegentlich sagt er einer alten Schabracke voller Bewunderung: »Oh la la, was für ein interessantes Gesicht!« Außerdem mögen Frauen keine Karikaturen, sie wollen vor allem Portraits.
Die Engländerin ist zufrieden.
Coca-Cola schafft es auch, ihre Freundin zu überreden. Auf eine vornehme Art, die gar nicht zu ihm passt, weist er auf den Stuhl und begleitet jedes Wort mit einem bedeutungsvollen Hochziehen der Augenbrauen.
»Ein neuer Picasso«, lobt er mich wieder. Ich nehme einen neuen Kohlestift in die Hand, weil der alte so kurz geworden ist, dass ich ihn nicht mehr gut führen kann. Auch die zweite Engländerin treffe ich ganz passabel. Beide habe ich hergerichtet wie ein Schönheitschirurg.
Coca-Cola klopft mir auf die Schulter und gibt mir die Hälfte des Geldes.
Hier auf dem Pompidou verdienen nur die Pakistani besser als Coca-Cola.
Aber sie haben auch die mit Abstand besten Standorte: neben dem riesigen, weißen Abluftrohr. Da ist der Hals des Platzes, da beginnt die erste Reihe. Aber nicht jeder darf an diesem Standort zeichnen: Man muss Pakistani sein, und man muss dem Boss, der diese Standorte verteilt, die Hälfte des Geldes geben.
Taucht ein Eindringling auf, kann er sich leicht ein Messer im Rücken einfangen.
Wenn in Paris die Sonne aufgeht, nehmen gleich nach den Pakistani Zeichner aus Russland und der Ukraine ihre Stellungen ein – die sie vermutlich von jemandem aus der Zeit der Oktoberrevolution geerbt haben. Und dann verteidigen sie die Stellungen mit ihrem Leben. Man weiß genau, wo wer steht, wo die Abdrücke der Stühle zu finden sind, man kennt jeden Zentimeter, ja sogar Millimeter, und wenn sich jemand hier breitzumachen versucht, helfen auch die Pakistani, den Eindringling zu vertreiben. Ihnen passt es am wenigsten, wenn sich die Spielregeln ändern.
In der dritten Abteilung mischen sich Chinesen unter alle anderen Karikaturen- und Portraitmaler.
Ich liege unter dem Baum, der aus dem Beton wächst.
Mit hinter dem Kopf verschränkten Armen höre ich dem Georgier Shota zu, der auf der Ziehharmonika »Podmoskovnye vechera« spielt. Er hat unglaublich lange Finger und kann seine Ziehharmonika sogar auf dem Rücken spielen. Das ist für die Touristen eine besondere Attraktion. Jetzt spielt er gerade auf dem Rücken, die Touristen hören ihm voller Bewunderung zu und lassen sich mit ihm fotografieren. Shota verdient das meiste Geld mit diesen Fotos.
Er beendet sein Spiel und setzt sich mit verschwitztem Gesicht neben mich.
»Hast du eine Wohnung gefunden?«, fragt er mich auf Englisch und stellt den karierten Koffer ab, in dem die Geldstücke lustig klimpern.
Ich sage: »Ja, habe ich … Bei Hristo.«
»Ich habe die alte Frau gefragt, aber es war schon vermietet«, sagt Shota.
»Jetzt bin ich erst mal bei Hristo«, sage ich, »und dann sehe ich weiter.«
Shota wohnt kostenlos bei einem Cousin, der in der zweiten französischen Liga Rugby spielt.
»Einige werfen mir immer noch Francs in den Koffer«, sagt er, während er ein Geldstück hochhält und betrachtet.
Er greift in den Koffer, man hört das Geld klimpern, dann lässt er es durch die Finger rieseln. Er zählt seine Einnahmen: siebenundfünfzig Euro in Münzen, fünfzehn Euro in Banknoten, eine Creme zur Entfernung von Make-up und fünf Zigaretten.
»Willst du die Creme haben?«, fragt er mich.
Ich frage zurück: »Was soll ich damit?«
Er legt sie neben einen Papierkorb.
Dann fragt er mich: »Willst du eine Zigarette?«
Ich nehme eine und stecke sie mir hinter das Ohr. Vielleicht kann sie ja irgendjemand gebrauchen.
»Stell dir vor«, sagt Shota, »heute Morgen hat mir ein Holländer ein Päckchen Gras in den Koffer geworfen, fein säuberlich verpackt, stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn die Polizei das in meinem Koffer gefunden hätte.«
»Und was hast du damit gemacht?«
»Weggeworfen. Ich bin zum nächsten Papierkorb gelaufen und habe es weggeworfen.«
Ich sage: »Hm.«
Obwohl ich wirklich selten einen Joint rauche, tut mir es doch leid, dass dieses Gras im Papierkorb gelandet ist. Vermutlich war es gut.
»Schade.«
Er schaut mich an.
»Lass gut sein«, sagt er, »das hätte echt Probleme geben können.«
Dann zieht er seinen Geldbeutel heraus und verstaut die Banknoten darin. Für einen Moment holt er ein Farbfoto mit einem Mädchen mit langen, schwarzen, glatten Haaren aus dem Beutel. Sie heißt Kathaven. Im letzten Monat ist Shota durch die Straßen von Paris gestreift und hat von jedem verlangt, in seiner jeweiligen Sprache aufzuschreiben: Ich liebe dich, Kathaven. Ich habe es auf Kroatisch geschrieben. Er hat »Ich liebe dich, Kathaven« in siebenunddreißig Sprachen zusammenbekommen, und das hat er ihr dann nach Tiflis geschickt. Sie war angeblich völlig hin und weg.
»Gib Hristo diese zwanzig Euro«, sagt er. »Soviel schulde ich ihm, und du wirst ihn vor mir treffen.«
Ich verstaue die Geldstücke in meiner Tasche.
»Ich gehe jetzt ein wenig am Saint-Germain spielen«, sagt Shota.
Mit einem Schulterklopfen verabschiedet er sich von mir.
Shota ist eine Art Freund, so könnte man es nennen. Wir unternehmen nichts gemeinsam, wir treffen uns nur manchmal auf der Straße. Viele gemeinsame Themen haben wir nicht, aber es freut mich immer, ihn zu treffen. Wäre ich allerdings in Kroatien, würde ich mit der Mehrheit der Menschen, mit denen ich hier in Paris befreundet bin, kein einziges Wort wechseln, von Freundschaft ganz zu schweigen. Aber um es klar zu sagen – ich habe auch in Kroatien nicht viele Freunde. Es wird immer dunkler, nur noch ein paar chinesische Zeichner sind da. Sie haben sich in dem Lichtschein versammelt, der durch die riesigen Fenster des Pompidou fällt. Ich stehe auf und gehe rein, zur Toilette. Ein Geschäftsmann in Anzug und Krawatte und mit Laptop steht vor dem Spiegel, gibt sich selbst Ohrfeigen und weint gedämpft vor sich hin.
Ich pinkle und beobachte ihn: Er hat seinen Kopf in die Hände gelegt und schluchzt immer mehr.
Ich schüttle meinen Schwanz ab, wasche mir die Hände und sage: »Mein Herr, kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
Er zuckt zusammen, als erwache er aus einem hässlichen Traum, taxiert mich von Kopf bis Fuß und sagt: »Kümmere dich um deinen eigenen Kram, du Penner.«
Er wäscht sich schnell das Gesicht, schnappt seinen Laptop und schaut mich noch einmal voller Verachtung an.
»Du kannst mich mal«, sage ich auf Kroatisch, während er die Toilette verlässt.
Dann stelle ich mich vor den Spiegel und sehe mich genauer an. Dieses »Penner« hat mich getroffen, ich gebe es zu.
Warum hat er mich Penner genannt?
Ich bin rasiert, meine Kleidung ist sauber.
Ich rieche an meinem Ärmel und an meinen Achseln, um zu prüfen, ob ich stinke, aber ich stinke nicht. Vielleicht hat mich dieser Idiot draußen dabei gesehen, wie ich den Touristen nachlaufe. Für ihn sind wahrscheinlich alle solchen Menschen Penner. Vielleicht bin ich auch hinter ihm hergelaufen, wer soll sich schon daran erinnern. Ich gehe zurück vor den Eingang des Pompidou.
Unter einem starken Lichtstrahl beendet der langhaarige Chinese Pong gerade die Karikatur eines kleinen Amerikaners. Etwas abseits steht wie versteinert der Vater des Jungen. Pong kann nämlich gar nicht zeichnen. In dem Moment, in dem der Vater darüber nachzudenken beginnt, ob er seinen Sohn vom Stuhl fortziehen soll, ist etwas fertig, was doch wie eine Karikatur des Jungen aussieht.
Während der Amerikaner immer noch zögert, zieht Pong seinen stärksten Trumpf aus dem Ärmel. Über den Kopf des Kindes auf der Zeichnung setzt er eine Sprechblase und schreibt hinein: »PAPA, ICH HAB DICH LIEB!«