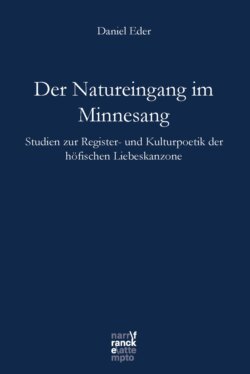Читать книгу Der Natureingang im Minnesang - Daniel Eder - Страница 10
2 Das Kriterium der Faktizitäts- und Aktualitätssuggestion
ОглавлениеEs ist ferner zu betonen, dass die in einem so gefassten Natureingang für die aufgerufene Jahreszeit als kennzeichnend dargestellten Naturdetails bzw. deren Fehlen als momentan gültige Aussage stilisiert, ja imaginativ auf einen (textinternen) Entwurf von Außenwelt bezogen sein müssen, so dass der saisonale Wandel vom Rezipienten als präsentisch und faktisch ablaufend zu konzeptualisieren ist. Denn es zeigen gerade die bisweilen begegnenden, freilich jedoch extremen Beispiele einer metaphorischen Umlenkung des Natureingangs, die die suggestive Präsentik bzw. Faktualität des Jahreszeitengeschehens durch Verschiebung der Aussagenreferenz etwa auf die Liebesthematik hin unterlaufen bis völlig destruieren, dass dadurch elaborierte Transformationsformen der Topik entstehen, die diese zwar assoziativ aufrufen, allerdings nicht mehr in deren engeren Bereich selbst einzuordnen sind. Freilich lassen sich bei diesem Kriterium jedoch eher fließende Übergänge zwischen Topik und Transformationsform festhalten, die beim konkreten Einzeltext die Beantwortung der Frage, ob durch die Natur- und Jahreszeitenallusion noch auf ein als präsentisch ablaufendes imaginiertes Geschehen abgezielt wird, schwer bzw. allenfalls graduell bestimmbar machen.
Auf derartige komplizierte Beispiele etwa im Liedœuvre Frauenlobs lenkt besonders die Arbeit von Susanne KÖBELE den Blick, die schon in ihrem Kriterienkatalog zum Natureingang als 5. Punkt unter «Zeichenstatus» mit «Vergleich, Metapher, Allegorie, Personifikation, Metonymie (evtl. geistliche Konnotationen: Naturallegorese, Vergänglichkeitsklage)»1 poetische Verfahrensweisen anführt, die wie etwa der Vergleich oder die Metapher zweifellos in vielen Natureingängen eingesetzt werden, aber bei konsequenter Anwendung die vordergründige Jahreszeitenschilderung statual durchaus prekär werden, ja bisweilen komplett ins uneigentliche Sprechen kippen lassen können. Ab einem gewissen Grad der Anwendung der obigen Mittel muss somit das auf der litteralen Bedeutungsebene zunächst präsente Jahreszeitengeschehen vom Rezipienten gar nicht mehr als suggestiv faktisch ablaufend begriffen werden, im Gegenteil, es wird ein solches Verständnis oft durch Irritationsstrategien wie z.B. nachgeschobene Metaphorisierung bewusst desavouiert. Es ist also zu fragen, wann das Resultat solcher Verfahrensweisen dann keinen Natureingang im engeren Sinne mehr darstellt, sondern allenfalls noch eine Transformationsform des Topos. Ein in dieser Hinsicht besonders kunstvolles, weil weitgetriebenes Beispiel präsentiert KÖBELE im weiteren Verlauf ihrer Studie mit Frauenlobs Lied 4 (GA XIV, 16–20), das wie folgt beginnt2:
GA, Str. XIV,16Frauenlob (Heinrich von Meißen)Lied 4
| F1 374F2 257 | Ahi, wie blüt der anger miner ougen,den ich für alle ougenweide han erkorn.Ir fire ist geboten sunder lougendem herzen und den sinnen min für allen zorn.Ja muz ich sunder riuwe sin,swenne ich an sihe die rosen und der liljen schin,der ab ir liechten wangen durch die ougen mingewaltiglichen brehetunde drehetzu dem herzen: ‹la mich in!› |
[Hei, wie blüht der Anger – meiner Augen3,
den ich mir als jede Augenweide übertreffend erwählt habe.
Sie zu feiern, das steht ohne Zweifel
meinem Herzen und meinen Sinnen besser an als etwaige Empörung.
Wahrlich, ich soll frei von Schmerz4 sein,
immer wenn ich die Rosen und den Lilienglanz betrachte,
der von ihren leuchtenden Wangen durch meine Augen
machtvoll strahlt
und zum Herzen wirbelt5: ‹Lass mich ein!›.]
Hier wird also in V. 1 mit der Bezugnahme auf den blühenden Anger anfangs, auch wenn die Jahreszeitennennung nicht erfolgt, kurz ein ‹faktischer› Natureingang angetäuscht, bevor darauf durch das nachgeschobene Genitivattribut miner ougen dieser plötzlich irritativ metaphorisiert wird.6 Ja es ist zunächst gar nicht klar, worauf sich dieser anger miner ougen, eine «Metapher in absentia»7, wie es KÖBELE nennt, überhaupt bezieht. Um der Frage nachzugehen, wie diese vom Rezipienten im Strophenverlauf jeweils unterschiedlich konnotativ gefüllt werden mag, bis sie sich mehr oder weniger deutlich auflöst (s. unten), soll hier die Textpassage kurz sukzessive weiter durchschritten werden.
In V. 2 wird dann nämlich mit ougenweide noch eine weitere nicht einfach zu füllende Metapher aufgegriffen, die in Frauenlobs Liedern mehrfach im Umfeld von Natureingangsallusionen auftritt, dabei jedoch meist recht deutlich auf die Geliebte bezogen ist.8Frauenlob (Heinrich von Meißen)Lied 2Frauenlob (Heinrich von Meißen)Lied 3Frauenlob (Heinrich von Meißen)Lied 5Frauenlob (Heinrich von Meißen)Lied 6 Hier in Lied 4 scheint dies aber offensichtlich nicht der Fall zu sein, weswegen zum Konnotationshintergrund des Begriffs doch wohl einige weiterführende Überlegungen anzustellen sind.9
Will man das für Frauenlob verfügbare Bedeutungspotenzial von ougenweide bestimmen, so wäre zunächst darauf hinzuweisen, dass es sich in der Minnesangtradition bei dieser Metapher zum einen um einen relativ typischen Natureingangs-Terminus handelt.10ReinmarMF 167,31 In diesem Zusammenhang wäre sicherlich Gottfried von Neifen anzuführen, auf dessen vokabulatorische Anregungswirkung für Frauenlob SUSANNE KÖBELE schon im Fall von Lied 2Frauenlob (Heinrich von Meißen)Lied 2 verwiesen hat11; bei diesem heißt es etwa in Lied KLD 15, XVGottfried von NeifenKLD 15, XV in einem Wintereingang: Nv schowent, wie dú heide / mit liehter ovgenweide / sint verdorben vnd der cleinen voglin sank (I,1–3)12, und in Lied KLD 15, XXGottfried von NeifenKLD 15, XX in einem Sommereingang: Seht an die heide, / seht an den gruenen walt: / liehter ovgenweide / der hant si gewalt (I,1–4). Eine ausdrückliche Nennung des von Frauenlobs Lied 4 gleich zu Beginn als scheinbarer Naturraum aufgerufenen anger im Zusammenhang mit ougenweide zeigen darüber hinaus etwa Ulrichs von Winterstetten Lied KLD 59, XIIUlrich von WinterstettenKLD 59, XII für den Wintereingang, wo es heißt: o we, wunneklicher ovgenweide / die man sach vf anger vnde uf heide (I,7f.)13, und für den Sommereingang Lied SMS 19,5 Des von TrostbergDes von TrostbergSMS 19,5: Nu stât bekleit diu heide / mit wunneklicher wât: / sî ist worden vrî vor leide. / mit liehter ougenweide / manig anger schône stât (I,9–13)14. Für die Frage nach dem Konnotationspotenzial des Begriffs ougenweide in Frauenlobs Lied 4 scheinen mir aber gerade auch die Natureingänge Neidharts, besonders die der Sommerlieder, bedeutsam zu sein, wo eben die beim Liedeingang von Lied 4 konnotativ mitlaufende, in der Minnesangtradition besonders häufig zu findende Assoziativkette ‹Heide (auch: anger, wise, velt) – ougenweide – Blumen (Rosen) – Glanz›15 schon deutlich vorgeprägt ist16NeidhartSL 2/SNE I: C Str. 222–226NeidhartSL 15/SNE I: R 22NeidhartSL 20/SNE I: R 48NeidhartSL 21/SNE I: R 51, so etwa beispielhaft im Natureingang von SL 22 (SNE I: R 52NeidhartSL 22/SNE I: R 52): nu ist diu wis mit blumen wol gæmenget / mit liehter ougenweide / rosen ouf der heide / durch ir glancz (R II,2–6).17Gottfried von NeifenKLD 15, XXNeidhartSL 14/SNE I: R 15NeidhartSL 23/SNE I: R 53NeidhartWL 26/SNE I: R 4Leuthold von SevenKLD 35, IFriedrich der KnechtKLD 11, IVDer MarnerLied 5 (Willms)Der TannhäuserLied VII (Cammarota)Der TannhäuserLied XV (Cammarota)Ulrich von WinterstettenKLD 59, XXUlrich von WinterstettenKLD 59, XXXIIIDer von WildonieKLD 66, IBrunwart von OugheinKLD 4, IDer KanzlerKLD 28, IXKonrad von LandeckSMS 16,12Graf Kraft von ToggenburgSMS 1,4Hadloub, JohannesSMS 30,25 Vor diesem Hintergrund wäre es also durchaus denkbar, dass in Frauenlobs Lied 4 kurzzeitig, allein durch die Nutzung des Begriffs ougenweide die Konzeptualisierung eines aktuell ablaufenden Naturgeschehens, das der erwählte anger miner ougen übertrifft, wieder restituiert wird.
Allerdings wird im Minnesang auch schon – übrigens seit Ulrichs von Gutenburg Leich, der mir sowieso für die in Frauenlobs Lied präsentierten Techniken in mehrerlei Hinsicht prägend zu sein scheint (s. unten) – der Begriff ougenweide bisweilen auch ohne (allzu deutliche18Teschler, HeinrichSMS 21,12Reinmar von BrennenbergKLD 44, IV) Bezugnahme auf die Natur zur Kennzeichnung der Dame verwendet.19Ulrich von GutenburgMF 69,1 (Leich)Hesso von RinachSMS 11,2Ulrich von WinterstettenKLD 59, XVDer DürincKLD 8, IIKönig Wenzel von BöhmenKLD 65,IUlrich von LiechtensteinKLD 58, XXV (Leich)Konrad von LandeckSMS 16,18Der KanzlerKLD 28, X Damit kommt nun aber zu der Problematik, die wiederum bereits SUSANNE KÖBELE differenziert herausgearbeitet hat – nämlich der Frage nach dem Lexikalisierungsgrad der Metapher ougenweide und der semantischen Präsenz der Ursprungsbedeutung von weide als Futter- oder Weideplatz20 –, die Schwierigkeit der Bestimmung des sich für den Rezipienten anbietenden logischen Bezugspunktes für ougenweide hinzu. Denn zum einen kann die Aussage des Text-Ichs, es habe sich einen anger erwählt, der schöner sei als jede ougenweide sonst, zunächst noch als von der Naturthematik ausgehend aufgefasst werden in dem Sinne, dass das Text-Ich sich mit seinem anger einen Attraktionspunkt erwählt habe, der die gesamte ougenweide der Natur übertreffe, zum anderen jedoch auch rein liebesthematisch konzeptualisiert werden. Das Text-Ich bezöge sich dann wohl suggestiv auf die schön anzusehenden Frauen als ougenweide, die die Erwählte eben noch übertreffe.21 Gleichwohl würde jedoch auch in der ersteren Form der Konkretion das thematische Feld des Liedeingangs durchaus in die Richtung der Liebesthematik geführt, nämlich wenn man unterstellt, dass der Rezipient durch die ungewöhnliche Genitivprägung anger miner ougen22 bereits in seiner Erwartung irritiert wird, das Text-Ich ziele auf eine in der sommerlichen Natur zu findende, besonders schön blühende Wiese. Denn diese imaginative Füllung dürfte sich durch die Bestimmung anger miner ougen insofern als relativ fragwürdig erweisen, als dass allein durch die hiermit angezeigte Inbesitznahme der Naturmotivik durch das Ich – und den damit schlagartig dominant gewordenen, subjektiven Innenraum – auch die liebesthematischen Potenziale der Ich-Rede schon suggestiv einblendbar sind. Im Kontext der späten Minnesangtradition ist dafür durchaus das Konstruktionsmuster ‹meine Dame übertrifft sogar noch die Schönheiten der sommerlichen Natur› anwendbar23Graf Kraft von ToggenburgSMS 1,1, das als möglicher Deutungshintergrund zugrunde gelegt werden mag.
An dieser Stelle ist nötig, auf noch eine weitere Möglichkeit der konnotativen Auffüllung der Metapher vom anger miner ougen einzugehen, die sich durch eine Parallele zu Frauenlobs MarienleichFrauenlob (Heinrich von Meißen)Marienleich ergibt und möglicherweise noch eine ergänzende Bedeutungsperspektive dem Lied einschreibt. Dort heißt es – wiederum in der Eingangspartie – von der visionär geschauten vrouwe aus der Perspektive des Text-Ichs, dessen genaue Situierung zwischen den Polen einer Einnahme der Prophetenrolle des Johannes auf Patmos24, einer Gestaltung als repräsentative Stimme der «sündigen Menschheit»25 und einer Konfigurierung als «Dichter-Visionär»26 von der Forschung breit diskutiert worden ist27: Ei, ich sach in dem trone / ein vrouwen, die was swanger. / die trug ein wunderkrone / vor miner ougen anger (I,1, Vv. 1–4)28. Dass nun aber diese auffallende Formulierung, die – im Unterschied zu Lied 4 – in einem Kontext steht, der völlig ohne Natureingangsmarkierung oder weitere naturthematische Aufladung auskommt, so einfach aufzulösen ist, wie das etwa BURGHART WACHINGER vorschlägt, wenn er sie als einfache Variante der beliebten Vokabel ougenweide erklärt29, scheint mir jedoch zweifelhaft zu sein. Denkbar wäre nämlich zum einen, dass die Benutzung der Vokabel anger tatsächlich für einen – freilich ganz punktuell gesetzten – Konnex zur Natur- und Jahreszeitenthematik der weltlichen Liebesdichtung sorgen soll, wie dies GERHARD SCHÄFER andeutet30, so dass die Visionserscheinung der vrouwe Maria durch die beiden konkurrierenden Situierungen in dem trone (I,1, V.1; d.i. – nach Schäfer – in caelo, ja sogar in ecclesia31) und vor miner ougen anger (I,1, V. 4; als aus der Liebeslyrik transferierter Imaginationsraum) vor dem multiperspektivischen Hintergrund einer geistlich-ekklesiologischen und weltlich-höfischen Konnotationssphäre vexierbildartig verdichtet wird. Allerdings ist darauf zu verweisen, dass neben einer möglichen Einschreibung der weltlichen Liebesthematik32 sich die Prägung vor miner ougen anger auch aus dem Motivarsenal der Marienlyrik selbst ableiten ließe, ist die metaphorische Stilisierung Mariens als ein anger doch auch in diesem Traditionsstrang bestens dokumentiert, man denke nur einmal an die bereits im «Melker Marienlied» anzutreffende Anrufung Mariens als ein anger ungebrachot, / dar ane stat ein bluome (IV,2f.)33. Dieses Marienmotiv, das durch das hinzugefügte Blumenbild auch als christologischer Topos anwendbar ist34, ist übrigens im weiteren Verlauf von Frauenlobs Marienleich dann noch mehrfach – freilich jeweils in charakteristischer Abwandlung – präsent, am deutlichsten in Perikope I,12, wo es aus dem Mund der Sprecherin Maria dezidiert – und unter der Nutzung derselben Reimklänge heißt: Ich binz, ein wurzenricher anger, / min blumen, die sint alle swanger (Vv. 20f.)35. Diese motivische Parallele könnte nun als ein Hinweis darauf gelesen werden, dass das Marienattribut des angers in der Eingangspassage des Leichs – und dies wäre in der Tat schon eine frappierende literarische Verschiebungsoperation – von der Figur der Maria auf die Konzeption des in dieser Passage aufgerufenen «Schauraums»36 des Ichs übertragen wäre, so dass die Metapher vor miner ougen anger letztlich symbolisch auf die besungene Maria selbst zurückverwiese, die als Ursprungsgrund der Vision somit den komplexen Verschachtelungen eines Innen und Außen, die sich im Sehakt des Ichs ergeben, bereits immer vorgeschaltet wäre. Denn die eigentlich als imaginärer Hintergrund aufgebaute Lokalbestimmung (Maria trägt die wunderkrone vor dem Anger der Augen!) konstruiert zum einen für die Vision, zu verstehen als ein vom Inneren des Ichs nach Außen projeziertes Bild, einen Schauraum, der durch die Bezeichnung anger ja wiederum auf ein eigentliches Außen verweist, das aber zu einem suggestiven Internum verwandelt ist (ein Anger, der nur für die Augen des Ichs sichtbar ist), und somit zu einem Seelenraum des Ichs wird. Andererseits wird die Ich-Instanz gleichzeitig auch auf die Muttergottes selbst hin transzendiert, da eben zudem ein Symbolraum anger in sie hineinragt.
Dies führt nun freilich auf die Frage des gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnisses von Frauenlobs Marienleich und Lied 4 hinsichtlich der Prägung der auffallenden Metapher, denn die Raumkomplexität ergibt sich durch die nur geringfügig anders modulierte Formulierung in der Eingangspassage von Lied 4 ja nicht in dieser Radikalität: Genau hier wird der anger miner ougen nicht als ein imaginäres Hintergrundbild eines visionären Akts aufgeführt (es fehlt die präpositionale Ausdeutung durch das vor), sondern bildet mehr einen optischen Attraktionsgegenstand des Ichs37 als einen tatsächlichen Schauraum. Zwar ist dieser anger durch den Genitiv miner ougen ebenfalls als Resultat einer Überblendungsoperation von Innen- und Naturraum gekennzeichnet, jedoch nicht zwingend tatsächlich im Inneren des Ichs – als ein nur dort existierender Seelen-anger – anzunehmen. Unterlegt werden dürfte eben in erster Linie ein außerhalb des Ichs liegendes Phänomen (eine schöne Wiese / die schöne Frau, s.o.), von dem das Text-Ich in seinem Inneren nur derart affiziert ist, dass es eine Zuordnung zu sich selbst vornimmt (der anger miner ougen in dem Sinne: «der Anger, den ich – etwa im Gegensatz zu anderen – vor Augen habe»). Denn schließlich wird vom Lied der Vorgang einer Internalisierung der Naturmotivik weniger durch Ebenenverwischung von Innen und Außen, wie im Marienleich, hergestellt, als später durch das Bild des zum Herzen38 wirbelnden Glanzes der auf diesem Externum anger anzusiedelnden liljen39 (vgl. I,6–10) vielmehr explizit vorgeführt. Somit wird eine – zuvor schon – im Ich zu konzeptualisierende Lesart von anger als eines nur dort existierenden, imaginären Ortes eher nicht gestützt. Wenn wir nun aber die auffällige Überschneidung in der Formulierung vom anger miner ougen als relativ eng zu denkende intertextuelle Verknüpfung von Leich und Lied 4 zu denken haben (dies leuchtet aufgrund der Spezifik der Prägung ja schon ein!), bedeutet dies nun also, dass das Lied hier in der Ausformung der Genitivmetapher dem Leich vorgängig ist, und dieser – die weltlich-liebesthematische Konnotationsmöglichkeit dieses Naturmotivs aufgreifend und unter Amalgamierung mit dem auch für die Mariensymbolik nutzbaren Potential von anger diese überbietend – die Metapher zum radikal ins Innere projezierten Schau- und Seelenraum des Ichs ausbaut? Oder ist es umgekehrt anzunehmen, dass der Leich mit seiner Eingangsgestaltung die Folie für das Lied bildet, die die mariologische Bedeutungskomponente des angers nun – durch direkte Inbezugnahme auf die im Leich exponierte Formel – als Konnotationsrahmen auf die Geliebte des Ichs überträgt und diese somit mit einer religiös angereicherten, ja geistlich-weltlich schillernden Aura versieht? So sicher an der intertextuelle Verbundenheit von Marienleich und Lied 4 im Frauenlob-Œuvre auch festzuhalten ist, ist m.E. eine fundierte Aussage über das genaue historische Abfolgeverhältnis der beiden Texte (welcher Text ist der Prätext des anderen?) – wie eben so oft – prinzipiell unmöglich.40 Aber ein solches – auf genetische Zusammenhänge der faktischen Textproduktion zielendes – Frageinteresse ist letztendlich auch gar nicht zielführend, wenn man die Ebene der Rezeption mit in Betracht zieht. Vor dem Hintergrund eines mit dem Vorwissen um den Marienleich – einer der bekanntesten Frauenlob-Texte41! – ausgestatteten Rezipienten kann sich somit (gleichgültig, ob vom Verfasser beabsichtigt oder produktionsgenetisch möglich!) für Lied 4 sehr wohl allein über die Formulierung anger miner ougen eine latent mitlaufende Marienassoziation für die Geliebte des Text-Ichs ergeben, die hier nicht einfach übergangen werden darf.42 Diese Bedeutungskomponente würde sich übrigens recht gut in die Befunde der Forschung zum weiteren Liedverlauf einpassen, für den die besondere Rolle einer geistlichen Konnotationsebene anhand der dort mittels mehrerer Beispiele ausgefalteten Tierallegorese bereits deutlich herausgearbeitet worden ist.43
Für den Rezipienten verstärkt sich die (mariologisch angereicherte?) liebesthematische Auffassung der Aussagen des Liedbeginns sicherlich auch durch die nun folgende Passage V. I,3f., in der das Text-Ich angibt, ir fire stehe diesem deshalb besser an, als sich zu empören. Dabei überrascht insofern der Einsatz des Pronomens ir, als hier die erwartbare Bezugnahme auf den zuvor angesprochenen anger grammatikalisch destabilisiert wird, was ein weiteres irritatives Moment für die Konzeptualisierung des Liedeingangs als naturthematische Aussage darstellen dürfte. Schließlich verweist das ir wohl am wahrscheinlichsten doch schon auf eine si, also eine Frau, und damit eben auf die Liebesthematik. Diese Lesart wird dann übrigens durch die Wiederaufnahme des Pronomens ir in V. 7 (ir liechten wangen) nachträglich auch abgesichert. Grammatikalisch denkbar wäre es allerdings, das ir zum einen auf die ganze ougenweide, die der Anger des Herzens übertrifft (V.2), zu beziehen, was inhaltlich nicht recht zu passen scheint, oder eben sinnvoller auf die ougen aus V.1. Durch die so mögliche Auffassung der betreffenden Textstelle, das Text-Ich wolle mit seinem Herz und seinen Sinnen die eigenen Augen preisen, eben weil diese für jenes einen besonders prächtig blühende Wiese erblickt haben, bleibt die Konzeptualisierung des Liedbeginns als reine Aussage des Natur- und Jahreszeitenbezugs, wenn auch gestört, so doch letztlich aber immer noch denkbar.
Schließlich wird dann die zwischen vordergründiger Naturmotivik und deren Ableitung auf die Liebesthematik hin changierende metaphorische Spannung des Eingangs durch Vers 5f. noch einmal radikalisiert, indem das Ich wiederum eine nur scheinbar faktische Bemerkung über jahreszeitliche Naturdetails, eben über die Wahrnehmungen von Blumen (rosen, liljen), anstellt, die freilich durch das generalisierende swenne dann aber gerade keine suggestiv auf die Imagination von Aktualität eines in der Außenwelt präsentisch ablaufenden Vorgangs zielende Aussage mehr ist. Erst in Vers 7 wird das Oszillieren des Liedanfangs zwischen faktischer Naturdiagnose und metaphorischer Umbiegung derselben endgültig zugunsten der letzteren aufgelöst, indem die Angabe aus V. 5f. nun durch einen präzisierenden Relativsatz als metaphorisches Sprechen über die Wangen der Geliebten vereindeutigt wird.44Walther von der VogelweideL 53,25 Bemerkenswert ist weiter, dass vor dem Hintergrund der Information aus V. 7 nun die offen gebliebene Metapher anger miner ougen aus dem V. 1 ebenfalls als auf das Gesicht der Geliebten bezogen liebesthematisch aufgeklärt wird, ja sich dieser Vorgang sogar auf die vordergründig noch auf ein Naturgeschehen beziehbare Aussage von V. 2 ausweitet, die freilich durch das Signalwort erkiesen immer schon einen deutlichen Hinweis auf den minnesängerischen Topos der erwählten Dame, die alle anderen Frauen übertrifft, enthielt.45Friedrich von HausenMF 50,19Heinrich von VeldekeMF 56,1Heinrich von RuggeMF 103,3ReinmarMF 160,6 In diesem Sinne wird nun aber auch diese Bemerkung aus der Perspektive von V. 7f. eher rein liebesthematisch zu konzeptualisieren sein. Somit bleibt von dem ‹angetäuschten› Natureingang keine Passage mehr übrig, die zwingend als faktische Naturdiagnose zu deuten ist. In dem Maße aber, in dem in V. 7f. das Verfahren der «metaphorischen Umlenkung»46 vom Text selbst offenbar gemacht wird47, wird freilich der suggestive Sog der auf imaginative Aktualität und Faktizität zielenden Natureingangs-Topik vollständig abgewiesen.
Dass es sich bei dieser Technik, die – so ist zu konstatieren – also aus dem engeren Geltungsbereich des Topos herausführt, nicht um ein absolutes Spätphänomen der Minnesangtradition handelt, das für den engeren Rahmen dieser Untersuchung nur von sekundärer Bedeutung wäre, beweist der Blick auf den schon in der hochhöfischen Phase des Minnesangs zu verortenden Leich MF 69,1 von Ulrich von GutenburgUlrich von GutenburgMF 69,1 (Leich).48 Denn in diesem wohl frühsten (erhaltenen49Der von GlierSMS 8,3) deutschen Beispiel für die lyrische Großform des Minneleichs zeigen sich, wenn auch in ihm selbst nicht einmal ein Natureingang realisiert ist, interessanterweise durchaus bereits die meisten Charakteristika der von Frauenlobs Lied 4 genutzten Verfahrensweise einer metaphorischen Umlenkung der Natur- und Jahreszeitenrede derart deutlich vorgeprägt50, dass dieser Kunstgriff wohl mit Recht zu jenem Grundinventar topischer Argumentationsmuster gezählt werden darf, das der Minnesang bereits in seiner sog. ‹hochhöfischen› Phase ausgebildet hat. Deswegen lohnt es sich, auch wenn die Gattung des Leichs nicht unmittelbar im Fokus meiner Überlegungen zum jahreszeitlichen Natureingang im Minnesang steht, genau eben jene Passage der ersten Versikelgruppe I(a) aus Ulrichs MF 69,1 hier dennoch etwas genauer zu betrachten51.
Ulrich von Gutenburg, Der Leich (MF 69,1):
| I.C. bl. 73va | Ze dienest ir, von der ich hânein leben mit ringem muote,als ich nu lange hân getân.und gan es mir diu guote, |
| 5 | Diu mir tuot daz herze mînvil menger sorgen laere,sô wirt an mîme sange schînder winter noch dehein swaere.Ich wil si vlêhen, unz ich lebe, |
| 10 | daz sî mir vröide gunneund sî mir lôn nach heile gebe.si ist mîn sumerwunne,Si saejet bluomen unde klêin mînes herzen anger; |
| 15 | des muoz ich sîn, swiez mir ergê,vil rîcher vröiden swanger.Ir güete mich vil lützel lâtdekeinen kumber müejen.der schîn, der von ir ougen gât, |
| 20 | der tuot mich schône blüejen,Alsam der heize sunne tuotdie boume in dem touwe.sus senftet mir den swaeren muotvon tage ze tage mîn vrouwe. |
| 25 | Ir schoener gruoz, ir milter segen,mit eime senften nîgen,daz tuot mir ein meien regenrehte an daz herze sîgen. |
[I. Ihr zu Diensten, wegen der ich
ein Leben in sorglosem Gemüt führe,
wie ich es jetzt lange getan habe.
Und wenn es mir die Gute gönnt,
die mir mein Herz befreit
von sehr vielen Sorgen,
dann wird an meinem Sang nicht erkennbar werden
der Winter und auch keine andere Beschwernis.
Ich will sie flehend bitten, solange ich lebe,
dass sie mir Freude gönnen
und Lohn geben möge, der mich glücklich macht52.
Sie ist mein Sommerglück,
sie sät Blumen und Klee aus
in den Anger meines Herzens.
Davon muss ich, gleich wie es mir ergehen mag,
sehr großer Freude schwanger sein.
Ihre Güte lässt mich sehr wenig
an irgendwelchem Kummer Mühe haben.
Der Lichtstrahl, der von ihren Augen ausgeht,
der bringt mich dazu, schön zu erblühen,
so, wie das die heiße Sonne
bei den Bäumen im Tau erreicht.
Derart erleichtert mir die bedrückte Stimmung
von Tag zu Tag meine Dame.
Ihr liebevoller Gruß, ihr wohltuender Segenswunsch
mit einer freundlichen Verneigung,
das lässt bei mir einen Maienregen
geradewegs auf mein Herz niederfallen.]
Jene Anfangspassage, die durch die mottohaft53 vorangestellte Dienstankündigung des Ichs (Ze dienest ir; V. I,1) also zunächst programmatisch mit der Liebesthematik einsetzt und diese dann ab Vers I,8 erst mittels vielfältigster Formen der Natur- und Jahreszeitenallusion spezifisch profiliert, präsentiert das Ich (noch) in einem signifikanten Freudengestus, der sich freilich im weiteren Verlauf des Leichs immer wieder mit Passagen der Liebesklage mischt.54 Dabei sind die beiden gegensätzlichen Sprechhaltungen, die im Verlauf des Leichs hin- und hermäandern, bisweilen aber über das auch für das Registersprechen des Werbungsliedes typische rhetorische Mittel der Revocatio55 spannungsgeladen noch verdichtet werden56, stets durch ein enges Motivgeflecht kunstvoll verbunden, für das die Natur- und Jahreszeitenthematik den Rahmen setzt: Denn mit der am Ende geäußerten Hoffnung des Text-Ichs, dass die Dame ihm ein wunneclîchez ende gebe (VII,16), wird die Lobpreisung der Geliebten als mîn sumerwunne (I,12) in der ersten Perikope des Leichs wieder aufgenommen.
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für den hohen Grad an Motivvernetzung, der für den gesamten Leich bestimmend ist, hier aber nur unzureichend nachgezeichnet werden kann,57 ist der Themenkomplex der zunächst in Vers I,5 relativ beiläuflig eingeführten Herzmetaphorik, die aber bereits in Vers I,13f. mittels Amalgamierung mit der sommerlichen Naturthematik zum mînes herzen anger (I,13) signifikant transformiert erscheint. In diesen säe, so spinnt das Text-Ich die neue, komplexere Metapher weiter, die Dame Blumen und Klee ein, und dort – so wird in den Versen I,25–28 fortgesetzt – gehe ihr liebevoller Gruß wie ein meien regen (I,27) nieder. Von diesem höchst beachtenswerten Vorgang einer solchen über die Instanz des Herzens erreichten metaphorischen Anverwandlung der Natur- und Jahreszeitenrede wird noch genauer zu sprechen sein. Doch damit ist die motivische Modulation der Herzensthematik in Ulrichs Leich noch gar nicht abgeschlossen. Denn im weiteren Verlauf erscheint diese wieder in Perikope III, reagiert dabei aber verstärkt auf die bereits in den Bildern des Säens und Herabregnens vorhandene, in Perikope II noch weiter ausgebaute und übrigens für den gesamten Leich bedeutsame Oben-Unten-Rhetorik58, die nun die Herzmetaphorik im Kontext einer internen Instanzenteilung des Ichs neu gewichtet. In den Versen II,10–13 hatte nämlich das Text-Ich angegeben, dass die Wohltaten, die die Dame dem Text-Ich bereits jetzt zu gewähren bereit sei, jedem anderen Mann völlig genügen würden, jedoch wolle sein unzügelbarer muot noch höher hinaus – womit schwerlich etwas anderes als die ersehnte (körperliche) Liebesvereinigung gemeint sein dürfte.59Kaiser HeinrichMF 5,16Friedrich von HausenMF 49,13NeidhartWL 20/SNE I: R 47 Allenfalls die Furcht vor der Macht des minnen slac, um dessen verheerende Wirkung das Ich schon jetzt weiß, vermöge es dabei zurückzuhalten (vgl. II,14–18). Dies wird nun in den Versen III,1–6, mittels der Herzensmotivik revidiert, indem dass herze aufgefordert wird, sich doch auch aufzuschwingen60 und – so ist zu ergänzen – dem in die ‹Höhe› strebenden muot zu folgen. Allerdings ist eine genaue konzeptuelle Abgrenzung der beiden inneren Instanzen muot (d.i. «kraft des denkens, empfindens, wollens, sinn, seele, geist; gemüt, gemütszustand, stimmung, gesinnung» 61) und herze (als «sitz der seele, des gemütes, mutes, verstandes, der vernunft, überlegung»62) mit ihren im Mhd. doch sehr weiten Bedeutungsspektren wohl nicht unproblematisch, ja bisweilen nähern sich in der mhd. Dichtung nämlich beide Instanzen auch bis zur solche Grenzziehungen verwischenden Ineinssetzung an.63 Allenfalls kann hier m.E. über ein recht konkretes Verständnis von muot im Sinne von «begehren, verlangen, lust»64 nachgedacht werden, zu dem herze dann als übergeordnete Seeleninstanz – etwa in Form von dessen ‹Sitz› – denkbar wäre. Schließlich wird aber mit der Ansprache des Herzens und dem Hinweis, dieses habe doch mit seiner Auswahl der Geliebten die das Liebesleid erst herbeigeführt (s. III,5f.: daz ich lîde disen pîn / von dîner kür und dîner bet) der im Werbungslied beliebte Topos von der Herzenswahl der Dame anzitiert, der etwa in den Anfangsversen von Friedrichs von Hausen Lied MF 49,13Friedrich von HausenMF 49,13: Mir ist das herze wunt ausgeführt wird65Friedrich von HausenMF 49,13, aber auch bei Heinrich von Rugge und Reinmar präsent ist66, und somit herze durchaus in der für den Minnesang nicht untypischen Weise als die entscheidende Liebesinstanz profiliert.67 Gleichzeitig wird dabei zudem auf den Typus des bereits durch Friedrichs von Hausen berühmtem Lied MF 47,9Friedrich von HausenMF 47,9: Mîn herze und mîn lîp diu wellent scheiden im Gattungsrahmen des Kreuzliedes aufgerufenen herze-lîp-Widerstreites verwiesen, der die für die höfische Literatur spezifische Modifikationsform der theologischen Streitgesprächstradition zwischen Seele und Körper darzustellen scheint.68Friedrich von HausenMF 47,9 Ähnlich wie bei den oben bereits erwähnten Liedern wird hierbei in MF 47,9 wiederum das herze als das für die Liebeswahl verantwortliche Internum benannt69 und zudem dieses in Str. II von einer nicht näher bezeichneten Ich-Instanz (dem lîp? der übergeordneten Persona des Ichs?)70 direkt angesprochen; eine ähnliche Unbestimmtheit der das herze ansprechenden Instanz ließe sich vor dem Hintergrund dieser Texttradition dann letztendlich auch für Perikope III des Leichs konstatieren (denkbar wäre neben der übergeordneten Ich-Persona etwa auch der muot). Erst in den diese erste Passage abschließenden Versen der Gruppe III (Vv. 12–19), in der das sprechende Ich angibt, das Ausbleiben von danc (III,13) seitens der Dame sorge bei ihm für die Erneuerung einer alten klage (III,17), scheint mir die Ich-Figuration durch die mögliche Perspektivierung dieser Aussage auf die Sänger-Rolle hin wieder deutlich bei einer internen Entitäten übergeordneten Gesamtpersona zu liegen. Die daraufhin vom Ich revokatorisch formulierte Absicht nu wil ich noch ir genâden trôst / Beiten als ich hân getân (III,19f.; Hervorhebungen – wie nachfolgend – von mir, D.E.) wird wiederum im weiteren Verlauf – unter Einbeziehung der bereits besprochenen Stelle III, 5f. (vgl. bes. Vers 6: daz ich lîde disen pîn) – durch die Verse 17–20 der Perikope IV zurück auf die Herzensmotivik geleitet und jetzt vor dem Hintergrund der Gesellschaftsinstanz neu gewichtet, indem das Text-Ich angibt: doch hoere ich vil von vriunden und von mâgen, / war umbe ich schîne in dirre pîne. es enmac mich niht betrâgen, / diu wîle ich weiz in ir gewalt / mînes herzen trôst sô manicvalt. Dabei spannt Ulrichs Leich mit der Formel von den vriunden und mâgen einen Konnotationsraum auf, der zum einen auf die Verwandschaftsthematik der Frauenstrophen und -lieder beziehbar ist71Hartmann von AueMF 216,1ReinmarMF 203,10Friedrich von HausenMF 54,1, andererseits auf den Topos der Freundeshilfe des männlichen Text-Ichs im Werbungslied.72Dietmar von EistMFMT VIII, Nr. XVIFriedrich von HausenMF 43,28Heinrich von RuggeMF 103,3Heinrich von MorungenMF 145,33ReinmarMF 166,16 Besonders deutlich scheinen in diesem Zusammenhang aber die Parallelen zu der Reinmar-Strophe MF 165,10ReinmarMF 165,10, Vv. 3f. zu sein (die vriunt verdriuzet mîner klage. / des man ze vil gehoeret [!], dem ist allem sô), wo in ganz ähnlicher Weise die Instanz der vriunt des liebenden Ichs zu einem Gegenbild zu dessen Gefühlswelt stilisiert wird, die dieser im Grunde verständnislos gegenübersteht. Damit wird erreicht, dass die Exzeptionalität des Liebesempfindens für das Text-Ich vor dem Hintergrund einer Imagination von dessen gesellschaftlicher Isolation und Funktionsunfähigkeit noch weiter profiliert wird. Dies wird von Ulrichs von Gutenburg Leich freilich durch die Betonung der internen Instanz des herze gleichzeitig noch stärker im Sinne einer Opposition von Innen- und Außenwelt des Ichs, die ja auch für die Ergründung der poetischen Funktion der Natureingangstopik im Bedeutungsgefüge des Werbungsliedes so eine entscheidende Rolle spielt, markiert. In diesem Zusammenhang scheint es besonders bemerkenswert zu sein, dass gerade die potenzielle Beglückungswirkung, die die Dame in ihrer Gewalt hat, als mînes herzen trôst dem gesellschaftlich auffällig gewordenen pîn des Ichs und dem darauf genau inadäquat reagierenden sozialen Umfeld entgegengehalten wird (vgl. IV, 19f.). Denn das ez in Vers IV,18, das das Text-Ich eben nur wegen der immer noch bestehenden Hoffnung auf Tröstung durch die Dame nicht bekümmern kann, ist schwerlich auf etwas Anderes beziehbar als auf die ständige Fragerei der vriunt und mâge nach der Ursache seines Leidens (ebd.), die sonst nicht aushaltbar wäre. Das deswegen daraufhin über eine rhetorische Frage bekräftigte Festhalten des Ichs an der Dame (wie solde ich sî verlâzen?; IV,21) führt nun zu einer erneuten Reformulierung der Herzensmotivik, die diese eigentlich interne Instanz sogar noch weiter über eine Inbezugsetzung zum externen Außenraum profiliert, nämlich mittels des rhetorischen Kunstgriffs einer hyperbolischen Adynatonaufstellung, die das herze mit äußerlichen Gegebenheiten einer konkreten, aber in einen irrealisierten Möglichkeitsmodus verschobenen Geographie zusammenbringt: er irret sich, swer iemer mich darumbe wil verwâzen. / er schiede ê Musel und den Rîn, / ê er von ir daz herze mîn / gar enbünde (IV,22–25). Diese Stelle korrespondiert übrigens wiederum mit einem ähnlich ausgeführten Adynaton in Perikope IIIb, Vv. 1–4, wo die unmögliche geographische Bedingung nun umgekehrt gefordert ist: Er kêrte den Rîn ê in den Pfât, / ê ich si lieze, diu mich hât / betwungen, und doch schône stât / von ir mîn herze, swiez ergât – nicht Mosel und Rhein müssten also getrennt werden, sondern der Rhein in den Po umgeleitet sein.73 Gerade letzere Passage macht dann auch deutlich, woher Ulrich die Anregung für diese – in ihrer Übertreibung nicht unwitzigen – Scheinkonkretisierungen der Minneabsolutheit des Ichs bezogen haben mag, bringt doch in Friedrichs von Hausen Wechsel MF 48,32Friedrich von HausenMF 48,32: Dô ich von der guoten schiet die Frauenstrophe das gleiche, aber vom Geschlechterverhältnis her genau gespiegelte Beispiel für ein derartiges Flüßeadynaton: Sie möhten ê den Rîn / bekêren in den Pfât, / ê ich mich iemer sîn /getrôste, swie ez ergât, / der mir gedienet hât (II,5–9)74. Das diesen Adynata stets inhärente Ironisierungspotential wird dann im Minnesang des 13. Jahrhundert eindringlich das Œuvre des Tannhäusers in den Liedern VIIIDer TannhäuserLied VIII (Cammarota)-X herausarbeiten, der besonders in seinen Liedern IXDer TannhäuserLied IX (Cammarota) und XDer TannhäuserLied X (Cammarota) die Adynata zu längeren Reihen zusammenschließt, die nun als abstruse Voraussetzungen der Dame für eine Liebeserfüllung aufgeführt werden.75 In eine ähnliche Richtung weist übrigens auch die letzte Stelle, in der in Ulrichs Leich vom herze die Rede ist, nämlich die Passage Vv. 25–32 in Perikope Vb. Dabei wird interessanterweise die Herzmetaphorik nun mit einem der im Leich mehrfach begegnenden Literaturbezüge76 gekreuzt, in diesem Falle eine Aufrufung des Eneas-Stoffes am ‹schrägen› – weil für einen glücklichen Ausgang der Liebeswerbung genau falschen – Beispiel des Turnus: Turnus der wart sanfte erlôst / von kumberlîchem pîne: / daz was sînes herzen sunder trôst, / daz er lac dur Lâvîne / sô schône tôt. / der endet schiere sîne nôt / in eime tage, / die ich nu mange jâr trage (Vb,25–32). Schon mit der Einlassung des Text-Ichs, Turnus sei von seinem kumberlîchen pîne angenehm erlöst worden (Vb, 25f.), wird klar, dass es sich hier nicht um ein konventionelles Literaturbeispiel für eine positiv endende Liebesgeschichte handeln kann, denn dann hätte als Name der des Eneas – und nicht eben der des von ihm getöteten Rivalen – aufgeführt werden müssen.77 Wenn nun aber darauf angegeben wird, dass – man beachte die durchaus als Ironiesignal deutbare Übertreibung der Wendung mînes herzen trôst von IV,2078 – des Turnus einziger Herzenstrost darin bestanden habe, dass er um der geliebten Lavinia willen einen so vollendeten Tod gefunden habe (vgl. Vb,27–29)79, und diese Aussage dann am jahrelangen Liebesleid des Text-Ichs gemessen wird, das unglücklicherweise eben kein so schnelles Ende gefunden habe (Vb, Vv. 30–32), so scheint mir auch hier die inhaltliche Drastik der Vergleichssetzung (Tod als ein Ende des Liebeskummers) ironisch gebrochen und somit das Literaturzitat eher zum poetologischen Spiel mit dem minnesängerischen Klagegestus genutzt zu sein. Dies führt freilich die variable Anschlussfähigkeit und vielgestaltige Realisationsweise der Herzensmotivik in Ulrichs Leich noch einmal eindrücklich vor Augen.
Doch so, wie die Herzmetaphorik einen der möglichen interpretatorischen Zugriffe auf den gesamten Leichzusammenhang bietet, ist sie eben – wie bereits angedeutet – auch für die charakteristische Gestaltung der Natur- und Jahreszeitenbildlichkeit von MF 69,1 von entscheidender Bedeutung. Denn bereits nach der ersten Einlassung des Text-Ichs, dass dieses aufgrund der beglückenden Wirkung seiner Dame nun lange schon ein Leben mit ringem muote (I,2) führen könne (vgl. I,1–3), wird dies vom liebenden Ich dahingehend auf die Instanz des herze (I,5) bezogen80, die Dame hätte dieses von Sorgen befreit, so dass sich am Sang des Ichs weder Winter noch sonst irgendwelcher Kummer ablesen lasse (vgl. I,5–8). Damit ist also nicht nur über das liebesthematische Sprechen die Instanz des herze als ein Ansatzpunkt der motivischen Modulationstechnik etabliert, sondern – interessanterweise in Herleitung über die Sangesthematik – auch der Bereich der Natur- und Jahreszeitenthematik mittels der Signalvokabel winter (I,8) schlagartig präsent gemacht; diese spielt jedoch für die unmittelbar folgenden Verse dann wiederum keine Rolle mehr.81 Um einen saisonalen Natureingang, wie er in der vorliegender Untersuchung für das Werbungslied als Topos nachzuzeichnen ist, handelt es sich dabei – wie schon mehrfach betont – also nicht, denn selbst wenn man die fehlende Anfangsstellung einmal außer Acht ließe, so kann in dieser kurzen sangesthematischen Passage von konkreten Naturdetails nicht die Rede sein. Vielmehr haben wir es bei jener Stelle, die ja die erste Repräsentation von Natur- und Jahreszeitenthematik in Ulrichs Leich darstellt, sofort mit einer metaphorisch lesbaren Verwendungsweise von dieser zu tun, die ganz ähnlich funktioniert wie bestimmte Techniken der Anwendung der Jahreszeitenmotivik auf die Sangesthematik, die hier bereits anhand von Harmanns von Aue Liedstrophe MF 205,1Hartmann von AueMF 205,1 im Rahmen des sog. Jahreszeiteneingangs konturiert worden sind. Bezüglich dieses Liedeingangs war nämlich bemerkt worden, dass, wenn das Text-Ich in Vers I,3 angibt, sein Gesang werde das wâpen des Winters tragen, will heißen: aufgrund seiner hoffnungslosen Lage traurig klingen müssen82Hartmann von AueMF 205,1, hier die Jahreszeitenrede in einem derart übertragenen Sinn eingesetzt ist, dass dadurch letztlich die Festlegung des als aktuell zu imaginierenden saisonalen Zeitpunktes als Winter eher desavouiert, denn vorangetrieben wird. Eine solche Verwendung der Jahreszeitenthematik begegnet nun aber doch in vergleichbarer Weise auch in Ulrichs Leich, wenn es dort in positiver Setzung umgekehrt heißt, dass aufgrund der beglückenden Wirkung der Dame (vgl. I,5f.) man dem Sang des Text-Ichs weder den Winter noch sonst etwas Sorgenvolles ablesen könne (vgl. I,7f.). Dadurch ist beim Rezipienten eine Imagination des präsentisch für die Sprechgegenwart des Ichs zu unterlegenden saisonalen Zeitpunktes als Winter zwar sicher möglich, jedoch aber nicht zwingend nötig, schließlich ist die Aussage dazu viel zu generell und prinzipiell ja auch als im Sommer getroffene Feststellung denkbar.83Dietmar von EistMF 35,16Dietmar von EistMF 39,30Heinrich von VeldekeMF 59,23Heinrich von VeldekeMF 57,10 Dafür spricht übrigens dann auch die sofortige Auflösung des konkreten, temporalen Markers der Jahreszeitennennung winter zur völlig unbestimmt und allgemein gehaltenen Angabe noch dehein swaere noch im selben Vers (I,8). Insofern erklärt sich diese punktuelle, ja fast als Scheinfestlegung fungierende saisonale Markierung, die doch sehr stark in ein metaphorisches Aussagenkonzept im Sinne von «in meinem Gesang ist von Kummer nichts zu spüren» hinüberspielt, als Grundlegung einer Tendenz in Ulrichs Leich, die Natur- und Jahreszeitenrede weniger als Stilisierungsmittel zur Festschreibung einer Sprechgegenwart zu nutzen, als vielmehr diese zum Ausgangspunkt einer metaphorischen Umsetzung liebesthematischer Aussagen zu machen. Diese Technik zeigt sich dann besonders in der nun zu besprechenden Passage I,12ff., die – nach Zwischenschaltung einer in dieser Hinsicht unmarkierten, konventionellen liebesthematischen Aussage84 – nämlich die bereits angeklungene Jahreszeitentopik wieder aufgreift, indem das Ich die Dame hier als seine sumerwunne (I,12), also seine Sommerfreude / sein Sommerglück, charakterisiert. Diese Formulierung, die an sich vielleicht gar nicht so aufregend scheinen mag, offenbart aber bereits einen Vorgang, dessen Tragweite in poetologischer Hinsicht nicht zu unterschätzen ist, führt sie doch die Technik der metaphorischen Umlenkung der Natur- und Jahreszeitenrede hier durch die verkürzte Formulierung si ist mîn sumerwunne (I,12) quasi bereits in ihrem Endresultat vor.85 Indem die Dame nämlich nun als Sommerfreude des Ichs erscheint, ist nicht nur die der (kosmologischen) Außenweltdiagnose des Ichs zugeordnete Motivik, deren Funktion tendenziell auf situative Festschreibung einer Sprechgegenwartsimagination zielt, vollkommen auf eine andere Liedinstanz (hier: die Dame86) projeziert und damit in den Status uneigentlicher Rede – nämlich den einer liebesthematischen Aussage – versetzt (si ist mîn sumerwunne ist auch als eine im Winter gemachte Festsellung denkbar87), sondern eben auch in entscheidender Form subjektiv vom Ich vereinnahmt – ein Außenweltbezug ist nicht mehr vorhanden (man konzeptualisiert: sie ist für mich sumerwunne).
Diese Umbesetzungsoperation wird nun im Folgenden weiter ausgefaltet, indem die Natur- und Jahreszeitenmotivik konsequent metaphorisch zur Umschreibung eigentlich liebesthematischer Aussagen angewendet wird. Dabei scheint die Umsetzung dieser Technik quasi zur Initialzündung eines derart reichen Anlagerungsprozesses intertextueller Bezüge zu werden, die doch besondere Aufmerksamkeit verdient. Ein gutes Beispiel für eine solche Verdichtung liefert gleich die Passage Vv. I,13–16, die mit einem recht ungewöhnlichen Bild einsetzt:
Si saejet bluomen unde klê
in mînes herzen anger;
des muoz ich sîn, swiez mir ergê,
vil rîcher vröiden swanger.
Das Text-Ich gibt hier an, dass die Dame im Anger seines Herzens – also nicht dem der Augen wie bei Frauenlob! – Blumen und Klee aussäe, wodurch es – gleichgültig, was ihm widerfahre – stets übergroßer Freuden swanger (I,16) sei. Hinsichtlich der poetischen Technik wird also Naturmotiv (bluomen und klê auf dem anger)88Meinloh von SevelingenMF 14,1Heinrich von VeldekeMF 58,23Namenlos (Niune)MF 6,5Gottfried von StraßburgMFMT XXIII, Nr. IIWalther von der VogelweideL 51,13 zur metaphorischen Ausdeutung der liebesthematischen Aussage, die Dame mache das werbende Ich überglücklich, eingesetzt, wobei die Topik nicht in erster Linie auf die Instanz der Dame angewendet wird, sondern ihren perspektivischen Fluchtpunkt im Internum des Ichs selbst besitzt (sie sät zwar Blumen und Klee, aber eben auf der Herzenswiese des Ichs). Dabei sind m.E. zwei Aspekte bemerkenswert, nämlich zum einen das – sicher ungewöhnliche – Bild der säenden Dame im Herzen des Ichs, für das es im Minnesang zuvor keine Parallele gibt, und zum anderen die – vor dieser Folie ebenso frappierende – Formulierung in mînes herzen anger (I,14) selbst, die auf die – etwa in der Spruchdichtung späterer Zeit begegnende – besonders beliebte Praxis der Genitivmetaphorisierung von Naturdetails im Kontext des sog. ‹geblümten Stils›89 verweist, in unserem Zusammenhang aber natürlich auch gerade vor dem Hintergrund der Frauenlob’schen Prägung vom anger miner ougen interessiert und auf die ihr inhärenten Spezifika hinsichtlich der poetologischen Dimension einer internalisierenden Metaphorisierung von Naturmotiven zu befragen ist. Denn während im Falle von Frauenlobs anger – selbst bei den unterschiedlichen Modi an Verlegung dieses Externums in das Innere des Ichs in Marienleich und Lied 4, die in der vorherigen Interpretation auszuloten versucht worden sind90 – mit der Wahl des Sinnesorgans ougen diesem immer ein Wahrnehmungsmoment – und damit der Aspekt des Übergangs von Außen nach Innen – eingeschrieben bleibt, ist dem anger bei Ulrich mit der Verortung im Herzen – und damit der im Minnesang immer stärker profilierten Metapher für die innere Liebesaffektion – bereits ein denkbar radikaler Grad von Internalisierung zu eigen.91 Auch wenn dadurch freilich die Potenziale der Metaphorisierung von Natur- und Jahreszeitenmotivik hinsichtlich der Frauenlob-typischen Ebenenverwischung, etwa der irritierenden Destabilisierung von Innen und Außen, in Ulrichs Leich somit noch nicht im Vordergrund stehen, zeigt der Text dennoch, dass das Verfahren einer internalisierenden, liebesthematischen Umdeutung dieser Topik, die ja hier noch deutlicher einen Abbau ihrer Potenz zur Außenweltimagination betreibt, der Minnesangtradition als realisierbare Möglichkeit schon relativ früh zur Verfügung steht. Doch damit ist das Motiv der im Herzensanger säenden Dame, dessen Herkunft und Konnotationshintergrund noch nicht ausreichend geklärt. Schließlich lässt es sich über den bekannten Minnesang-Topos des Wohnens der Umworbenen im Herzen nicht restlos herleiten92Friedrich von HausenMF 42,1Heinrich von MorungenMF 141,15, auch der Verweis auf das Fungieren der Dame als «Gärtnerin»93 oder die Möglichkeit einer Inbezugsetzung mit später begegnenden – wohl von Neidharts Dörperwelt angeregten – Stilisierungen der Geliebten als feldarbeitende Magd94SteinmarSMS 26,14 scheinen hier nicht zielführend zu sein. Darüber hinaus wird man auch schwer die wenigen direkten Parallelstellen zur Genitivprägung des herzen anger selbst zur Klärung der Passage heranziehen können, stammen sie doch aus deutlich späterer Zeit.95 Vielmehr scheint es mir so zu sein, dass sich die auffallende Metaphorik der im herzen anger des Ichs Blumen und Klee säenden Dame einer spezifischen Verschmelzung von Naturmotivik und Bibelallusion (Gleichnis des Sämanns und dessen Auslegung, etwa in Mt. 13) verdankt96, wobei diese neutestamentliche Passage dadurch in ihrer Anlagerung begünstigt wird, dass die Natur- und Jahreszeitenrede bereits in ein metaphorisches Sprechen gekippt ist und somit prinzipiell auf das Innere des Ichs übertragen werden kann. Dieselbe Technik nutzt nämlich auch die auslegende Deutung des Gleichnisses in Mt 13,18ff., die die erzählerischen Angaben des eigentlichen Gleichnisses (ein Sämann geht zum Säen auf ein Feld; dabei fallen manche Körner auf den Weg, manche auf felsigen Untergrund, und manche in die Dornen – nur die Saat auf gutem Boden bringt Ertrag) gerade über die Instanz des Herzens (und das ‹Säen› dort!) auf den Menschen überträgt und somit die Aussagen – quasi im Nachhinein – metaphorisiert. Der Anfang dieser Passage lautet in der Vulgata 97:
18 vos ergo audite parabolam seminantis
19 omnis qui audit verbum regni et non intellegit
venit malus et rapit quod seminatum est in corde eius
hic est qui secus viam seminatus est
[(18) Hört also ihr das Gleichnis vom Sämann. (19) Bei jedem, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und raubt, was in dessen Herz gesät worden ist. Dieser ist entlang des Weges gesät worden.]
Damit ist also sogar schon die metaphorische Formulierung selbst vorgeprägt, dass dem Menschen – im übertragenen Sinne – etwas ins Herz ‹gesät› wird (nämlich: das Wort vom Reich Gottes), die hier den Vorgang der Aufnahme des zu Vermittelnden in das Innere kennzeichnet. Dieser Akt der Internalisierung kann jedoch nur Erfolg bringen (‹Früchte tragen›), wenn der betroffene Mensch auch die Bereitschaft zur richtigen Aufnahme hat und dazu das Vermögen, das, was in seinem Herzen angelegt wird, auch zu verstehen (Mt. 13,23)98:
23 qui vero in terra bona seminatus est
hic est qui audit verbum et intellegit
et fructum adfert
et facit aliud quidem centum
aliud autem sexaginta
porro aliud triginta
[(23) Wer aber in gute Erde gesät worden ist, das ist der, der das Wort hört und versteht und Frucht bringt und daraus entweder freilich das Hundertfache oder aber das Sechzigfache oder fernerhin das Dreißigfache erzielt.]
Dies bringt uns zu den Unterschieden, die sich für die Passage von Ulrichs Leich gegenüber der Bibelstelle ergeben, die freilich mehr als eine assoziative, intertextuelle Anregung dient (unter anderen, z.B. der Naturmotivik, wie sie etwa im Natureingang begegnet), denn als tatsächliche inhaltlich-übereinstimmende Präfiguration zu erachten ist: Dem Ich wird hier wohl kaum etwas als Lehre oder Glaubensgewissheit ins Herz ‹gesät›, die ‹Früchte trägt›99, sondern eben bluomen unde klê (I,13), die das Ich zu großer Freude anregen (vgl. I,15f.) – und dies auch nicht von einer religiösen Heilsinstanz, sondern von der geliebten Dame. Zudem ist auch der Ort der Aussaat, obwohl die Bedeutung «ackerland» für anger durchaus möglich ist100, ein in dieser Hinsicht viel freier konnotierter herzen anger und kein herzen acker101. Allerdings ist es freilich schon durch die Aufrufung eines solchen geistlichen Konnotationsrahmens, der sich für die Passage neben dem Kontext der Minnesang-typischen Naturmotivik allein durch die Nähe zur biblischen Wendung vom Säen ins Herz zusätzlich ergibt, möglich, dass diese freudenstiftende Wirkung in assoziativen Zusammenhang mit einer einblendbaren religiösen Dimensionierung der Herzensmetaphorik wie in Mt. 13 tritt – und dies eben nicht derart, dass die Beglückungspotenz der Dame als ‹undenkbare› Alternative abgewiesen würde.102 Insofern wäre die Bibelallusion in Ulrichs Leich durchaus in den Rahmen einer Aufwertungsbewegung der (weltlichen) Liebesthematik zu sehen, wie er sich für den Minnesang ja auch an anderer Stelle bemerken lässt.103
Damit ist aber das volle Bedeutungspotenzial der Passage noch nicht ausgeschöpft: Denn durch die Angabe des Text-Ichs, dass es durch das Säen der Dame im Herzen vil rîcher vröiden swanger (I,16) werde, öffnet sich auch noch der Raum auf den Konnotationsrahmen der mittellateinischen Liebeslyrik hin, die auf dem Gebiet der Naturmotivik besonders häufig mit Bildern der Befruchtungs- und Geburtsmetaphorik operiert.104Burkhard von HohenfelsKLD 6, XI Dafür ist das aus dem 12. Jahrhundert stammende und möglicherweise Petrus von Blois zuzurechnende Carmen Wollin Nr. 5.3Petrus von BloisCarmen 5.3 (Wollin)105 mit Sicherheit ein sehr augenfälliges Beispiel. Ich zitiere hier – stellvertretend für die große Bedeutung dieser Bildlichkeit im gesamten Text – nur einmal den Versikel 1a106:
1a.
De terre gremio
rerum pregnatio
progreditur,
et in partum soluitur
uiuifico calore.
[Aus dem Schoß des Erdbodens
schreitet die Schwangerschaft der Natur voran
und zur Geburt wird sie gelöst
durch die Leben spendende Wärme.]
Doch ist es ja wiederum nicht so, dass die in der mittellateinischen Lyrik gängige Vorstellung von der im Frühling/Sommer107 mit Pflanzenkeimen ‹geschwängerten› Erde, wie sie sich in dem zitierten Ausschnitt zeigt, in Ulrichs Leich direkt übernommen wäre; vielmehr ist das Motiv ebenfalls auf das Text-Ich selbst gewendet (das Ich muss swanger sein108) sowie in übertragenem Gebrauch mit einem emotionalen Abstraktum kombiniert (es ist vil rîcher vröiden swanger) – und damit in großer Eigenständigkeit anverwandelt.109 Inwiefern für die Passage darüber hinaus auch noch mariologische Konnotationsbezüge anzunehmen sind,110 die sich etwa aufgrund des später durchaus in diesem Sinne signalhaft verwendeten Reimpaars anger / swanger ergeben könnten, kann wegen der viel jüngeren Datierung der Belege leider nicht abschließend geklärt werden.111 Ganz ähnlich verhält es sich übrigens mit dem in den Vv. I,25–28 aufgerufenen Bild der Dame, die dem Ich durch ihre liebevollen Gunstbezeugungen (ihr gruoz, segen und nîgen; I,25f.) im Herzen einen meien regen niedergehen lässt, ist doch das Naturmotiv des Maienregens für die deutsche Lyrik sonst erst viel später bezeugt, und zwar in der Spruchdichtung zum Fürstenlob112Walther von der VogelweideL 20,31Der MeißnerSpr. XVII,8 (Objartel) sowie wiederum zum Marienpreis113Der MarnerUnbekannter Ton 2 (Willms). Dagegen dürfte die zuvor in Vv. I,19–24 entwickelte Stilisierung der Dame zur Sonne leichter auf ihre möglichen prätextuellen Anregungspunkte hin festzulegen sein. Das Text-Ich gibt hier an, dass der schîn (I,19), der aus den Augen der Dame hervorstrahle, dieses zum ‹Erblühen› bringe – so, wie die Sonne dies mit den taubenetzten114 Bäumen mache:
der schîn, der von ir ougen gât,
der tuot mich schône blüejen,
Alsam der heize sunne tuot
die boume in dem touwe.
sus senftet mir den swaeren muot
von tage ze tage mîn vrouwe.
Der in dieser Passage durch die Konjunktion alsam explizit ausformulierte Vergleich der Dame mit der Sonne dürfte nämlich direkt auf die im Minnesang recht typische derartige Charakterisierung der Geliebten, die schon bei Dietmar von Eist115Dietmar von EistMF 40,19 begegnet und später besonders bei Heinrich von Morungen116Heinrich von MorungenMF 122,1Heinrich von MorungenMF 129,14Heinrich von MorungenMF 144,17 beliebt ist, zurückzuführen sein117, die freilich wiederum unter metaphorischer Umdeutung und internalisierender Projektion der Natur- und Jahreszeitenrede spezifisch auf das Ich hin zugespitzt ist (sein ‹Erblühen›). Mit der Angabe aber, dass das Ich selbst durch den Glanz, der von den Augen der Dame ausgehe, blüejen gemacht werde (I,20), ist nun ein denkbar radikaler Grad an Wendung dieser eigentlich ja auf suggestive Faktizität der Außenweltbeschreibung zielenden Topik auf die Ich-Instanz erreicht, der die Uneigentlichkeit des Ausgesagten besonders eindringlich herausarbeitet: Denn wenn das Ich – statt wie sonst die sommerliche Natur – ‹erblüht›, ist die Natur- und Jahreszeitenmotivik derart stark subjektiviert und in übertragenem Sinne verwendet, ja das Verhältnis von Ich-Position und Außenwelt so deutlich auf den Kopf gestellt, dass sie auf den ihr ursprünglich inhärenten Zug der imaginativen Situationsfestlegung allenfalls noch in einem poetologischen Sinne, nämlich in Form der Offenlegung und Überbietung einer rhetorischen Strategie, verweist. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass diese Technik der Anwendung der Natur- und Jahreszeitenrede auf die subjektive Ich-Instanz vom deutschen Minnesang nicht eigens herausentwickelt werden muss, sondern als Transformationsweise dieser Topik schon in der Trobador- und Trouvèrelyrik begegnet118Arnaut DanielPC 29,16 (Toja Nr. III)Chastelain de CouciRS 1009 (Lerond Nr. 4), und somit für diesen als prinzipiell jederzeit zu realisierende Möglichkeit schon vorgeprägt sein dürfte. Für Ulrichs Leich sei wiederum ein möglicher Anregungspunkt, diesmal aus der Trobadorlyrik, kurz anzitiert; es handelt sich hierbei um den Eingang des Liedes PC 70,24 von Bernart de VentadornBernart de VentadornPC 70,24119:
| I. | Lancan folhon bosc e jarric,e·lh flors pareis e·lh verdurapels vergers e pels pratz,e·lh auzel, can estat enic,son gai desotz los folhatz,autresi·m chant m’esbaudeie reflorisc e reverdeie folh segon ma natura. |
[Wenn Wälder und Eichengestrüpp sich belauben,
und über Gärten und Wiese
die Blüte und das Grün erscheinen,
und die Vögel, die verdrossen waren,
unter dem Laub fröhlich sind,
dann singe auch ich und bin fröhlich
und erblühe wieder und werde wieder grün
und treibe Laub nach meiner Art.]
Denn in diesem Liedeingang Bernarts wird, nachdem zunächst ein tatsächlicher Natureingang in der für die Romania ganz typischen Formulierungsweise einer Wenn-dann-Relation (Lancan …autresi·m chant)120Bernart de VentadornPC 70,10Heinrich von VeldekeMF 67,9 realisiert worden ist, die Angabe, dass auch das Text-Ich – wie die Vögel – nun singe und fröhlich sei (vgl. I,6), durch eine metaphorisierende Anwendung der Naturmotivik auf die Ich-Instanz untermauert, die der in Ulrichs Leich eingesetzten Technik ziemlich genau entspricht: Das Text-Ich erblühe und werde wieder grün, so heißt es in Bernarts Lied, ja es bringe Laub hervor (vgl. I,7f.) – und zwar: nach seiner Wesensart (natura!). Damit betont das Ich interessanterweise aber nur vordergründig den außenweltbezogenen Faktizitätsgestus der Topik, denn letztendlich streicht es durch diese Äußerung nur noch deutlicher den übertragenen Sinn der auf das Ich projezierten ‹Naturvorgänge› (Erblühen, Grünen, Sich-Belauben) hervor, schließlich entsprechen diese ja gerade nicht der natura des Menschen! Durch die ins Ich hinein verschobene Natur- und Jahreszeitenmotivik, die nun die übergroße Freude des Ichs vorführt, erfolgt wiederum eine Destruktion des eigentlich dieser Thematik inhärenten, suggestiven Sogs, obwohl dieser auf der Inhaltsebene des Textes durchaus noch als funktionierend behauptet wird (die Natur freut sich – das Ich freut sich). Da jedoch aber allein die rhetorische Ebene diese Korrespondenz dadurch abbaut, dass sie die Topizität der Natur- und Jahreszeitenrede entlarvt und über die Ich-Metaphorisierung überbietet, wird die hier ausgedrückte, aus den kosmologischen Vorgängen herausgehobene Freude (Belauben – segon ma natura!) eher anders kontextualisiert werden: Zum einen steht dafür ja die Sangesthematik zur Verfügung, zum anderen ist dafür auch die im Folgenden aufscheinende, positive Erwartung des Ichs auf Seiten der Liebesthematik121 denkbar. Diese rhetorische ‹Entlarvung› und gleichzeitige Überbietung der Natur- und Jahreszeitenrede durch das Verfahren der metaphorischen Umlenkung, dessen verschiedene Facetten hier vorgeführt worden sind, scheint mir nun auch für Ulrichs Leich eine ganz entscheidende Beobachtung zu sein, da dieser Text (ebenso wie der Natureingang Bernarts) die Kipp-Potenziale dieser Topik ins uneigentliche Sprechen schon in einer erstaunlich elaborierten Weise nutzt – wie eben später, freilich wiederum in wohl noch radikalerer Form Frauenlob. Da aber durch solche Verfahren die Natur- und Jahreszeitentopik an den Rand ihrer eigenen Geltung gebracht wird (denn: ist in solchen Fällen überhaupt noch von – als ‹Außenweltphänomene› zu imaginierenden – saisonalen Naturabläufen die Rede?), ist es für die definitorische Eingrenzung des jahreszeitlich organisierten Natureingangs im Minnesang von entscheidender Bedeutung, auch die auf Faktizität und Präsentik zielende Suggestionswirkung der Natur- und Jahreszeitenmotive (bzw. ihrer Realisation) zur Voraussetzung für die Zuweisung der betroffenden Passage in den Kernbereich des Topos zu machen. Denn dass die Techniken zur metaphorischen Umlenkung in recht früher Zeit dem Minnesang als prinzipiell einlösbare Möglichkeiten, die diese Topik aber aus ihrem eigentlichen Geltungsbereich herauskippen lassen, zur Verfügung stehen, so dass auch für den Bereich möglicher Natureingänge stets mit solchen Transformationsformen zu rechnen ist, das dürfte mit Blick auf Ulrichs Leich und Bernarts provenzalisches Lied deutlich geworden sein.
Es sind freilich aber nicht nur die Verfahrensweisen der metaphorischen Umlenkung, die einen ‹Natureingang› in entscheidender Weise bezüglich der imaginativen Sogwirkung seiner Aktualitätsprogrammatik zurücktreten lassen, sondern eben auch andere Darstellungsmittel wie die mögliche Angleichung des dominant objektiv-narrativierenden Topos an das hypothetisch-reflexive Register des Werbungsliedes selbst. Ein gutes Beispiel hierfür liefert wiederum das einzige Lied des Ulrich von Gutenburg, MF 77,36Ulrich von GutenburgMF 77,36 (Lied), dessen erste Strophe lautet:
Ulrich von Gutenburg, MF 77,36: Ich hôrte ein merlikîn wol singen
| I.MF 77,36BC 1 | Ich hôrte ein merlikîn wol singen,daz mich dûhte der sumer wolt entstân.ich waene, ez al der welte vröide sol bringen,wan mir einen, mich entriege mîn wân.Swie mîn vrowe wil, sô sol ez mir ergân,der bin ich ze allen zîten undertân.ich wânde, iemen sô hete missetân,suochte er genâde, er solte si vinden.daz muoz leider an mir einen zergân. |
[I. Ich hörte eine Amsel schön singen,
so dass es mir so vorkam, als wollte der Sommer beginnen.
Ich denke, sie soll der ganzen Welt Freude bringen,
nur mir allein nicht, wenn mich meine Erwartung nicht trügt.
Wie auch immer meine Dame es wünscht, so soll es mir ergehen,
sie, der ich zu jeder Zeit untertänig ergeben bin.
Ich dachte, niemand habe etwas so Schlimmes getan,
dass, wenn er um Gnade suchen würde, er diese auch finden sollte.
Das wird leider nur bei mir nicht eintreffen.]
Es ist nun unschwer zu erkennen, dass Ulrich auch in seinem Lied mit technischen Gestaltungsmitteln experimentiert, die den Natureingang-Topos in gewisser Weise irrealisieren, denn schon mit der ins Präteritum verschobenen Angabe von Vers I,1, das Ich habe eine Amsel gehört (hôrte), ist insofern ein irritierender Liedeingang gesetzt, da dem angeführten Naturdetail, anders als in vielen sonstigen Natureingängen der Minnesangtradition, völlig sein auf Präsentik zielender Grundzug genommen ist. Diese Verunklarung der Zeitbezüge (Wann war das? Vor kurzem? Oder letztes Jahr?) bewirkt mithin für den Rezipienten eine Unsicherheit in der situationsauffüllenden Imagination, die im Weiteren durch das Text-Ich noch weiter vorangetrieben wird, wenn es lanciert, dass es sich bei der Anführung des Jahreszeitengeschehens, d.i. dass damals (!) der Sommer angefangen habe, eben nur um seine subjektive Annahme gehandelt habe (I,2: dûhte; Soll man denken, dass sich diese bewahrheitete oder nicht?). Bemerkenswerterweise sind – und dies lässt sich durch die beigegebenen Markierungen gut nachvollziehen – damit für den Bereich der Natur- und Jahreszeitenthematik genau die gleichen sprachlichen Gestaltungsmittel benutzt wie für die ganz im typischen Register des Werbungsliedes angelegte Liebesthematik, die mittels exzipierender oder hypothetischer Nebensatzfügung (mich entrüege mîn wân [I, 4] vs. suochte er genâde [I,7]) und Verben der vermutenden Hypothesenbildung (waenen [I,3 und 7]) ihren Gegenstand reflektierend ‹umkreist›, und das Ich als eines, dem etwas völlig Singuläres, ja es von der Allgemeinheit kategorial Separierendes wiederfährt, herausschält (vgl. das [wan] mir einen [I, 4 und 9]). Dadurch ist, obwohl das Ich beiden Thematiken durch die Angabe einer genau nicht an Saisonalitätsbedingungen geknüpften Dauerhaftigkeit seines Dienstes eine Differenz einzuschreiben sucht (vgl. I,6: der bin ich ze allen zîten undertân), bezeichnenderweise sowohl für die Natur- und Jahreszeitenpartie, als auch die liebesthematische Rede verunklart, ob die Einschätzungen des Text-Ichs suggestiv als zutreffend oder eben nicht zu gelten haben. Denn ob die Jahreszeitenbestimmung des Ichs als aktuell tatsächlich ablaufend imaginiert werden soll, ist genauso wie die Frage, ob die liebesbezogene Lage des Ichs wirklich so aussichtslos ist, wie dieses am Ende angibt (I,9), für den Rezipienten nicht mit Sicherheit beantwortbar. Jedoch ist es für die Einschätzung, ob das Lied nun einen Natureingang in dem hier umrissenen Verständnis realisiert oder diesen bereits auf eine Transformationsform des Topos moduliert, die aus seinem engeren Funktionsbereich hinausweist, schon nicht ganz unerheblich, wie im Falle der Natur-und Jahreszeitenthematik seine Antwort ausfällt.122 Da nun somit die Frage der Beimessung einer Faktizitäts- und Aktualitätsimagination in vielen Fällen eine nicht immer trennscharf zu lösende Abwägung gradueller Abstufungen ist, die allenfalls zu relationalen Entscheidungen führen kann, bleibt dem Unterfangen einer Eingrenzung des Geltungsbereichs der Topik ein gewisses methodisches Grundproblem eingeschrieben, das stets mitzudenken ist.
Berücksichtigt man diese Einwände, dann kann somit zu einer hoffentlich verlässlicheren Aufstellung der zahlenmäßigen Verteilung von Natureingängen im Verlaufe der Minnesangtradition gelangt werden, deren Grundzüge mit einer tabellarischen Übersicht im Anhang dieser Arbeit angedeutet werden.