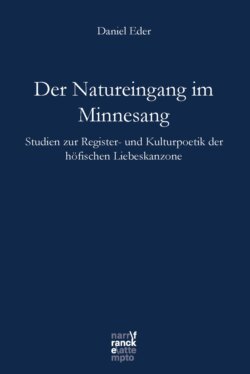Читать книгу Der Natureingang im Minnesang - Daniel Eder - Страница 7
2 Sprechregister und Konnotationsrahmen
ОглавлениеIm weiteren Verlauf der Untersuchung wird auch immer wieder einmal der vergleichende Blick auf die mittelalterlichen Liedtraditionen im europäischen Gesamtkontext des Minnesangs, etwa die Trobador- und Trouvèredichtung, besonders aber auch die mittellateinische Lyrik fallen, da es bei der – die Grenzen der einzelnen Lyriksysteme deutlich übersteigenden1 – sozusagen ‹gesamteuropäischen› Beliebtheit dieser Topik wenig einleuchtend wäre, so zu tun, als sei eine streng auf den Bereich des deutschen Minnesangs beschränkte Betrachtungsweise sinnvoll. Da freilich in einer breiter angelegten Ausrichtung der Arbeit nicht nur mehrere disziplinäre Unwägbarkeiten und Risiken liegen2, sondern eben auch die große Gefahr des Missverständnisses besteht, hier werde – mehr oder minder unbekümmert – eine Rückkehr zu längst abgelösten genetischen Fragestellungen betrieben, bedarf das weitere Vorgehen, so meine ich, einer vorausgeschickten Begründung. Dabei kann jedoch die vorliegende Untersuchung auf den bereits erreichten Kenntnisstand der etablierten mediävistischen Lyrikforschung zu den europäischen Literaturbeziehungen aufbauen, die lange Zeit zum einen mit eher formal-metrischem bzw. musikalisch-melodischem Interesse als Kontrafakturforschung betrieben worden ist,3 zum anderen im Bereich der romanisch-deutschen Literaturbeziehungen – bisweilen durchaus literatursoziologisch arbeitend – mit dem Ziel angetreten ist, eine systemspezifische Konturierung von Trobadorlyrik und deutschem Minnesang zu leisten.4 Erst in jüngster Zeit hat sich übrigens auch für das Gebiet der im Minnesang zu findenden Übernahmephänomene aus der Romania ein stärker am Inhaltlich-Motivischen ausgerichteter Ansatz der Kontrafakturforschung angedeutet.5 Jedenfalls ist im Kontext der Erforschung der romanisch-deutschen und mittellateinisch-volkssprachigen Literaturbeziehungen nicht nur der gemeineuropäische Charakter der mittelalterlichen Liebeslyrik6, die teils frappierende literarische Gemeinsamkeiten über geographische und sprachliche Räume hinweg kennzeichnet7, aufgedeckt worden, sondern es sind auch Wege der literarischen Einflussnahme zwischen den verschiedenen Literaturtraditionen nahegelegt8 und eine Vielzahl möglicher Übernahmephänomene gerade für den Bereich des deutschen Minnesangs zusammengestellt worden.9 Auch gehört es längst zum Basiswissen in der Minnesangphilologie, wie es sich unter anderem in den einschlägigen Literaturgeschichten findet10, dass nach jener ersten Phase des sog. frühhöfischen oder donauländischen Minnesangs (ca. 1150–1170), für den eher eigenständige Traditionen als bestimmend angesehen werden11, mit der ersten Teilphase des hochhöfischen Minnesangs, dem sog. rheinischen Minnesang (ca. 1170–1190/1200), eine Periode beginnt, in der sich der deutsche Minnesang mit den oberrheinischen Autoren aus dem Umkreis Friedrichs von Hausen und den geographisch ferner stehenden Minnesängern12 Rudolf von Fenis aus der Westschweiz sowie Heinrich von Veldeke13Heinrich von VeldekeMF 63,28Heinrich von VeldekeMF 58,35 aus dem Rhein-Maas-Gebiet formal-metrisch und inhaltlich-motivisch ganz eng an Vorbilder aus Frankreich anlehnt, so dass viele Minnesangtexte in diesem Bereich als relativ direkte Übernahmen von Trobador- und Trouvèreliedern angesehen werden konnten.14 Selbst wenn in der zweiten Phase des hochhöfischen Sanges um die als ‹klassisch› geltenden Autoren Heinrich von Morungen und Reinmar (ca. 1190–1210) diese direkten Übernahmen wieder größeren Eigenständigkeiten weichen15, wird an der Dominanz der aus Trobador- und Trouvèrelyrik stammenden Einflüsse für den hochhöfischen Minnesang nicht zu zweifeln sein16, ja selbst bei Walther von der Vogelweide, der gemeinhin als ‹Vollender› und ‹Überwinder›17 des hochhöfischen Minnesangs gesehen wird (ca. 1190–1230), dürften diese neben möglichen Anregungen aus der mittellateinischen Dichtung noch als bedeutend einzustufen sein.18Walther von der VogelweideL 14,38 Erst für den späthöfischen Minnesang seit Neidhart, dessen lyrische Produktion wohl auf die Jahre 1210–1240 zu datieren ist, scheinen dann neben eigenständigen deutschen Lösungen stärker auch Anregungen aus der mittelateinischen Dichtung in den Vordergrund zu treten19, wobei aber die volkssprachigen Lyriktraditionen der Romania weiterhin als Einfluss gebender Faktor nicht ausgeschlossen werden dürfen.20 Insofern kann der Grundkonsens der Forschung bezüglich der für den Minnesang in seinen verschiedenen Phasen relevanten europäischen Literaturbeziehungen mit dem Dreischritt aus relativer deutscher Eigenständigkeit (I), enger Anlehnung an die Romania (II) und freierer Interferenzlage sowie gesteigerter Eigenständigkeit (III) auf einen Nenner gebracht werden.
Darüber hinaus scheinen aber die Überlegungen zu den genaueren Einflussverhältnissen im Bereich der mittelalterlichen Liebeslyrik auch zu methodischen Problemen zu führen.
So erwächst schon einmal einige Skepsis an der traditionellen, eher formal-metrischen orientierten Richtung dieses Forschungszweiges aus den spezifischen Überlieferungsgegebenheiten des deutschen Minnesangs. Es gibt hier nämlich im Gegensatz zur Trobador- und Trouvèrelyrik – mit wenigen Ausnahmen – gerade keine anhängige Melodieüberlieferung.21 Damit stellt sich nun die Frage, wie überhaupt gesicherte Ergebnisse bei der Suche nach formalen Kontrafakturen zu erreichen sind. Schon die Diskrepanz zwischen GENNRICH und SPANKE in der Entscheidung darüber, ob die musikalisch-melodische Gestaltung (mit ihrem Aufbauschema) oder die metrische Struktur (mit Vers- und Reimschema) die entscheidende formale Dimension des mittelalterlichen Liedes bildet22, muss zu denken geben, da zunächst einmal zu klären wäre, ob nicht die (heute?) fehlende musikalische Seite der deutschen Lieder eine Klassifikation als Kontrafaktum überhaupt unmöglich macht. Dazu kommt noch, dass beide Formdimensionen – das zeigt der Blick auf die romanische Lyrik – im einzelnen Lied nicht selten unterschiedliche Wege gehen, so dass textmetrisches und musikalisches Aufbauschema sich oft erheblich unterscheiden.23 Wie kann man dann aber mit Sicherheit sagen, dass textmetrisch parallel zu romanischen Liedern gebaute deutsche Produktionen auch deren Melodie übernommen hätten?24 Dass schließlich selbst GENNRICH ein Identifizierungsverfahren von Kontrafakta für den deutschen Minnesang vorschlägt, das rein textmetrisch operiert, ist daher kaum nachvollziehbar.25 Bisweilen drängt sich daher der Verdacht auf, ein derartiges Vorgehen der Kontrafakturforschung erklärt sich möglicherweise zu einem beträchtlichen Teil aus der Sehnsucht, auch für den deutschen Minnesang überhaupt Melodien zu erhalten.26 Viel schwerer wiegt für mich noch das Problem, dass die formal-metrische Kontrafakturforschung nicht trennscharf zufällige Tongleichheiten wird ausscheiden können, ja auch der in der einschlägigen Forschungsliteratur häufig zu findende Verweis auf die zu weit verbreiteten, fast schon europäisches Allgemeingut darstellenden Formschemata, die die Identifizierung einer genauen Herkunft unmöglich machen,27 stimmt in diesem Zusammenhang doch eher skeptisch. Schließlich ist m.E. auch der Eindruck, den die Kontrafakturforschung durch ihre Konzentration auf das Formal-Metrische lange Zeit erweckt hat, nämlich dass die formale Dimension überhaupt der entscheidende Faktor sei, mittels dessen die europäischen Literaturbeziehungen zu erhellen seien, relativ problematisch. Nun hat zuletzt NICOLA ZOTZ in ihrer Dissertation den Versuch gemacht, den inhaltlichen Aspekt des Kontrafakturbegriffs in genauen Vergleichsinterpretationen praktisch anzuwenden;28 allerdings ist die begrüßenswerte Vorgehensweise, endlich auch gründliche inhaltlich-motivische Vergleichsanalysen anzustellen, noch insofern unzureichend, als die offensichtliche Orientierung am Kanon der schon von der Forschung mittels formaler Kriterien identifizierter Kontrafakturen und die immer wieder anzutreffende Absicherung der inhaltlichen Bezüge über das Formale29Friedrich von HausenMF 45,37 die konsequente Ablösung von der traditionellen Ausrichtung der Kontrafakturforschung eher behindern. Zwar gelingt es ZOTZ, den Blick auf die Vielfalt inhaltlich-motivischer Anknüpfungstechniken zu richten, die sich von freien Anregungen durch ein ganzes Lied30, über die Übernahme prägnanter einzelner Motive31, die Entlehnung einer einzelnen Strophe in einen neuen Kontext32 und die Neukombination verschiedener Quellen für ein Lied33 bis zur Übernahme ganzer Lieder34 erstrecken können, aber schließlich scheint mir gerade die Zusammenschließung dieser verschiedenen Verfahren unter dem Begriff der «inhaltlichen Kontrafaktur»35 auch methodische Probleme mit sich zu bringen. Denn man kommt so in Zugzwang, freiere intertextuelle Anspielungen und die Aufnahme weitverbreiteter Motive – einmal davon abgesehen, ob dass überhaupt in jedem Einzelfall möglich ist36 – trennscharf von bewussten Übernahmen inhaltlicher und motivischer Art abzugrenzen; dass das Kriterium der Bewusstheit der Entlehnung aber wirklich ein sinnvolles ist, ist im Ganzen doch sehr zweifelhaft. Da es mir bei meiner Argumentation, auch wenn inhaltliche und motivische Parallelen nicht völlig aus der Betrachtung ausgeblendet werden, besonders um die Erzeugung eines Konnotationsrahmens durch Aufgreifen bestimmter Tonfälle und Sprechweisen geht, also um ein textliches Assoziationsverfahren, das selbst mit einem erweiterten Kontrafakturbegriff nicht zu erfassen ist, kann auch diese jüngste Ausprägung der Kontrafakturforschung kein Instrumentarium für die von mir angestrebte Vorgehensweise bereitstellen.
Die bedeutsameren Einwände gegen die traditionelle Kontrafakturforschung ergeben sich aber gerade aus der Nähe des Fragekomplexes zu jener – vornehmlich in der älteren Forschung geführten – Debatte über die Ursprünge und die genetische Herkunft der volkssprachigen Liebeslyrik und die Herleitung von deren inhaltlicher Ausrichtung am sog. Frauendienst-Konzept. Diese Auseinandersetzung hat unter anderem mehrere literarische Herkunftstheorien bezüglich des Phänomens Minnesang hervorgebracht hat37, ist heute aber allenfalls noch forschungsgeschichtlich von Interesse, ja überhaupt sind genetische Herleitungen von literarischen Phänomenen, gerade wenn sie monokausal operieren, zu Recht in Misskredit geraten.38 So kann auch für den deutschen Minnesang, was die Frage der Herkunft des charakteristischen Frauendienstmodells anbelangt, allein noch die sog. Trobadorthese Gültigkeit beanspruchen; wenn man allerdings die heutige Skepsis gegenüber genetischen Fragestellungen ernst nimmt, wird man auch in diesem Bereich einen methodischen Einwand mitzudenken haben.39 Nun handelt es sich jedoch gerade bei dem Forschungsfeld des sog. ‹Natureingangs› auch um ein Gebiet, auf dem – zumindest für bestimmte Phasen der Minnesangtradition – genetische Erklärungsversuche, sei es durch die Herleitung aus angeblich vorgängige ‹volkstümliche› Lyrikschichten40, sei es eben als Hinweis auf die mögliche Entlehnung aus anderen europäischen Literatursystemen41, lange Zeit Konjunktur gehabt haben – und teils noch haben. Denn wie ist es anders zu verstehen, wenn FRANZ-JOSEF WORSTBROCK in einem 2001 erschienenen Aufsatz eine bestimmte Ausprägungsrichtung des Natureingangs in den Carmina Burana, die mit gewissen Stiltendenzen im Neidhart-Œuvre zu korrespondieren scheint, der mittellateinischen Literatursphäre abspricht und einer volkssprachlichen, aber durch die Überlieferung ‹verdeckten› Lyriktradition zuweist.42
WORSTBROCK geht hierbei von der These aus, dass die großen Lyriksammelhandschriften der Zeit um 1300 die vorherige Minnesangtradition nur in fragmentarischer und ganz spezifisch zugespitzter Form überliefern, und es somit ‹Lücken› von bestimmten nicht bezeugten, aber als historisch existent zu denkenden Dichtungsformen gibt.43 In diesem Zusammenhang scheint ihm nun der Bestand der Liebeslyrik des Codex Buranus (M), genauer gesagt deren mutmaßlich jüngere Untergruppe, einen Ausgangspunkt dafür zu bieten, diese verlorene Lyrikschicht zu rekonstruieren.44 Denn diese, wohl um 1230 am südlichen Alpenrand entstandene Sammlung45, die für ihren liebeslyrischen Teil an manchen Stellen komplizierteste Verschränkungen verschiedensprachiger Elemente46, vor allem aber eine prominente Partie mittellateinischer Lieder mit deutscher Ergänzungsstrophe und lateinisch-deutsche Mischgedichte aufweist, wird nämlich von der Forschung meist in eine Gruppe älterer ‹westlicher› Herkunft (Frankreich?) und eine jüngere Formation von Liedern unterteilt.47 Letztere Gruppe, die des lateinisch-deutschen Literaturkontakts, die man sich zudem in großer zeitlicher und räumlicher Nähe zur Niederschrift des Codex entstanden denkt48, geht für die lateinischsprachigen Anteile (bzw. auch einige deutsche49) offenbar auf einen oder mehrere mit der deutschen Minnesangtradition vertraute Autoren zurück50, wobei der eigentliche Status der – formal mit dem jeweils vorausgehenden lateinischen Lied korrespondierenden – deutschen Einlegestrophen in der Forschung äußerst umstritten ist51 – und allenfalls für die Strophen, die in der Parallelüberlieferung namentlich bekannten Minnesängern zugewiesen sind, geklärt scheint.52 In dieser Liedgruppe macht WORSTBROCK nun – und das ist an sich auch eine treffende Beobachtung – ein zwei- bzw. dreistelliges Textmodell aus, das aus I) Natureingang, II) Freuden- bzw. Tanzaufruf an die Jungen und III) Fokussierung auf die eine Erwählte besteht und offensichtlich Überschneidungen mit bestimmten Liedern (so Burkhards von Hohenfels KLD 6, XIBurkhard von HohenfelsKLD 6, XI53) und Liedtypen (Neidharts Sommerliedern54) aus der Minnesangtradition aufweist – gerade im Falle der Neidhartschen Natureingänge und der der Carmina Burana ist die große Nähe beider ja nun kein wirklich neuer Befund.55 Die Vorstellung der älteren Forschung, dies gehe auf einen Einfluss der mittellateinischen Lyrik auf Neidhart zurück, dreht der Verfasser nun aber einfach um, indem er die besagten Minnesang-Randphänomene und die lateinischen wie deutschen Strophen der angeblich ‹jüngeren› Carmina Burana-Gruppe darauf als Residuen einer verloren gegangenen und durch die einseitige Überlieferung ‹überdeckte› volkssprachliche Lyriktradition deklariert.56 Nicht nur, dass damit freilich eine strikt genetische Erklärung bestimmter Überschneidungen in keinster Weise aufgegeben ist: Hierfür gibt es zudem überhaupt keinen Beleg, denn von einer solchen höchst spekulativen Lyrikschicht ist ja genau nichts überliefert. Zum anderen erweisen sich die angeblichen Unterschiede zwischen der sog. ‹jüngereren› CB-Gruppe und der sonstigen (rhythmischen) mittellateinischen Liebeslyrik als überhaupt nicht derart drastisch, dass eine vollständige Separierung des Hauptüberlieferungsträgers dieses Literaturstranges in zwei unterschiedliche Repertoires wirklich gerechtfertigt wäre; gerade etwa die als so auffällig angeführte Verknüpfung von Naturthematik und Freudenaufruf an die Jugend57 ist eine auch sonst in der mittellateinischen Lyrik sehr gängige Zuschreibungskonstellation.58 Mit einer derartigen Aufspaltung des sicher heterogenen, aber doch nicht völlig unvereinbaren Liebesliedbestandes der CB wird nun eine – zumindest für die Einrichter der Handschrift – zusammengehörende Sammlung auseinandergerissen und ein nicht unbedeutender Teil des Corpus der mittellateinischen Liebesdichtung überhaupt für eine angeblich deutsche Lyriktradition, die niemand belegen kann, vereinnahmt – man kann das durchaus als eine Marginalisierung dieser Tradition selbst wahrnehmen, die möglicherweise mit bestimmten Vorbehalten gegen eine Gelehrsamkeitskonnotationen aufweisende Literatur überhaupt verbunden und dem romantisierenden Interesse, diese letztendlich wieder in einen Bereich des Naturhaft-Volkstümlichen rückzuholen, geschuldet ist. Dass die Thesen WORSTBROCKS in der neueren Neidhart-Forschung grundsätzlich positiv und allenfalls vorsichtig einschränkend aufgenommen worden sind, ist für mich aus forschungsgeschichtlichen Gründen verständlich, wenn auch nicht gut begründbar.59Carmina BuranaCB 92 Es mag zwar richtig sein, dass nicht immer automatisch alles, was ‹in lateinischem Gewande› daher kommt, auch wirklich als gelehrsam zu gelten hat60; umgekehrt ist aber – gerade aus kulturhistorischer Sicht – auch nicht alles, was uns heute naturhaft und ‹naiv› anmutet, zwingend als mit Konnotationen des ‹Volkstümlichen› aufgeladen zu denken. Wer daran für die Carmina Burana zweifelt, der möge sich tatsächlich nur einmal das Bildprogramm der Handschrift betrachten – in die Richtung volkstümlicher Naivität scheint es mir jedenfalls nicht zu weisen.61
Somit halte ich es für geboten, im Folgenden allein bei der Stufe des literarischen Vergleichs stehen zu bleiben, bewusst nicht Aussagen über genetische Zusammenhänge zu treffen und lediglich den Konnotationsrahmen aufzeigen zu wollen, der sich für bestimmte charakteristische Erscheinungen des Natureingangs im Kontext der europäischen Lyrik ergibt. Denn eine Möglichkeit, über die die Grenzen der einzelnen europäischen Lyriktraditionen überschreitenden Bezüge und Bezogenheiten im Falle dieses Gestaltungsmittels gewinnbringender als strikt genetisch zu sprechen, scheint mir nun aber die Bemühung bereitzustellen, die bei dessen poetischer Umsetzung mitschwingenden konnotativen Anhaftungen zu ergründen, die sich an bestimmten Tonfällen in der sprachlichen Realisation, man könnte auch sagen dem genutzten ‹Sprechregister›, festmachen lassen.
Mit diesem Begriff ist der Hinweis auf die bedeutende Abhandlung «La lyrique française au moyen âge (XIIe-XIIIe siècles). Contribution à une typologie des genres poétiques médiévaux»62 des Romanisten PIERRE BEC nun überfällig, die einen zentralen Anregungspunkt der folgenden Ausführungen darstellt, ja aus der der Verfasser das terminologische Instrumentarium und den analytischen Zugriff entlehnt und für die hier angestrebte vergleichende Untersuchung von Texten der verschiedenen europäischen Lyriktraditionen nutzbar zu machen sucht. Der in dieser 1977 einem nachfolgenden Textband vorausgeschickten Studie erfolgte Systematisierungsentwurf BECS zur mittelalterlichen Lyrik in Frankreich operiert mit der Aufteilung des dortigen Lyriksystems in zwei große sozio-poetische Register, das registre aristocratisant (I) und das registre popularisant (II)63, die aber nicht strikt unabhängig voneinander existieren, sondern auf vielfältige Weise miteinander interferieren.64 Diesen Registern lassen sich unter anderem nicht nur jeweils unterschiedliche soziale Trägergruppen (I: adlige Trobadors und Hofdichter; II: fahrende Spielleute) und unterschiedliche Gattungen (I: der grand chant courtois, repräsentiert durch die Canso und ihre Satellitengattungen; II: das Frauenlied in allen seinen Spielarten65)66, sondern eben auch eine unterschiedliche sprachliche Organisationsform (I: zutiefst lyrisch geprägt; II: lyrisch-narrativ, lyrisch-tanzgebunden) zuordnen.67 Noch bedeutsamer für unseren Zusammenhang aber ist, dass BEC bei seiner kontrastiven Gegenüberstellung der beiden Register neben der inhaltlich-motivischen Ebene auch die der sprachlichen Gestaltung nicht außer Acht lässt, wenn er schreibt:
A ces grands traits contrastifs il faut ajouter évidemment des claviers thématiques et motiviques différents, de procédés de style et de formulation, des indices linguistiques ou anthroponymiques particuliers […], qui constituent classèmes conférant des connotations démarcatrices.68
Über die jeweils unterschiedlichen thematisch-motivischen Klaviaturen hinaus weist BEC also ausdrücklich auf die Bedeutung der unterschiedlichen Stilistik und Ausdrucksweise sowie der linguistischen Anzeichen hin, die als semantische Merkmalsträger abgrenzende Konnotationen erzeugen und so die Zuweisung der Texte zu den beiden Registern steuern.69 Hieraus folgt, dass beiden Formationen, dem registre aristocratisant und dem registre popularisant, auch eine jeweils spezifische Sprechweise, eben ein charakteristisches Sprechregister zugeordnet ist. Damit lenkt BEC – und das stellt m.E. auch den großen Verdienst seiner Überlegungen dar – den Blick in beispielhafter Weise auf das Wie von Sprache, nämlich: wie etwas sprachlich ausgedrückt ist und welche Konnotationen sich dadurch ergeben, eine Textdimension, deren Wichtigkeit bei der Lyrikanalyse nicht zu unterschätzen ist.70 Leider ist aber der Ansatz PIERRE BECS in der Altgermanistik bisher noch nicht ausreichend gewürdigt worden, denn – mögen die sozialen und gattungssystematischen Implikationen seines Registerbegriffs für den deutschen Minnesang auch unpassend sein71 – genau in jener Aufmerksamkeit für die konnotativen Anhaftungen, die sich durch bestimmte Sprechweisen, also die sprachliche Realisation, ergeben, scheint mir eine sinnvolle Richtung angezeigt, die zu beschreiten auch für die Minnesangforschung ein lohnenswertes Unterfangen wäre.72 Besonders in der interpretativen Praxis kann der von BEC entlehnte Registerbegriff, gerade wenn er vornehmlich auf die sprachliche Dimension hin profiliert ist, ein äußerst taugliches Analyseinstrument liefern, mittels dessen sich viele feine Nuancen der sprachlichen Konstruktion von Texten, ja die durch Kombination von verschiedenen Sprechweisen entstehenden elaborierten Interferenzverhältnisse trefflich erfassen und einordnen lassen, was für den deutschen Minnesang noch viel zu selten erprobt worden ist.73
Auch im Zusammenhang des hier verfolgten Frageansatzes, bei dem es um die Ergründung des Konnotationsrahmens bestimmter textueller Erscheinungen geht, die übrigens für die traditionelle Ausprägung des Werbungsliedes im deutschen Minnesang gerade nicht typisch sind, erweist sich der Begriff des Sprechregisters als äußerst hilfreich. Denn er öffnet noch einmal deutlich den Blick dafür, wie hervorstechend sich poetische Topoi wie objektiv gesetzter ‹Natureingang› in der Umgebung der traditionellen Sprechweise des Werbungsliedes ausnehmen, die durch Begriffe wie weitgehende Abstraktheit, Vermeidung genauer situativer Festschreibung, reflexives Ich-Sprechen etc. umrissen werden kann. Zu jener muss auch das charakteristische, immer wieder neu ansetzende argumentative Kreisen74 gezählt werden, das durch die Nutzung rhetorischer Mittel wie Antithese und Paradoxie sowie syntaktischer Konstruktionen wie exzipierender Nebensatz und Konditionalgefüge erreicht wird, wie es WIEBKE SCHMALTZ am Beispiel Reinmars eindrucksvoll vorgeführt hat.75 Was die bei dem beschriebenen Sprechregister des Werbungsliedes mitschwingenden Konnotationen anbelangt, kann man durchaus annehmen, dass hier der Hinweis auf höfische Kultiviertheit auch auf der Ebene der sprachlichen Realisation des Gesagten aufgerufen wird, weswegen es m.E. nicht unpassend ist, sich an BECS Terminus einer aristokratisierenden Sprechweise anzulehnen. Denn gerade jenes unbestimmte, indirekt-hypothetische und hochgradig reflexive Ich-Sprechen der Minnekanzone scheint sich mir, besonders in Abhebung zu Sprechweisen anderer lyrischer Typen, in denen viel konkreter und körperlicher über Liebesdinge gesprochen wird (zu denken wäre etwa an die oft als ‹Schwanklieder› bezeichneten erotischen Erzähllieder76) mit Konnotationen höfischer Vorbildlichkeit aufzuladen.77 Ob aber das Gegenstück des von BEC als aristokratisierend bezeichneten Registers, das etwa popularisierend oder parafolkloristisch zu nennen wäre, auf den Bereich des deutschen Minnesangs übertragen werden kann, muss schon allein deshalb fraglich bleiben, weil die für diese Registerformation in Frankreich so zentrale Figur des Jongleurs im deutschen Raum keine derart bestimmende Rolle spielt.78 Ferner sind jene dem aristokratisierenden Register nicht zugehörigen Elemente, die auch und besonders im späthöfischen Minnesang in den Bereich des Werbungsliedes Eingang finden und so kunstvoll mit jenem Sprechen interferieren, nicht automatisch als popularisierend-parafolkloristisch zu klassifizieren, sondern es ist jeweils nach den sich mit ihnen verbindenden Konnotationen überhaupt erst zu fragen. Im Falle des immer wieder als ‹volkstümliches› Element charakterisierten poetischen Mittels ‹Natureingang› wird der Blick auf die mittelalterliche europäische Lyriklandschaft auch eine andere konnotative Beimessung nahelegen und – so wird es im Folgenden diskutiert werden – möglicherweise einen Verweisgestus erkennen lassen, der die Texte konnotativ (auch) mit dem Bereich der lateinischen Gelehrsamkeit zu verbinden sucht.79 Denn erst so wird sich das volle ästhetische Potenzial dieser literarischen Technik, das sich eben durchaus zwischen den Polen einer höfisch-artistischen Meisterschaft und Bezügen zu lateinischen Diskursformationen aufspannt, erst vollends abschreiten lassen.