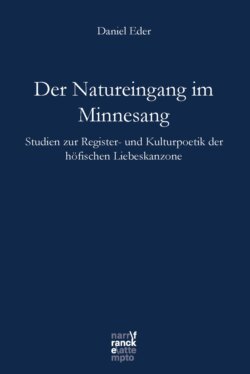Читать книгу Der Natureingang im Minnesang - Daniel Eder - Страница 11
III Typeneinteilung des Natureingangs 1 Vorstellung eines Typenschemas mit der Basisunterscheidung ‹komplementär vs. kontrastiv›
ОглавлениеBetrachtet man die hier zuvor im Forschungsbericht bereits vorgestellten Vorschläge der Minnesangphilologie zur typologischen Einteilung des Natureingangs bzw. Jahreszeitentopos, so fällt auf, dass dort gerade die in einführenden Darstellungen1 und Lexikonartikeln2 zur Spezifizierung des Topos genutzte, aber auch in der interpretatorischen Praxis oft begegnende Dichotomie von kontrastiver vs. komplementärer Einbindung überraschenderweise keine prominente Rolle gespielt hat. Da aber m.E. weder Gestaltungsmerkmale wie der Grad der liedinternen Ausdehnung der Natur- bzw. Jahreszeitenrepräsentation3 oder die Realisationsform als objektiver Bericht, ‹szenische› Episode bzw. subjektive Diagnose des Ichs4NeidhartSL 14/SNE I: R 15NeidhartSL 10/SNE I: R 11 noch kategoriale Bestimmungen wie die Intensität eines (möglichen) Außenweltbezugs5 zu einer schlüssigen Typeneinteilung des Natureingangs im deutschen Minnesang geeignet scheinen, soll hier im Folgenden versucht werden, genau jene auf die Einbauweise des Topos bezogene Opposition für eine typologische Systematisierung nutzbar zu machen. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass eine detailgenaue Untersuchung der Natureingänge auf ihre spezifische Gestaltungsweise hin getrost beiseite geschoben werden kann; ganz im Gegenteil wird diese für den Bereich der Einzelinterpretation von zentraler Bedeutung sein. Für die an dieser Stelle aber zunächst angestrebte typologische Einteilung der Natureingänge im Minnesang scheinen die Art und Weise des Einbaus des Topos in das jeweilige Liedgefüge und die Techniken der Anbindung der Natur- bzw. Jahreszeitenmotivik an andere thematische Konstituenten wie die emotionale Befindlichkeit des liebenden Ichs6Ulrich von GutenburgMF 77,36 (Lied) nun auch insofern besonders günstig zu sein, weil sie in vorzüglicher Weise Aufschlüsse über die poetische Funktion des Natureingangs ermöglichen. Zwar ist jene Einbautechnik, die an den Natureingang die Gefühlslage eines liebenden Ichs argumentativ anbindet, nicht die einzige Setzweise des Topos, die im Minnesang überhaupt begegnet, wie dies bisweilen verkürzend behauptet worden ist7, aber sie scheint dennoch für den Bereich des deutschen Minnesangs im hier untersuchten Zeitraum – d.i. ab der zweiten Hälfte des 12. bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts8 – als dominanter Kernbereich des Spektrums der möglichen Anbindungsweisen anzusehen zu sein, auf den die anderen Formen der Setzweise konnotativ referieren können.
Ein Beispiel dafür ist jene Gruppe von Liedern, die das Verhältnis von durch die Jahreszeit hervorgerufener Natur- bzw. Gesellschaftsstimmung und der Gefühlslage des Ichs der Liebesthematik nicht explizit ausformulieren, sondern Natureingang und emotionale Befindlichkeit des liebenden Ichs argumentativ unverbunden nebeneinanderstellen (s. unten, Typ B.). M.E. sind jene Beispiele nicht als Kronzeugen für einen angeblich schematisch-formelhaft und somit funktionslos gewordenen Topos zu werten, sondern als ein spezifischer Typ in der Setzweise des Natureingangs zu begreifen, der den Interpretationsraum für den Rezipienten dadurch öffnet, dass die Sinnbezüge zwischen Naturstimmung und Ich der Liebesthematik zunächst in der Schwebe gehalten werden. Allerdings kann mittels interpretatorischer Operationen auf Seiten des Rezipienten dieser Raum durchaus mit dem Wissen um die dominante Form der Anbindungsweise wieder (partiell) aufgefüllt werden, wenn er die auf das poetologische Muster der Einbauweise zielenden Konnotationen, die allein der Einsatz eines Natureingangs schon mit sich bringt, für sich nutzbar zu machen weiß. Betrachten wir, um dies plausibel machen zu können, deshalb kurz den Anfang von Ulrichs von Winterstetten Lied KLD 59, VUlrich von WinterstettenKLD 59, V:
| I.C 15 | Der svmer mit gewalde hatbekleidet walt und ovwe,der anger wol geblvemet statin svessem meien tovwe.dú heide breit hat gruene kleitan sich geleit ist mir geseit,in wunneklicher schovwe.Min frowe ist gvot, swie si doch tůt mich vngemvot. |
| II.C 16 | Min vngemvete ist gar zegros,als ich úch wil bescheiden:ich sten ir helfe leider blvos,dú mich in senden leidenmit froemder tat an allen rat,swies mir ergat, nv lange latals einen wilden heiden.Min frowe ist gvot [swie si doch tůt mich vngemvot]. |
| I. Der Sommer hat mit MachtWald und Aue bekleidet,der Anger steht schön mit Blumen geschmücktim anmutigen Tau des Maies.Die weite Heide hat grüne Kleidersich angelegt, hat man mir gesagt,und gewährt herrlichen Anblick.Meine Dame ist gut, obgleich sie mich dochverdrossen macht. | |
| II. Mein Verdruss ist ganz und gar übergroß,wie ich euch mitteilen will:Ich stehe ohne Beistand da von ihr,die mich in Sehnsuchtsschmerzenmit distanziertem Verhalten und ohne jede Abhilfe,wie es mir auch ergeht, nun lange belässtwie einen wüsten Heiden.Meine Dame ist gut … |
Im Falle von Lied KLD 59, V ist nämlich der sommerliche Natureingang, der sich über den gesamten variablen Strophenkörper von I (1–7) erstreckt, ohne jede argumentative Verbindung dem Liedrefrain (8), der die Liebesthematik einführt, vorgeschaltet, die dann in Strophe II ohne Wiederanknüpfung an den Natureingang weiterentwickelt ist. So wird zunächst in der ersten Strophe angegeben, dass der Sommer mit gewalde (I,1) – eine Herrschaftsvokabel, die auch oft im winterlichen Natureingang zu finden ist und im Umfeld des Motivkreises einer kämpferischen Auseinandersetzung der Jahreszeiten anzusiedeln ist9NeidhartWL 25/SNE I: R 1NeidhartSL 8/SNE I: C Str. 280–284Gottfried von NeifenKLD 15, XXXII – Wald und Aue eingekleidet habe (vgl. ebd.). Dadurch ist die Bekleidungsmetaphorik als traditioneller Bestandteil der Motivik des Natureingangs aufgegriffen, die im Übrigen im weiteren Verlauf der Strophe auch für die Präsentation der sommerlich verwandelten Heide noch benutzt wird (vgl. I,5f.) und so im gesamten Natureingang von KLD 59, V eine prominente Rolle spielt. Weiter wird angegeben, dass der Anger, den nun schöne Blumen zieren (vgl. I,3), von svessem meien tovwe (I,4) benetzt sei, und nimmt mit dieser charakteristischen Formulierung10Heinrich von VeldekeMF 58,11Heinrich von VeldekeMFMT XI, Nr. XXXVIIGottfried von StraßburgMFMT XXIII, Nr. IIWolfram von EschenbachMFMT XXIV, Nr. VIGottfried von NeifenKLD 15, VIIGottfried von NeifenKLD 15, XIVGottfried von NeifenKLD 15, XVIIIGottfried von NeifenKLD 15, XLVIIIGottfried von NeifenKLD 15, XLVIUlrich von WinterstettenKLD 59, XXVUlrich von WinterstettenKLD 59, XXXV wohl in direkter Weise auf eine Passage des breit angelegten Natureingangs von Neidharts SL 15NeidhartSL 15/SNE I: R 2211NeidhartSNE I: C Str. 272–275SteinmarSMS 26,13 Bezug, wodurch die – im Übrigen nicht nur dort12NeidhartSL 17/SNE I: R 50NeidhartSL 24/SNE I: R 57NeidhartSL 7/SNE I: C Str. 266–271 – mit dem Motiv des Taus verbundenen erotischen Konnotationen durchaus auch in Ulrichs Lied mit aufscheinen. Zuletzt hat nämlich ANNA KATHRIN BLEULER die Bedeutung des Taumotivs in den Sommerliedern Neidharts zur Anlagerung erotischer Konnotationen an den Natureingang gerade am Beispiel von SL 15 herausgearbeitet und hierbei betont, dass dieses Element «im Zusammenhang mit der frühlingshaften Erneuerung der Natur als Symbol für Befruchtung bzw. Schwängerung steht» und oft in Kombination mit dem Kranzmotiv genutzt wird, das «die Liebesbereitschaft der Akteure» signalisiere.13 Diese motivische Verbindung findet sich auch in der dritten Strophe von SL 15, die ich hier nicht in der hergestellten Fassung der ATB-Ausgabe von Wießner (nach der Liedvariante c 21), sondern in der in SNE I abgedruckten Lesart von R zitiere, die jedoch bezüglich des metrischen Schemas nicht ganz regulär zu verfahren scheint:
| R 22, III. | Urloup nam der winder ab der heide,da die blumen stunden wunnechlich gevarin liehter ougenweide,begozzen mit des suzzen mayen towe.«der het ich gern ein chrænzelin,geselle», sprach ein vrowe. |
[Abschied nahm der Winter von der Heide,
wo die Blumen herrlich gefärbt
in leuchtender Pracht standen,
begossen vom Tau des süßen Maies.
«Von denen hätte ich gern ein Kränzchen,
Freund!», sprach eine Dame.]
Interessanterweise zeigt sich an der Natureingangs-Strophe14– denkt man sich die nur von den neuzeitlichen Editoren gesetzten Anführungsstriche weg – wiederum das schon angesprochene Verfahren Neidharts, Sprecheridentitäten zu veruneindeutigen, da erst am Ende der Strophe durch die inquit-Formel in III,4 nachträglich die Äußerung des Kranzwunsches als Frauenrede festgelegt15 und so die Tatsache offenbar wird, dass das Sprechen des Sänger-Ichs geendet hat; auch ist im Nachhinein die gesamte Strophe als Frauenrede konzeptualisierbar.16 Als außergewöhnlich erweist sich ferner, dass die weibliche Sprecherin an dieser Stelle nicht wie sonst sehr häufig die maget des sommerliedtypischen Bauteils ‹Frauendialog› ist, sondern als vrowe spezifiziert ist.17 Dies ist für die konnotativen Anhaftungen, die sich für Ulrichs KLD 59, V durch den intertextuellen Verweis auf Neidharts SL 15 ergeben, insofern von Bedeutung, als im Neidhart-Lied es eine als aristokratisch ausgewiesene vrowe ist, die durch den von ihr geäußerten Wunsch, aus den taubegossenen Blumen von ihrem Geliebten einen Kranz gewunden zu bekommen, in ihrer Bereitschaft zur Liebesvereinigung gezeigt wird.18NeidhartSL 21/SNE I: R 51 Durch die Benennung der weiblichen Sprecherin als vrowe wird jedoch auch ein Konnex zum Werbungslied und der dort vom Text-Ich verehrten, aber von diesem zumeist als dem Liebesbegehren gleichgültig oder ablehnend gegenüberstehend imaginierten vrowe evoziert. Zwar wird in Neidharts SL 15 bezeichnenderweise nicht die vrouwe des Werbungsliedes präsentiert, sondern nur ein vrowe, man wird jedoch dennoch sagen können, dass hier diese Funktionsstelle der Werbungsliedfiktion aus dem Blickwinkel des anders situierten Genrekontextes des Sommerlieds, das die sommerliche Jahreszeit als die Saison des Wunsches nach Liebeserfüllung evoziert, konterkariert bzw. kommentiert wird. Dies alles verdichtet sich in Ulrichs Lied V, wenn nach der Evokation des taubefeuchteten Angers im Natureingang der Refrain die Dame des Text-Ichs (Min frowe [8]) als eine charakterisiert ist, die das Ich vngemvot (ebd.) macht und, so dürfte sich der Konnotationsrahmen durch die intertextuelle Verbindung zu SL 15 aufspannen, genau nicht – wie die eine Dame in SL 15 – eine Bereitschaft zur Liebeserfüllung erkennen lässt. Diese Deutung ist allerdings eine recht spezifische Variante im für den Rezipienten sich eröffnenden Raum möglicher Sinnzuweisungen, die Lied V durch seine unvermittelte Setzweise des Natureingangs aufmacht, welche es hier noch näher weiterzuverfolgen gilt.
Nach der Aufrufung des vom Maientau benetzen Angers erfolgt nun in Ulrichs Lied V die Wiederaufnahme der natureingangstypischen Bekleidungsmetaphorik durch die Angabe, die Heide habe sich ein grünes Kleid angelegt, wiederum in recht spezifischer Weise. Denn dadurch, dass dieses Naturdetail in Vers 5f. in der binnenreimgespalteten Passage des Abgesangsbeginns erscheint, der durch jeweils vier Halbverse mit reimender männlicher Kadenz gesetzt ist, ist es allein schon formal hervorgehoben, da bisher im Strophenbau des Liedes noch keine Binnenreimzergliederung erfolgt ist. Betrachtet man nun die hier gemachte Angabe, dú heide breit hat gruene kleit / an sich geleit ist mir geseit (I,5f.) genauer, so fällt auf, dass diese sich von den zuvor im Natureingang des Liedes in objektiver Setzung aufgeführten Naturerscheinungen dadurch unterscheidet, dass der – wie bei den Naturdetails zu Beginn (I,1f.) auch – im Perfekt realisierten, aber resultativ-präsentischen Information (die Heide hat ihr Sommerkleid angezogen) noch ein Halbsatz nachgeschaltet ist, der diese nicht nur als ein über Dritte vermitteltes Wissen entlarvt (ist mir geseit [I,6]) und somit in ihrem fiktiven Objektivitätsgehalt desavouiert, sondern auch überhaupt die Setzung in objektivem Bericht schlagartig in die subjektive Wiedergabe aus der Ich-Perspektive verschiebt. Durch die offenkundige Diskrepanz eines sich zu Beginn des Natureingangs als pseudoneutral gerierenden ‹Tatsachenkatalogs› – der Sommer hat Wald und Aue bekleidet, der Anger steht in von Tau benetzten Blumen – zu einer aus subjektiver Perspektive wiedergegebenen Information, die sich – durch nachgeschobene Rechtfertigung – nicht einmal als aus einer durch das Ich selbst gemachten, direkten Wahrnehmung resultierend, sondern nur als dem Hörensagen nach erfolgt herausstellt, bezieht der Natureingang ein gewisses Komikpotential, das jedoch durch die den Abgesang komplettierende Verszeile in wunneklicher schovwe (I,7) wieder aufgefangen wird, die nach den binnenreimzergliederten, männlich endenden Halbversen durch ihren unzerteilten, weiblich kadenzierten Bau auch rein formal abschließenden Charakter hat. Da die in ihr gegebene Information, der Vorgang der Kleidanlegung durch die Heide habe zu einem herrlichen Anblick derselben geführt, in einer aus dem regulären Satzbau herausgenommenen Phrase erscheint und vom syntaktischen Kontext durch den Einschub ist mir geseit (I,7) abgetrennt ist, wird die rekapitulativ-zusammenfassende und einen Schlusspunkt suggerierende Wirkung der Angabe deutlich erhöht, so dass die zuvor sich andeutende Desavouierung des Natureingangs nur kurz aufflackert und sofort wieder zurückgebogen wird. Mit Vers 7 endet nun also nicht nur formal der reguläre Strophenbau der Kanzonenform, sondern auch inhaltlich der thematische Abschnitt des Natureingangs. Gerade dadurch, dass beide Gliederungsebenen hier zusammen fallen, wird jedoch deutlich, dass im Grunde der typische Zielpunkt eines Natureingangs, die argumentative Anbindung an die emotionale Befindlichkeit des liebenden Ichs, nicht eingelöst wird, obwohl er sich doch durch das schlaglichtartige Aufscheinen einer Ich-Position in Vers 6 zumindest angedeutet hatte. Vielmehr wird der – auch formal eigenständige – Natureingangsteil ohne jede argumentative Vermittlung mit einem Refrain konfrontiert, der die Liebesthematik durch seinen thesenhaften Charakter quasi holzschnittartig neben den anders gelagerten thematischen Kontext der Strophe stellt: Min frowe ist gvot, swie si doch tůt mich vngemvot (8). Dieser Refrain erweist sich nicht nur als thematischer Kern des gesamten Liedes, der durch Binnenreimzergliederung seine inhaltliche Prägnanz zudem formal unterstreicht, sondern auch als pointierte Zusammenfassung des Paradoxons unerfüllter Liebe, das der Textsorte des Werbungsliedes idealtypisch zugrunde liegt, und in dem die eigentlich widersprüchlichen Empfindungen des Ichs – Glück über die Vollkommenheit der Dame und Frustration wegen des ausbleibenden Erfolgs der Werbung – komprimiert sind. Denn im Refrain ist hier der die Wertschätzung der Dame durch das Ich zunächst propagierenden Aussage Min frowe ist gvot auf engstem Raum die zugleich erfolgende Einschränkung beigegeben swie si doch tůt mich vngemvot, die die zuvor gemachte Angabe über die Integrität der Dame – hier durch das Adjektiv guot durchaus im Sinne moralischer Vorbildlichkeit konzeptualisierbar – mit der Klage des Ichs darüber konfrontiert, dass die Dame dem Ich aber Verdruss bereitet. Die im Grunde paradoxe Fügung – denn eine, so suggeriert der Text, untadelige Frau würde doch niemandem unbegründet Kummer zufügen – wird jedoch vom Refrain argumentativ nicht eindeutig zugunsten einer der beiden Aussagen aufgelöst; denkbar wäre z.B. «Die Dame ist, weil sie mich so behandelt, doch nicht so gut» (a) oder «Da die Dame ja gut ist, muss sie den Makel ihres Verhaltens mir gegenüber beseitigen» (b1), ja selbst: «Es ist völlig unerheblich, ob meine Dame mir Kummer bereitet, sie ist gut!» (b2). Da das Paradox des Refrains jedoch ohne eine solche Klärung stehen bleibt, eröffnet sich für den Rezipienten ein Deutungsraum, der mittels des Konnexes zum variablen Strophenkörper somit durch Herstellung sinnhafter Querverbindungen jeweils spezifisch gefüllt werden kann, so dass der – an sich invariable – Bauteil des Kehrverses sich von Strophe zu Strophe in seiner semantischen Aufladung durchaus ändern kann.19 Im Falle der ersten Strophe – dem kontextuellen Aufeinandertreffen von einem semantisch in der Schwebe befindlichen Refrain mit dem in sich geschlossenen Natureingangsteil – ergibt sich nun für den Rezipienten ein besondere Leerstelle zur interpretierenden Zuordnung, da hier sogar zwei in ihrer Thematik differierende Partien aufeinandertreffen, die nach der Zuweisung einer sinnhaften Inbezugsetzung verlangen. Einzig die im Natureingang kurz aufflackernde Ich-Perspektivierung scheint hierbei eine Verbindung zum Ich-Sprechen der im Refrain aufgerufenen Liebesthematik anzuzeigen, jedoch muss die genaue Deutung des Zusammenhangs von Natureingang und Liebesthematik im Refrain vom Rezipienten mittels interpretatorischer Operationen erschlossen werden. Für die Füllung des vom Text aufgemachten, in der Schwebe befindlichen Deutungsraumes kann jenem das typologisch dominante poetologische Muster der Einbauweise des Natureingangs, also das Wissen, das er aus anderen Texten gewonnen hat, helfen. Es handelt sich hierbei um die argumentative Verknüpfung, die über die Profilierung der emotionalen Befindlichkeit des Text-Ichs erfolgt und die die eigentlich jahreszeitenadäquate mit der tatsächlichen Gestimmtheit des liebenden Ichs über die Basisopposition einer Gleich- vs. Gegengerichtetheit in eine Sinnrelation setzt. Es ist also mittels des Zurückgreifens auf die Minnesang-Tradition einerseits möglich, beide Teile interpretativ durch Unterlegung einer komplementären Relation in Bezug zu setzen: «Es ist Sommer, die ganze Natur ist schön und alle freuen sich, ja auch mir geht es jetzt besser» (I)20; jedoch ist es andererseits aufgrund dieses Vorwissens ebenso denkbar, eine kontrastive Inbezugsetzung zu unterlegen, die in etwa so zu formulieren wäre: «Es ist Sommer und alle freuen sich (so wie es sich gehört), ich aber bin traurig» (II)21Heinrich von VeldekeMF 56,1. Im Falle des Refrains von Lied KLD 59, V stehen nun aber gerade für beide Varianten Anknüpfungspunkte bereit. Nähme man nämlich die Äußerung des Text-Ichs, Min frowe ist gvot (8), isoliert als Ausgangsbasis einer solchen interpretatorischen Operation, so wird man zu der Sinnunterlegung I kommen und einen komplementären Bezug zwischen Jahreszeitengeschehen und emotionaler Befindlichkeit annehmen, nämlich in etwa: «Es ist Sommer und alle sind froh; ich bin es auch, weil meine Dame gut ist». Damit wäre die Relation von passender Jahreszeitenstimmung und Ich-Befindlichkeit im Übrigen dann ganz ähnlich zu dem zu konzeptualisieren, was uns das Reinmar-Lied MF 188,33ReinmarMF 188,33: Ich sach vil wunneclîchen stân bezüglich der (potentiellen) Einbindung eines Natureingangs vorstellt, wo es in der zweiten Strophe der hergestellten MFMT-Fassung22 heißt:
| II.MF 184,3C 140 | Dô ich daz grüene loup ersach,dô liez ich vil der swaere mîn.von einem wîbe mir geschach,daz ich muoz iemer mêre sînVil wunneclîchen wol gemuot.ez sol mich allez dunken guot,swaz sî mir tuot. |
[Als ich das grüne Laub erblickte,
da gab ich viel von meiner Bedrücktheit auf.
Es geschah mir von einer Frau,
dass ich fortan immer
ganz herrlich freudig gestimmt sein muss.
Es wird mir all das gut vorkommen,
was sie mir irgend tut.]
Eine derartige Konzeptualisierung des Bezugs zwischen Natureingang und emotionaler Befindlichkeit des liebenden Ichs mag der Rezipient im Falle von Ulrichs Lied V aufgrund seines Vorwissens aus der Minnesangtradition durchaus kurzzeitig abrufen, wenn er nach dem unvermittelt endenden Natureingangsteil mit der Feststellung des Text-Ichs konfrontiert wird, seine Dame sei gut. Sehr gut denkbar wäre im Übrigen auch ein recht enges intertextuelles Verknüpfungsverhältnis mit Leutholds von Seven Lied KLD 35, ILeuthold von SevenKLD 35, I, das teilweise durch den Refrain von Ulrichs Lied V zitathaft aufgerufen ist23Gottfried von NeifenKLD 15, XXIII und – wie das obige Reinmar-Lied – ebenfalls über einen komplementär an das Ich gebundenen Sommereingang24 verfügt, allerdings diesen mittels der Technik einer Ablehnung der Geltung des Naturgeschehens für das Ich25 realisiert. Ich gebe hier den Anfang von KLD 35, I in der Fassung der Handschrift A (dort divergierende Autorzuweisung!) an26:
| I.A 39(Der jungeSpervogel)B 1, C 1 | In dem walde vnd vf der grvonen heidesmeket ez so rehte wol,daz man sich der lieben ovgen weidewol von schvlden trosten sol:so han ich vor seneden mvottrost dekeinen wan den einendaz min frowe ist gvot. |
[Im Wald und auf der grünen Heide
duftet es wirklich derart gut,
dass man sich an der angenehmen Augenpracht
gewiss zu Recht trösten muss:
jedoch habe ich für meine sehnsuchtsvolle Stimmung
keinen Trost, außer dem einen,
dass meine Dame gut ist.]
Damit ist in Leutholds Lied der Aspekt betont, dass die Tröstung des liebenden Ichs – anders als bei Reinmars MF 188,33, wo die tröstenden Instanzen Natur und Dame nicht explizit gegeneinander ausgespielt sind – überhaupt nicht von der sommerlichen Natur, sondern rein von der Dame ausgeht, ist doch die zitierte Passage so zu paraphrasieren: «Es ist Sommer (Mai) und man soll von der Sommerpracht eigentlich getröstet werden (vgl. I,1–4); jedoch habe ich für meinen Liebeskummer keinen anderen Trost, als den, dass meine Dame gut ist. (vgl. I,5–7)». Der Sommer als potenzielle Trostquelle verfängt hier also genau nicht, während es bei Reinmars MF 188,33 relativ unbestimmt heißt: Dô ich daz grüene loup ersach, / dô liez ich vil der swaere mîn (II,1f.) – die sommerliche Natur ist hier also sehr wohl als für das Ich Linderung stiftend zu konzeptualisieren, bevor dazu bezüglich der genauen Relationsverhältnisse in der Schwebe gehalten konkurrierend angegeben wird, zukünftig müsse das Text-Ich von einer Frau vil wunneclîchen wol gemuot (II,5) sein (vgl. II,3–5). Freilich wird hier dadurch auch gerade auf der imaginierten Zeitebene ein qualitativer Unterschied der Trostschenkung suggeriert (sommerliche Natur: punktuelle Linderung / Frau: fortan stetige Beglückung), der in Leutholds Lied noch viel zugespitzter ausagiert wird. Die sommerliche Natur scheidet dort gerade als Trostquelle aus, eine Aufhellung der emotionalen Gestimmtheit des Ichs kann nun allein der Gedanke an die Vortrefflichkeit der Dame bewirken. Damit wird die Relevanz des Natureingangs im Lied destruiert, indem seine Bedeutung vom Text-Ich, die es ja allgemein durchaus noch anerkennt (vgl. das daz man sich der lieben ovgen weide / wol von schvlden trosten sol [I,3f.]), für die eigene Stimmung jedoch völlig negiert, obwohl sich so de facto gleichwohl eine komplementäre Beziehung zwischen eigentlich adäquater Jahreszeitenstimmung und emotionaler Lage des Ichs einstellt, nämlich Tröstung. Schon aufgrund des wörtlichen Anklangs des Refrains von Ulrichs Lied V wird sich deshalb der Rezipient durch die zunächst dort begegnende Aussage, Min frowe ist gvot (8), auch an das in Leutholds Lied I verwirklichte Muster einer komplementären Setzweise mit Destruierung der Relevanz des Natureingangs für das Ich erinnert sehen und den freien Raum der Sinnrelationen zwischen Natur- und Liebesthematik in Ulrichs Lied in ähnlicher Weise deuten, als es bei Leuthold verwirklicht ist, etwa so: «Es ist Sommer, ich aber bin (nur) froh, weil meine Dame gut ist». Zwar ist es in Ulrichs Lied ebenso wenig explizit ausformuliert, dass das Text-Ich von der sommerlichen Natur keine Tröstung empfindet (wie bei Leuthold) wie dass es eine empfindet (wie bei Reinmar) – insofern stehen beide Techniken der komplementären Inbezugsetzung zur Ausdeutung der Leerstelle prinzipiell zur Verfügung, dennoch ist es aber gerade auch denkbar, dass der Rezipient zu dem von Leutholds Lied demonstrierten Muster tendiert, da ja im Natureingang von Ulrichs Lied KLD 59, V die auffallende Einschränkung ist mir geseit (I,6) sehr wohl im Sinne einer gewissen Distanz des dortigen Text-Ichs zum Naturgeschehen gedeutet werden kann.
Wie dem auch sei, es wird im Liedverlauf direkt anschließend eine Möglichkeit der komplementären Setzung, die eine Tröstung des Ichs mit oder ohne Zutun der sommerlichen Natur in jedem Falle impliziert, sofort wieder relativiert, wenn die Angabe der dennoch bestehenden Verstimmung des Text-Ichs erfolgt: swie si doch tůt mich vngemvot (8). Bezeichnenderweise ist das Ich des Ulrichschen Liedes also nicht etwa wol gemuot wie das der Reinmar-Strophe, sondern hat Kummer, der zudem noch von der Dame verursacht ist. Somit scheint eine Deutung des Bezuges «Es ist Sommer und ich bin froh, weil meine Dame gut ist» nicht mehr ganz zu passen. An dieser Stelle wird der Rezipient in der interpretativen Ausfüllung des vom Lied aufgemachten Deutungsraumes wiederum auf sein kontextuelles Vorwissen aus der Minnesangtradition referieren, da nun das gegenteilige Modell einer kontrastiven Anbindung von adäquater Jahreszeitenstimmung und Ich-Befindlichkeit des Liebenden sich zur deutenden Sinnunterlegung anbietet. Dieses poetologische Muster, das in zahlreichen Liedern Ulrichs begegnet, erscheint in exemplarischer Form etwa in Lied KLD 59, IXUlrich von WinterstettenKLD 59, IX, wo es im Strophenkörper der ersten Strophe heißt (I,1–10):
| I.C 31 | Svmer wil vns aber bringengruenen walt und vogel singen,anger hat an blvomen kleit.berg vnd tal in allen landensint erlost vs winters banden,heide rote rosen treit.sich froeit al dú werlt gemeine,nieman truret wan ich eine,sit mir d’v vil svesse reinefrúmt so manig herzeleit.[…] |
[Sommer will uns wiederbringen
den grünen Wald und Vogelsingen,
der Anger hat ein Blumenkleid an.
Berg und Tal sind überall
aus den Winterfesseln befreit,
die Heide trägt rote Rosen aus.
Es freut sich die ganze Welt gemeinsam,
niemand ist traurig außer mir alleine,
weil mir die überaus Süße und Reine
so viel Herzschmerz bereitet.]
Wenn der Rezipient nun also das – in Lied IX explizit ausformulierte – Muster einer kontrastiven Inbezugsetzung von saisonal eigentlich zu erwartender Stimmung mit der tatsächlichen Befindlichkeit des liebenden Ich auf das Lied V überträgt – darauf dürfte er durch das in dieser Hinsicht recht deutliche Signal, nämlich dass das Text-Ich sich selbst als vngemvot charakterisiert, gestoßen werden – so ergibt sich für eine interpretativ herzustellende Verbindung von Natureingang und Liebesthematik eher folgende Deutung: «Es ist Sommer (und es gehört sich eigentlich, dass man froh ist), aber ich bin unglücklich, weil meine Dame mich schlecht behandelt!». Auch wenn, weil der Refrain semantisch zwischen den Polen einer Wertschätzung der Dame und Frustration über sie in der Schwebe bleibt, die Konzeptualisierung im Sinne einer gleichgerichteten Setzweise (I) nicht völlig destruiert werden mag, wird der Rezipient am Ende des Refrains wohl den eröffneten Deutungsraum eher mit dem Muster der kontrastiven Anbindung (II) füllen, da zum einen die Charakterisierung der Ich-Position als unglücklich einen sehr starken interpretativen Sog in diese Richtung zeitigt, zum anderen, da wir uns mit Ulrichs Lied in einer Minnesang-Phase befinden, in dem die kontrastive Setzung eindeutig das dominierende Anbindungsmuster und somit der Standardfall im sommerlichen Natureingang geworden ist.27 Zudem wird die derartige Sinnunterlegung im weiteren Liedverlauf noch gefestigt, setzt doch die Strophe II bezeichnenderweise mit der programmatischen Äußerung, Min vngemvete ist gar zegros (II,1), am letzten Wort des Refrains, dem Adjektiv vngemvot, an, und bestärkt auch im Weiteren nicht etwa den Aspekt der Wertschätzung der Dame, sondern den des Leidens an ihr (vgl. das dú mich in senden leiden […] lat [II, 4–6]). So beklagt das Text-Ich in der zweiten Strophe – als an ein imaginäres ‹Publikum› gerichtete Erklärung für seinen kummervollen Zustand (vgl. II,2: als ich úch wil bescheiden) –, dass die Dame ihm keinerlei Hilfe zukommen (II,3 und 5) und es in Sehnsuchtsschmerz verharren lasse (II,4–6), ja sich ihm gegenüber schon lange Zeit so unerbittlich zeige (vgl. II,5 und 7). Dies gipfelt in einem im Minnesang zur Kennzeichnung der Ungerechtigkeit der Dame recht drastischen, aber nicht unüblichem Motiv28Dietmar von EistMF 40,19Gottfried von NeifenKLD 15, IXHartmann von AueMFMT XXII, Nr. XVIII, nämlich dem Vergleich des Verhaltens der Minnedame mit dem Umgang mit Heiden (II,7), den das Text-Ich am Schluss des Strophenkörpers, wiederum als syntaktisch und formal herausgehobene Pointe nach der binnenzergliederten Abgesangspassage, anstrengt. Indem also die zweite Strophe den Unmutsaspekt des Refrains noch weiter herausarbeitet, ja bis zu der Aussage forciert, die Dame behandle das liebende Ich derart hartherzig, als ob es ein wilder heiden (II,7) sei, bestärkt der weitere Liedverlauf die wohl zu unterlegende Sinnrelation eines kontrastiven Verhältnisses von adäquater Jahreszeitenstimmung und tatsächlicher emotionaler Lage des Ichs noch, ja ‹zurrt› diese gleichsam in der Rückschau fest. Die durch die Refrainaussage, die Dame des Text-Ichs sei gut, angeregte, zeitweilig ebenfalls wohl konzeptualisierbare Erwägung, es könne eine gleichgerichtete Setzweise unterstellt werden, dürfte aus dem Blickwinkel der zweiten Liedstrophe vollends desavouiert sein. Auf jeden Fall ist aber deutlich geworden, wie der durch die unvermittelte Setzung des Natureingangs in Ulrichs Lied V entstehende freie Deutungsraum möglicher Sinnrelationen gerade über die dem geübten Minnesang-Rezipienten aus dem Kontext bekannten Modelle einer Anbindung des Natureingangs an die emotionale Stimmung des Ichs im prozessualen Verlauf des Liedes wieder geschlossen werden kann.
Die vorangegangene Beispielanalyse dürfte somit gezeigt haben, dass selbst in jenen Fällen, in denen die Texte eine Sinnbezüge stiftende Verknüpfung zwischen Natureingang und der Folgethematik nicht explizit argumentativ ausformulieren, nicht davon ausgegangen werden kann, dass hier die poetologischen Muster einer solchen Inbezugsetzung in ihrer Wirkung suspendiert seien. Im Gegenteil dürften jene Modelle gerade in der Interpretation durch den Rezipienten wieder aufgerufen und für die Lenkung des Verständnisses in höchstem Maße bedeutsam sein. Diese Tatsache ergibt jedoch für die hier zu erstellende Typologie des Natureingangs das methodische Dilemma, dass derartige poetologisch dominante Muster in einer systematisierenden Typenaufteilung, die sich an rein formalen Kriterien der Einbauweise orientiert, nicht erfasst werden können, da sich eine solche Einteilung wiederum – zu Recht – danach auszurichten hat, was den Texten als Charakteristikum auf der Wortebene wirklich auch inhärent ist. Andererseits scheint mir aber eine für sich allein stehende formale Typologie des Natureingangs im Minnesang – als die zweifellos methodisch ‹sauberste› Lösung – insofern unzureichend zu sein, als sie konnotative Bezogenheiten trennt, die Texte von ihrem intertextuellen Rahmengefüge des Systemkontextes ‹Minnesangtradition› löst und so Gefahr läuft, als ein philologisches Schreibtischprodukt über die Spezifika literarischer Techniken letztlich viel weniger auszusagen, als es das einer solchen Distinktion doch zugrundeliegende Interesse gewesen ist. Gleichwohl soll damit nicht behauptet werden, dass man nun auf eine Typeneinteilung nach formalen Charakteristika der Einbauweise so einfach verzichten könnte. Denn schließlich gewährleistet ja nur eine nach möglichst ‹objektiven› Kriterien erstellte Typologie, dass sie für die Klassifikation der Einzeltexte überhaupt fruchtbar gemacht werden kann und somit als literaturwissenschaftliches Hilfsinstrument29 erst nützlich wird. Diese Einteilung soll jedoch nicht als ‹Zielpunkt› der Überlegungen für sich stehen bleiben, sondern wird – gerade weil der Verfasser die Notwendigkeit einer deutenden Profilierung der Systematik auf die für diesen Bereich in der Minnesangtradition wirksamen poetologischen Muster anerkennt – insofern mit einer diesbezüglichen Gewichtung versehen werden, die dem entgegenzuwirken sucht, dass ein schematisches Gebilde entsteht, das zwar klassifikatorischen Erfordernissen Genüge leistet, aber darüber hinaus keinen Erkenntniszugewinn über die kontextuelle Vernetztheit der die Einbauweise des Natureingangs steuernden literarischen Techniken liefert, weil die Typen ungewichtet katalogartig nebeneinandergestellt sind. Deshalb wird die hier zu entwerfende Typologie zwar den Anspruch der adäquaten kategorialen Erfassung formaler Gesichtspunkte zu erfüllen suchen und sich darum bemühen, prinzipiell auf alle Texte anwendbar zu sein30, der Ebene der systematischen Klassifikation über die Beimessung von Dominanzverhältnissen aber zudem eine poetologische Gewichtung hinzufügen, die implizit auch eine vorsichtige historisierende Dimensionierung ins Spiel bringt. Warum nun eine an sich die Texte in synchroner Perspektive erfassende Typensystematik des Natureingangs wiederum in einem zweiten Schritt überhaupt sinnvollerweise mittels literaturgeschichtlich ausgerichteter Überlegungen zu deuten ist, bedarf einer gewissen Erklärung. Schließlich ist ein poetologische Muster herausarbeitender Ansatz ja an sich noch nicht unbedingt mit der Notwendigkeit verbunden, eine diachrone Perspektive einzunehmen; es ist streng genommen immer noch möglich literatursystematisch zu argumentieren. Für den hier in den Blick genommenen Bereich des Minnesangs von seinen Anfängen bis ins 14. Jahrhundert hinein lassen sich aber nicht nur quantitativ viele, sondern auch in ihrem Erscheinungsbild derart verschiedene Möglichkeiten an Anbindungsweisen des Natureingangs feststellen, dass die Bestimmung poetologisch dominierender Muster nicht allein auf systematischer Ebene erfolgen kann. Hierfür ist m.E. tatsächlich der Blick auf den literaturgeschichtlichen Verlauf der Minnesangtradition hilfreich, um die Gemengelage diverser Einbauweisen nach poetologischen Gesichtspunkten zu strukturieren und in ihrer kontextuellen Bezogenheit aufeinander zu erkennen.
Doch selbst in literarhistorischer Perspektive stößt die Ergründung solcher Dominanzen auf gewisse Schwierigkeiten, da – dies wird sich immer wieder zeigen – genaue prozessuale Entwicklungen wiederum nicht genetisch nachzuverfolgen sind. So lässt sich auch die Einbauweise einer komplementären bzw. kontrastiven Anbindung des Natureingangs an die emotionale Befindlichkeit des liebenden Ichs, die im Folgenden als Dominanzbereich der aufgestellten Typologie situiert wird, überhaupt nicht als historischer Nukleus erweisen31, betrachtet man die als früheste Beispiele der Anwendung des Natureingangs im Minnesang identifizierten Texte32Namenlos (Walter von Mezze)MF 4,1Namenlos (Walter von Mezze)MF 6,14; dennoch ist sie aber spätestens im Bereich des hochhöfischen Minnesangs als zentrales Prinzip der Verknüpfung etabliert.33 Ja es lassen sich sogar durchaus ganz anders gelagerte Setzweisen des Natureingangs im Minnesang des 13. Jahrhunderts – wie beispielsweise in Neidharts Sommerliedern34NeidhartSL 2/SNE I: C Str. 222–226NeidhartSL 25/SNE I: R 58 – als charakteristische Modifikation dieser Technik darstellen und können so gerade aufgrund der Freilegung ihrer konnotativen Bezogenheit auf traditionelle Modelle in ihrer innovativen Wirkung überhaupt erst ausgelotet werden. Zudem scheint es m.E. von immenser Bedeutung zu sein, dass im späthöfischen schwäbischen Minnesang um Gottfried von Neifen, der im Folgenden als entscheidende Station der Rückbindung des Neidhartschen Natureingangs an das traditionelle Werbungslied beschrieben wird (s. Punkt III.2.a), wiederum die Setzweise einer argumentativen Bezugerstellung zwischen Naturgeschehen und emotionaler Befindlichkeit des liebenden Ichs diese Integrationsoperation grundlegend steuert.35 Selbst in noch späteren literaturgeschichtlichen Stadien der Minnesangtradition bleibt diese Anbindungstechnik, auch wenn nun verstärkt wieder andere Einbauweisen erprobt werden, weiter präsent und als möglicher Zielpunkt der konnotativen Bezüge potentiell bedeutsam.36Konrad von WürzburgLied 6 (Schröder)
Insofern lässt sich also durchaus die Herauskristallisierung und Etablierung des poetologisch dominanten Musters einer Inbezugsetzung des Natureingangs mit der emotionalen Gestimmtheit des liebenden Ichs, die über die Basisopposition kontrastiver vs. komplementärer Setzung gesteuert ist, für die wohl anzunehmende literaturgeschichtliche Entwicklung der Minnesangtradition37 plausibilisieren, freilich ohne dass der genaue prozessuale Verlauf der Herausbildung solcher dominanter Modelle tatsächlich in Einzelheiten darstellbar wäre. Jedenfalls scheint es mir aber sehr wohl angebracht zu sein, das durch formale Charakteristika konstituierte typologische Schema durch die Herausarbeitung poetologischer Dominanzverhältnisse, die mittels einer – in ihren Basisannahmen kritisch reflektierten – literaturgeschichtlichen Zusammenschau bestimmt sind, auszuwerten. Diese relationale Inbezugsetzung der Typen des Natureingangs im deutschen Minnesang gewährleistet schließlich, dass das typologische Schema nicht gleichsam ‹in der Luft hängt› und über die Vernetztheit der literarischen Techniken, die den verschiedenen Einbauweisen des Natureingangs zugrundeliegt, nichts mehr aussagt.
Damit gelange ich für den Minnesang zu einem Typenschema, das im Folgenden in Form eines Schaubildes (I) angegeben werden soll:
Anmerkungen zum Schaubild I:
a Hiermit ist gemeint, dass die Anbindungsweise an andere Liedinstanzen außer dem Ich offensichtlich dazu tendiert, die Basisopposition kontrastiver vs. komplementärer Einbau zu einer dominanten, einwertigen Zuschreibung zu verkürzen. Für die Anbindung von Liebesdidaxe und generellem Frauenpreis ist z.B. folgende Festlegung nahezu bindend: im Falle des Sommereingangs komplementäre Setzweise («Es ist Sommer und man soll sich jetzt an den guten Frauen erfreuen»), im Falle des Wintereingangs die kontrastive («Es ist Winter, das können die Frauen trösten bzw. man soll stattdessen die Frauen loben»). Im Bereich der Gesellschaftsdiagnose ist beim Sommereingang hingegen die kontrastive Anbindung dominant: «Es ist Sommer, aber es steht um die gesellschaftlichen Werte nicht gut (also sollt ihr euch ändern!)». Für die Anknüpfung des Natureingangs an die Dame begegnet fast nur der komplementäre Einbau: «Der Sommer ist schön, genauso / noch schöner ist meine Dame». Die Beispiele für eine Anbindung des Wintereingangs an eine konkrete Dame (Heinrich von Rugge, MF 106,24Heinrich von RuggeMF 106,24: Nu lange stât diu heide val) und eines in Figurenrede gesetzten kontrastiven Sommereingangs an das konkrete ‹Er› eines Ritters (Meinloh von Sevelingen, MF 14,1Meinloh von SevelingenMF 14,1: Ich sach boten des sumeres) sind wohl singulär.
b In solchen Fällen ist es fraglich, ob überhaupt noch von Natureingang gesprochen werden kann. Natur- bzw. Jahreszeitenstrophen, die zumindest wahrscheinlich durch Überlieferungsverluste isoliert worden sind, sind als Natureingangsstrophen denkbar, jedoch letztlich nicht zu erweisen.
c Die Anbindung des Natureingangs an die Sangesthematik nimmt insofern eine – hier auch graphisch angedeutete – Zwischenposition ein, da, wenn es inhaltlich rein um die Realisation von Sang in der bestimmten Jahreszeit geht, nur ein einwertiges Schema vorliegt (SE komplementär: «Es ist Sommer und so singe ich» / WE kontrastiv: «Es ist Winter und ich singe trotzdem»). Wird jedoch inhaltlich auch etwas über die Qualität des Sanges, ja den Erfolg bzw. das Misslingen desselben ausgesagt, ist die Anbindung für alle Möglichkeiten, die die Basisopposition herstellt, offen.
Für den Bereich des Dominanztyps A.IIb.2., d.i. die liebesthematische Ausdeutung des Natur- und Jahreszeitengeschehens im Falle des (männlichen) Werbungslied-Ichs, ergeben sich zudem verschiedene Möglichkeiten einer argumentativen Ausdeutung der Natureingangspartie in Relation zur emotionalen Lage des Ichs, die hier wiederum in der knappen Form eines Schaubildes (II) vorgestellt werden sollen. Denn so mag es im weiteren Verlauf der Untersuchung leichter fallen, auf diese Bezug zu nehmen.
Verdeutlichende Beispiele zu Schaubild II:
a Vgl. z.B. Gottfried von Neifen, KLD 15, VGottfried von NeifenKLD 15, V: Walt heide anger vogel singen / sint verdorben von des kalten winters zit. / da man blvomen sach vf dringen / da ist es blos: nv schovwent, wie dú heide lit. / das klage ich; so klage ich mine swere, / das ich der vnmere / bin, der ich gerne lieb in herzen were (I,1–7; Hervorhebungen – wie auch im Folgenden – von mir, D.E.).
b Vgl. z.B. Winli SMS 17,4WinliSMS 17,4: Secht, des meijen blüete / fröit die vogel in dien ouwen: / sô fröit mich ein minneklichez wîp (I,1–3). Die eigentlich zu erwartende Inbezugsetzung «So wie mich der Sommer freut, freut mich auch …» begegnet dagegen nur selten, vgl. dafür Rost, Kirchherr zu Sarnen SMS 22,7Rost, Kirchherr zu SarnenSMS 22,7: Fröit iuch, jung und alt: / wan sicht aber manigvalt / liechte bluot entspringen. / Secht, der mære guot / hœrt man stæte wolgemuot / kleiniu voglîn singen. / Mit dien wil ich fröiwen mich / der gemeiten zît / und der lieben, diu mir gît / muot und sinne fröilich (I,1–10; auch hier erfolgt die Anbindung aber über den Zwischenschritt der Freude der Vögel!).
c Vgl. dafür z.B. die Einzelstrophe MF 64,26Heinrich von VeldekeMF 64,26 Heinrichs von Veldeke: Ez habent die kalte nähte getân, / daz diu löuber an der linden / winterlîche val stân. / der minne hân ich guoten wân / und weiz sîn nû ein liebez ende; / daz ist mir zem besten al vergân, / Dâ ich die minne guot vinde / und ich mich ir aldâ underwinde (1–8). Noch am deutlichsten im Sinne einer Ablehnung der Geltung ist Ulrich von Liechtenstein KLD 58, XXXIXUlrich von LiechtensteinKLD 58, XXXIX zu lesen: Er ist chomen mit gewalde, / den der meie het vertriben, / sumerwunne ist im entrunnen balde, / der ist vor im niht beliben; / den sul wir ze mazen chlagen, / sit diu wunne und des meien sunne / wider git in churzen tagen. // Swem der winder hochgemüete swendet, / der muoz ofte truric si. / mir hat hohen muot ein wip gesendet, / da von ist das herze min, / swie es wittert, vro, vro, vro (I,1-II,5; zitiert nach: Ulrich von Liechtenstein: Frauendienst, hg. von Franz Viktor Spechtler, Göppingen 1987 [GAG 485], S. 338). Für die Verse I,6f. scheint mir jedoch die Lesart von C, sit dv’ svnne vns des meien wunne / wider git in kurzen tagen, sinnvoller zu sein.
d Vgl. z.B. Johannes Hadloub SMS 30,19Hadloub, JohannesSMS 30,19: Nû ist sumer so wol gegest, daz er êre hât: / in schœner wât mag man in nû wol sehen. / Rôt, brûn, gel, blâ, wîz, grüene ist sîn kleit var. / swer sîn nimt war, der mag im wunne jehen. / In lobent mit süezzem sange diu vogillîn, / diu sehent so liechten schîn; / mit dien sol man frœlich sîn. / swie schœn diu zît sint, trüebe ist mir doch mîn muot, / wan mich getrôste noch nie mîn frowe guot (I,1–9); hierzu gehört auch die Möglichkeit der revokatorischen Infragestellung der Geltung des Sommereingangs für das Ich, vgl. z.B. Rudolf der Schreiber KLD 50, IIRudolf der SchreiberKLD 50, II: Svmer der wil aber komen schone, / heide vnd anger stent geblvet vber al, / vogel singent in vil svezem done, / vor in allen doenet wol dú nahtegal. / Was singe ich tvmber von der gruenen heide, / wan klage ich sorge niht vnd swere beide, / die mir min vro minne git zelone? (I,1–7).
e Vgl. z.B. Neidhart, WL 16NeidhartWL 16/SNE I: R 26 (nach R): Owe, lieber sumer, diner liehten tage lange, / wie sint die vercheret an ir scheine! / si trubent unde nement an ir suzzen weter ab. / gar gesweiget sint die vogelin mit ir sange. / doch ist daz diu meiste sorge min, / daz niht langer dienest lieben lon erwarben hat (R 26, I,1–6; zit. nach SNE I).
f Vgl. z.B. Kristan von Luppin KLD 31, VIKristan von LuppinKLD 31, VI: Meijen schin din kunft mich froeit vil kleine, / swie din blůt lúchtet so: / mir tůt bas, das mich dú liebe reine / zaller stunt machet vro. / si mag mir wol bringen / gruenen kle, blvomen glast, voglin singen (I,1–6).
g Vgl. z.B. Reinmar, MF 169,9ReinmarMF 169,9: Mir ist ein nôt vor allem mîme leide, / doch durch disen winter niht. / waz dar umbe, valwet grüene heide?/ solcher dinge vil geschiht, / Der ich aller muoz gedagen. / ich hân mêr ze tuonne denne bluomen klagen (I,1–6). Zu dieser Technik ist im Übrigen auch der Fall einer revokatorischen Infragestellung der Geltung des Wintereingangs für das Ich zu zählen, vgl. dazu z.B. Wernher von Hohenberg SMS 2,7Wernher von HohenbergSMS 2,7: Ich muoz klagen, daz diu zît / sich so gar verkêret hât: / Secht, wie heid und anger lît / und wie der walt in tuften stât! / Dâ man ê hôrt vogellîn sang: / der klang in tal, in lüften erschal, / süezze stimme – / winters grimme / tuot siu swîgen überal. // Waz klag ich der vogellîn sang, / wan klag ich nit mînen pîn? (I,1-II,2).
h Vgl. z.B. Konrad von Landeck, SMS 16,10Konrad von LandeckSMS 16,10: Swen die rîfen / twungen und darzuo der snê, / der sol nû ze fröiden grîfen, / sît man siht den klê. / Sôst mîn wunne / gar ein reine, sælig wîb: mich fröit weder loub noch sunne, niht wan ein ir lîb (II,1–8).
i Vgl. z.B. Konrad von Kirchberg, KLD 33, VIKonrad von KirchbergKLD 33, VI: Anger, walt, dú liehte heide breit, / die siht man von dem kalten winter grise, / er tvot kleinen vogelin leit, / die da sungen svosse vf gruenem rise; / des ist manig herze froeiden ane. / da fúr han ich mir ein schones lieb erkorn. / wil si, so han ich den meien niht verlorn. / doh leb ich im froeidelosen wane (I,1–8).
j Vgl. z.B. Der Tannhäuser Lied Cammarota Nr.VIIDer TannhäuserLied VII (Cammarota) : Wol ûf, tanzen vberal / fröit iuch, stolzen leigen / wunneklîchen stât der walt / wol geloubet, das sint liebiu mære / jârlang prüevet sich der schal / gegen dem liehten meigen / dâ die vogel überal / singent wol, zergangen ist ir swære. / alle über ein plâniure / die bluomen sint entsprungen. / elliu crêâtiure / diu müesse dâvon iungen / wil ein wîb, sô wirt mir wol / nach der ie min herze hat gerungen (I,1–14).
Bei aller Suggestionskraft im Sinne einer Eindeutigkeit solcher Schaubilder muss jedoch betont werden, dass in vielen Texten, sieht man sie sich bei der Liedinterpretation an, solche Unterscheidungskriterien letztlich viel weniger gut greifen als gedacht. Dies belegt mithin einmal mehr, dass die hochkomplexen Bedeutungsgefüge der Texte selbst alle systematisierenden Bestrebungen torpedieren, indem sie etwa Leerstellen generieren, die schwer auffüllbar sind, Motive einbringen, die mehrdeutig erscheinen, – oder schließlich sogar sich widersprechende Textstrategien übereinanderlagern. Insofern dürfen die beiden typologischen Aufrisse wirklich nur als pragmatisch zu handhabendes Arbeitsinstrument verstanden werden. Denn dass viele der zugrundegelegten Kriterien mehr Probleme bereiten, als es den Anschein haben mag, soll die folgende ausführliche Diskussion anhand dreier exemplarischer Parameter, d.i. die Jahreszeitenzuordnung, die Folgethematik und die Sprecherposition, zeigen. So wird sich hoffentlich auch der Blick dafür öffnen, wie breit das Spektrum an poetischen Verfahrensweisen, die – bei aller Rede von seinen dominanten Einbauformen – unter dem Begriff ‹Natureingang› zu diskutieren sind, eigentlich tatsächlich ist.