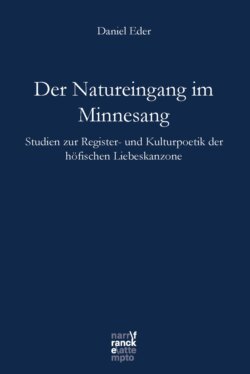Читать книгу Der Natureingang im Minnesang - Daniel Eder - Страница 9
II Der saisonal organisierte Natureingang als poetisches Verfahren der Natur- und Jahreszeitenrepräsentation: Versuch einer Abgrenzung 1 Anfangsstellung, Jahreszeitennennung, Naturdetails
ОглавлениеZunächst einmal ist der Natureingang als ein topisches Element der Eingangsgestaltung eines Liedes (bzw. einer Einzelstrophe1) in den Blick zu nehmen, das mittels Rekurrenz auf den in der Natur ablesbaren Jahreszeitenwandel die Möglichkeit bietet, die emotionale Befindlichkeit des Ichs2 durch Übereinstimmung mit oder Kontrast zu der in der Natur und Gesellschaft zu findenden, jahreszeitadäquaten Gestimmtheit herauszuarbeiten.3 Deswegen ist der Natureingang – anders als dies das Konzept VON WULFFENS oder der Begriff des ‹Jahreszeitentopos› tun – auf seine Anfangsstellung im Lied zu verpflichten, er stellt – wie es ADAM formuliert – «das ein Lied eröffnende Jahreszeitenbild»4 dar. Dies ist im Übrigen eine Grundkondition, die für andere Naturrepräsentationen wie den locus amoenus nicht unbedingt gilt. Was ist aber dann zu den Strophen zu sagen, die wie ein Natureingang daher kommen, aber in Binnen- oder Endstellung im Lied begegnen?
Besonders im Œuvre Reinmars – ein Autor, der im Übrigen für seine Abneigung dem Natureingang gegenüber bekannt ist, man denke nur an das entschiedene Diktum in Lied MF 169,9ReinmarMF 169,9: ich hân mêr ze tuonne denne bluomen klagen (I, 4)!5 – finden sich gelegentlich Strophen, die für sich genommen als ein Natureingang gelesen werden könnten, jedoch durch die Überlieferung nicht (bzw. nicht eindeutig) für den Anfang des jeweiligen Liedes bezeugt sind.6ReinmarMF 163,23ReinmarMF 165,1ReinmarMF 184,31ReinmarMF 187,31ReinmarMF 195,37 Betrachten wir beispielsweise das unikal in C überlieferte, dreistrophige Lied MF 191,7ReinmarMF 191,7: Ich wêlte ûf guoter liute sage7:
| I.MF 191,7C 207 | Ich welte ûf guoter liute sageund ouch durch mînes herzen râtein wîp, von der ich dicke tragevil manige nôt, diu nâhe gât.Die swaere ich zallen zîten klage,wand ez mir kumberlîche stât.ich tet ir schîn den dienest mîn.wie möhte ein groezer wunder sîn,daz sî mich des engelten lât? |
| II.MF 191,25C 208 | Ze vröiden nâhet alle tageder welte ein wunneclîchiu zîtze senfte maniges herzen klage,diu nû der swaere winter gît.Von sorge ich dicke sô verzage,swenne alsô jaemerlîche lîtdiu heide breit. daz ist mir leit.diu nahtegal uns schiere seit,daz sich gescheiden hât der strît. |
| III.MF 191,16C 209 | Ze rehter mâze sol ein manbeide daz herze und al den sinze staete wenden, ob er kan.daz wirt ime lîhte ein guot gewin.Swem dâ von ie kein leit bekan,der weiz wol, wie ich gebunden bin.ich geloube ime wol, als er mir sol,von schulden ich den kumber dol;ich brâhte selbe mich dar in. |
[I. Ich wählte mir auf die Rede angesehener Menschen hin
und auch wegen des Ratschlags meines eigenen Herzens
eine Frau, durch die ich oft leide
sehr viel Not, die einen tief berührt.
Dieses Leid beklage ich immerzu,
weil es kummervoll um mich steht.
Ich gab ihr meinen Dienst zu erkennen.
Was könnte mehr verwundern,
als dass sie mich das büßen lässt?
II. Freuden bringend kommt täglich näher
für die Welt eine anmutige Zeit,
um die Klage so manchen Herzens zu lindern,
die jetzt noch der drückende Winter verursacht.
Durch Sorge bin ich oft derart mutlos,
immer wenn in solcher Weise leidvoll daliegt –
die weite Heide. Das tut mir weh!
Die Nachtigall verkündet uns bald,
dass der Streit entschieden ist.
III. In gebührendem Maße soll ein Mann
sowohl das Herz als auch seinen ganzen Verstand,
auf die Beständigkeit richten, wenn er kann.
Dadurch wird ihm leicht ein guter Gewinn zuteil.
Jeder, dem davon jemals irgendein Leid widerfuhr,
versteht gewiss, wie ich gefangen bin.
Ich glaube ihm wirklich, so wie er mir glauben soll,
verdientermaßen leide ich den Kummer;
ich brachte mich selbst da hinein.]
Sofort fällt auf, dass Lied MF 191,7 nicht mit einem Natureingang beginnt, wird hier doch in der ersten Strophe zu Beginn die Gesellschaftsthematik aufgerufen, die für das Text-Ich als ein Motivationsgrund für die Wahl eines Liebesgegenübers – neben der Instanz des eigenen Herzens – angeführt wird (vgl. I,1–3); die so vom Ich ausgesuchte Frau bereitet diesem allerdings nur Kummer (vgl. I,3–6), ja – zum Unverständnis des Text-Ichs – lasse diese es gerade die Offenlegung seines ihr gewidmeten Dienstes sogar noch büßen (vgl. I,7–9).8 Lässt man die eingeschaltete Binnenstrophe mit Jahreszeiten- bzw. Naturmotivik zunächst beiseite, so knüpft die dritte Strophe insofern an die erste Strophe an, als die Gedankenführung sich einerseits aus der sentenzartigen Setzung entwickelt, die durch ihren generellen Charakter die Gesellschaftsthematik wieder präsent werden lässt und im Übrigen recht deutlich an den Gestus der Sangspruchdichtung erinnert, andererseits auch an die Minnethematik, da die Gültigkeit der Setzung für den Bereich der persönlichen Liebeserfahrung des Ichs wiederum konterkariert wird.9 So entspricht also der Aussage der ersten Strophe, dass die Folgeleistung der – neben dem eigenen Herzen – für die Wahl der Frau Ausschlag gebenden Rede der guoten liute (I,1) dem Text-Ich gerade nicht zum Glück verholfen hat, der inhaltliche Verlauf der dritten Strophe: Die zunächst als genereller Verhaltenstipp präsentierte Sentenz (wer sich um Beständigkeit bemüht, wird dafür belohnt [vgl. III,1–3]) führt für das Ich wiederum offensichtlich nicht zum guot gewin (III,4), sondern zu kumber (III,8) und dem Gefühl völliger Handlungsunfähigkeit (vgl. das gebunden, III,6!).10 Dann aber bringt das Ende der Strophe als Pointe noch eine Wende, die sich allerdings m.E. nicht darin erschöpft, dass das Text-Ich – wie es WIEBKE SCHMALTZ angegeben hat – durch ein Eingeständnis der eigenen Schuld die Gültigkeit der allgemeinen Setzung restituiert und so letztlich auf eine «Bestätigung seiner Beständigkeit» zielt.11 Denn die Angabe des Ichs, sich den eigenen Kummer selbst eingehandelt zu haben (vgl. III,9), lässt sich auch auf den Liedanfang rückbeziehen, nämlich auf die Aussage, sich auf Anregung anderer und des eigenen Herzens überhaupt auf die Liebe bzw. den Minnedienst eingelassen zu haben, aus dem es sich nun – trotz keinerlei Aussicht auf Erfolg – nicht mehr lösen kann (vgl. das gebunden, III,6).
Doch fragen wir nun nach der Funktion der auf den ersten Blick recht isoliert stehenden zweiten Strophe, die sich als einzige nicht explizit mit der Liebesthematik beschäftigt, und so inhaltlich zunächst schwer mit den anderen beiden Strophen in Bezug zu setzen ist. Hier gibt das Text-Ich als jahreszeitliche Fixierung des Liedes an, man befinde sich an der Schwelle zum baldigen Ende des Winters, das Nahen des Sommers als wunneclîchiu zît (II,2) sei nicht mehr fern (vgl. II,1f.); jetzt allerdings sei noch so manches Herz vom Winter bedrückt, ja das Ich selbst sei aufgrund des schlechten Zustands der Heide betrübt (vgl. II,3–7). Die Strophe endet aber wieder mit einem positiven Ausblick auf das saisonale Geschehen: bald schon werde der Ruf der Nachtigall verkünden, dass der Sommer über den Winter im Streit der Jahreszeiten obsiegt hat (vgl. II,8f.)12. Für sich genommen könnte die Strophe durchaus auch einen Natureingang bilden, sie benennt die als aktuell imaginierte Jahreszeit und macht diese durch Bezugnahme auf Naturdetails deutlich;13 jedoch dient die Jahreszeiten- bzw. Naturthematik hier im Kontext des Liedes offensichtlich nicht der Eingangsgestaltung, vorausgesetzt, man belässt die Strophenabfolge, wie sie uns die handschriftliche Überlieferung präsentiert. Diese anzweifeln zu wollen, wäre methodisch äußerst problematisch: zum einen gibt es keine Parallelüberlieferung, die eine andere Reihenfolge nahelegen würde, zum anderen wäre es dann noch gar nicht erwiesen, dass die hier von C gewählte Abfolge keinen Sinn ergeben würde bzw. gar nachträglich verderbt worden sei.14 Zudem ist schließlich auch schon darauf hingewiesen worden – dies wird sich im Folgenden noch weiter bestätigen –, dass es gar nicht so außergewöhnlich ist, dass Jahreszeiten- bzw. Naturthematik auch im Binnen- und Schlussbereich des Liedes begegnet.15ReinmarMF 184,31
Dem Eindruck, die Binnenstrophe stehe inhaltlich recht isoliert zwischen den beiden anderen, lässt sich entgegenhalten, dass die Strophe nicht nur formal (z.B. durch das in Vers eins und drei an den Anfang gesetzte ze, das in Strophe III ebenso zu finden ist, oder durch das wie in Strophe I am Beginn von Vers 9 zu findende daz), sondern auch auf der Ebene der Wortentsprechungen (z.B. herze[n] in I,2, II,3 und III,2; dicke in I,3 und II,5; swaere in I,5 und II,4; das zallen zîten [I,5] und das alle Tage [II,1], ferner das leit in II,7 und III,5) eng mit den anderen verbunden ist, ja bei genauerer Betrachtung stellen sich sogar inhaltlich-motivische Bezüge zu den anderen Strophen ein. So begegnen etwa folgende Parallelen: Die in Vers I,1 aufgerufene Gesellschaftsthematik (die guoter liute sage) kehrt auch in Strophe II wieder, wo in Vers 3 durch die Erwähnung der maniges herzen klage eine gesellschaftliche Ebene in die Jahreszeiten- bzw. Naturallusion mit eingeschrieben ist, dem wand ez mir kumberlîche stât (I,6) entspricht das auf die Heide bezogene swenne alsô jaemerlîche lît (II,6), dem Leiden an der Frau (ich dicke trage vil manige nôt [I,3f.]) das an der Situation der Heide (Von sorge ich dicke sô verzage [II,5]) und schließlich dem (zu erahnenden) Beginn der schönen Jahreszeit (II,1f. und 8f.) der guot gewin (III,4), der sich bezeichnenderweise – wie im Fall der Jahreszeiten – nach Ausharren in einem schweren Zustand (Winter, staete) als erlösende Veränderung ergibt bzw. ergeben kann. Damit nähern wir uns auch schon der Funktion der Binnenstrophe im Liedkontext: Hatte die erste Strophe den unglücklichen Zustand des liebenden Ichs, der sich aufgrund eines mit den Vorstellungen der Gesellschaft konvergenten Verhaltens für das Ich ergibt, eingeführt, so parallelisiert die zweite Strophe dies mit dem Verhältnis zwischen Ich und winterlicher Natur: auch hier hat das Ich Kummer (I: Leiden an der Frau, II: Leiden am Winter), auch hier vollzieht sich dies in Übereinstimmung mit der Instanz der Gesellschaft (I: Rat zum adäquaten Vorgehen in der Liebe, II: jahreszeitenadäquates Verhalten). Die zweite Strophe präsentiert im Vergleichsbeispiel aber genau das, was sich in der ersten Strophe für das liebende Ich noch nicht angebahnt hatte, nämlich die Ahnung eines positiven Ausgangs in einer kummervollen Zeit der swaere (I,5/ II,4). Der Sommer naht als eine wunneclichiu zît (II,2), er bringt vröide (II,1), ja der Akt der Offenlegung seiner Ankunft (Ruf der Nachtigall, vgl. II,8) ist im Gegensatz zur persönlichen Liebesthematik des Ichs in der ersten Strophe (das Offenbaren des Dienstes der Frau gegenüber, vgl. I,7) ein befreiender, positiver Moment, der nicht neues Übel für das Ich bringt, sondern dieses löst. Für die allein durch diese Parallelisierung sich ergebende Erwartungshaltung, wie dies auch für den Bereich der Liebesthematik des Ichs erreicht werden kann, bietet nun die III. Strophe die – als Sentenz verkleidete – entsprechende Lösung an: wer nur, wie im Winter, beständig ausharrt, der wird dafür schon belohnt. Nur: Dieser Ratschlag scheint im Bereich des persönlichen Liebesverhaltens, anders als beim sich quasi natürlich ergebenden Jahreszeitenrhythmus, genau keine Garantie für eine glückliche Lösung des leidvollen Zustands zu liefern; er funktioniert nicht in der gewünschten Weise, das Ich verbleibt gebunden und in kumber (vgl. III,6 und 8.). Hier offenbart sich also vollends die Unpassendheit einer aus dem Vergleichsfall des Jahreszeitenverlaufs abgeleiteten Erwartungshaltung, die letztlich die Leistung des Verharrens des Ich in beständigem Minnedienst als außerordentlich hervorhebt und (implizit) aufwertet. Für das Ich bleibt somit kein anderer Weg, als sich den zu erleidenden Kummer selbst anzulasten, wobei letztlich nicht ganz klar wird, ob es sich selbst den Vorwurf macht, nicht beständig genug gewesen zu sein oder zu beständig bzw. hier auf den Entschluss abgehoben wird, überhaupt den leidvollen Dienst einer Frau gegenüber eingegangen zu sein, von dem für das Ich keine Loslösung möglich ist, für den es aber auch keine beglückende Auflösung zu geben scheint.
Somit dürfte deutlich geworden sein, dass die Binnenstrophe nicht so funktionslos zwischen den beiden anderen Strophen steht, wie es vielleicht zunächst den Eindruck gemacht hat.16 Ihr ist m.E. im Gegenteil eine Brückenposition im Lied zuzuerkennen, da mittels ihrer zum einen die Erwartungshaltung eines positiven Ausgangs des Liebeswerbens anhand der Folie eines anderen thematischen Bereichs mitkonstruiert wird, die dann in der letzten Strophe desillusionierend aufgelöst wird; zum anderen liefert sie durch das in ihr abgerufene Jahreszeitenwissen, dass nach jedem Winter auch wieder ein Sommer kommt, den Anknüpfungspunkt zur dritten Strophe und das Kontrastbild zu einem Minneverhältnis, in dem die entsprechende Regel, dass man nur beständig ausharren muss, um belohnt zu werden, eben gerade nicht greift. Insofern unterscheidet die liedinterne oder am Liedschluss gesetzte Jahreszeiten- und Naturallusion in ihrer Wirkung von einer Natureingangsstrophe vor allem folgendes Moment: Durch sie kann die bereits eingeführte Liebesthematik im Kontext des argumentativen Kreisens des Ich-Sprechens in der Minnekanzone durch Aufrufen eines Vergleichs- oder Kontrastbildes noch einmal unter einem anderen Aspekt beleuchtet oder ein bestimmter Zug des Liebesverhältnisses deutlicher herauspräpariert werden, so dass durch sie der argumentative Gang des Liedes und dessen Stimmungsgehalt neue Impulse, ja sogar eine ganz neue Richtung bekommen können; der Natureingang als Möglichkeit, einen Liedanfang zu gestalten, hat stattdessen die Aufgabe, die Befindlichkeit des Ichs erst zu setzen und einleitend zu etablieren. Deshalb sind solche Binnen- und Endstrophen in ihrer poetischen Funktion eher sonstigen, rein mit der Liebesthematik befassten Strophen vergleichbar, die ja sehr oft im Minnesang im kreisenden Sprechen über Liebe argumentativ neu ansetzen. Dass dabei häufig die – bei MF 191,7 relativ deutlich ausgeprägte – Imagination von Aktualität des Jahreszeitenablaufs hinter generelles Sprechen über die Jahreszeit zurücktritt, ist im Zusammenhang mit genau dieser Funktion zu sehen. Ein gutes Beispiel dafür liefert Reinmars Lied MF 187,31ReinmarMF 187,31: Nu muoz ich ie mîn alten nôt, wo in der Handschrift A dem in C nur dreistrophigen Lied eine resignative Schlussstrophe beigefügt ist17, in der die Jahreszeiten- und Naturallusion nicht als aktuell ablaufender Rahmen präsentiert wird, sondern in eben jener Form des generellen Sprechens, ja am Ende sogar metaphorisiert:
| IV.MF 188, 31A 55 | Mir sol ein sumer noch sîn zîtze herzen niemer nâhe gân,sît ich sô grôzer leide pflige,daz minne riuwe heizen mac.waz hulfe danne mich ein strît,den ir mit triuwen hân getan,sît ich in selhen banden lige?wê, wanne kumet mir heiles tac?Jô enmac mir niht der bluomen schîn,gehelfen vür die sorge mîn,unde ouch der vogel sanc.ez muoz mir staete winter sîn:sô rehte swaer ist mîn gedanc. |
[Mir wird kein Sommer noch seine Zeit im Jahr
jemals tief zu Herzen gehen,
da ich so große Leiden habe,
dass man statt Liebe Verdruss sagen kann.
Was hülfe mir dann der Kampf,
den ich für sie in Treue geführt habe,
da ich in solchen Fesseln liege?
Ach, wann kommt für mich der Tag des Glücks?
Es kann mir doch die leuchtende Pracht der Blumen
nicht gegen meine Sorge helfen
und auch nicht das Singen der Vögel.
Für mich wird immer Winter sein:
So sehr betrübt ist mein Denken.]
Hier wird schon zu Beginn der Strophe ganz allgemein ausgesagt, dass niemals ein Sommer mehr das Herz des Text-Ichs erfreuen wird (vgl. IV,1f.), auch die Blumen und der Vogelgesang werden nicht als präsente Zeichen in der Natur genannt, sondern generell als mögliche Tröstungen angeführt, die das Ich aber nicht mehr zu trösten vermögen (vgl. IV,9–11). Der Schluss der Strophe bringt dann eine neue Ebene des Sprechens von der Jahreszeit als Pointe, nämlich die Verschiebung in den Bereich der metaphorischen Rede: für das Ich hingegen werde es immer Winter sein, so betrübt seien seine Gedanken (vgl. IV,12f.). Damit ist die Bezugnahme auf eine aktuell im Hintergrund stehende Jahreszeit zu Gunsten einer überzeitlichen Stimmungscharakterisierung des Ichs (vgl. das staete [IV,12]) völlig suspendiert. Mit dem Typus des jahreszeitlich organisierten Natureingangs in seiner charakteristischen Erscheinungsform hat eine solche Nutzung der Jahreszeiten- bzw. Naturallusion als Endpunkt eines Liedes nicht mehr viel gemein, auch wenn sie natürlich Elemente von ihm nutzt und durchaus konnotativ auf ihn Bezug nehmen kann.
Um die neben der Anfangsstellung im Lied weiteren wichtigen Merkmale eines jahreszeitlich organisierten Natureingangs zu erarbeiten, ist es sinnvoll hier die Abgrenzung des Typs von noch zwei weiteren Arten der Jahreszeiten bzw. Naturrepräsentation, die ebenfalls am Liedbeginn begegnen (können), anhand einer Analyse von Textbeispielen vorzunehmen. Dafür wurden folgende drei Liedanfänge ausgewählt: für den Natureingang die erste Strophe MF 33,15Dietmar von EistMF 33,15: Ahî, nu kumt uns diu zît des dritten Tones von Dietmar von Eist18 (a), für den locus amoenus den Beginn von Walthers von der Vogelweide berühmtem Lied L 39,11Walther von der VogelweideL 39,11: Under der linden19 (b) und für den Jahreszeiteneingang die Anfangsstrophe von Hartmanns von Aue Lied MF 205,1Hartmann von AueMF 205,1: Sît ich den sumer truoc20Hartmann von AueMF 209,25.
(a) Dietmar von Eist MF 33,15: Ahî, nu kumt uns diu zît
| III,1:MF 33,15C 7, B 7 | Ahî, nu kumt uns diu zît, der kleinen vogellîne sanc.ez grüenet wol diu linde breit, zergangen ist der winter lanc.nu siht man bluomen wol getân, an der heide üebent sî ir schîn.des wirt vil manic herze vrô, des selben troestet sich daz mîn.21 |
21
[Hei, jetzt kommt für uns die (Sommer-)Zeit, der Sang der kleinen Vögelchen.
Es grünt die breit gewachsene Linde herrlich, der lange Winter nimmt ein Ende.
Jetzt sieht man schöne Blumen, auf der Heide zeigen sie ihr Leuchten.
Daher werden sehr viele Herzen froh, aus demselben Grunde findet auch meines Trost.]
(b) Walther von der Vogelweide L 39,11: Under der linden
| I.L 39,11C 128, B 42 | ›Under der lindenan der heide,dâ unser zweier bette was,dâ mugent ir vindenschône beidegebrochen bluomen unde gras.Vor dem walde in einem tal,tandaradei,schône sanc diu nahtegal. |
| II.L 39,20C 129, B 43 | Ich kam gegangenzuo der ouwe …‹ |
[I. Unter der Linde
auf der Heide,
wo das Bett von uns beiden war,
da könnt ihr finden
vortrefflich beides
ausgerissen, Blumen und Gras.
Vor dem Wald, in einem Tal,
tandaradei,
sang lieblich die Nachtigall.
II. Ich kam gegangen
zu der Aue …]
(c) Hartmann von Aue MF 205,1: Sît ich den sumer truoc
| I.MF 205,1CB 1 | Sît ich den sumer truoc riuwe unde klagen,sô ist ze vröiden mîn trôst niht sô guot.mîn sanc süle des winters wâpen tragen,daz selbe tuot ouch mîn senender muot.Wie lützel mir mîn staete liebes tuot!wan ich vil gar an ir versûmet hândie zît, den dienst, dar zuo den langen wân.ich wil ir anders ungevluochet lân,wan alsô, si hât niht wol ze mir getân. |
[I. Da ich den Sommer in Kummer und Klagen verbrachte,
darum ist meine Zuversicht auf Freude nicht so gut ausgeprägt.
Mein Lied muss das Wappenzeichen des Winters tragen,
wie es auch mein sehnsuchtsvolles Gemüt tut.
Wie wenig Wohlgefühl mir meine Beständigkeit beschert hat!
Denn ich habe völlig umsonst an sie vertan
die Zeit, den Dienst und auch das lange Hoffen.
Ich will sie anders nicht mit Flüchen belegen,
als so: Sie hat sich mir gegenüber nicht gut verhalten.]
Betrachtet man nun die Gestaltung der Naturrepräsentation im Liedanfang bei Beispiel (a), der Dietmar-Strophe, so fällt auf, dass diese mit ihrem emphatischen Beginn sofort die zeitliche Dimension eines im Jetzt sich verändernden Zustandes betont: Ahî, nu kumt uns diu zît (I, 1), heißt es hier, wobei die in dieser Hinsicht entscheidenden Signalwörter nu für die Suggestion von Aktualität, kumt für das Anzeigen einer Veränderung und zît für die Relevanz der Instanz der Zeit generell bzw. sogar der Jahreszeit22 sind, die in unserem Beispiel – wie es sehr häufig begegnet, aber nicht zwingend für den Natureingang ist – durch die Wir-Perspektive (uns) unter der Imagination von kollektiver Erfahrbarkeit zusammengeschlossen werden.23 Die im Kommen begriffene zît wird daraufhin als die Zeit des Vogelgesangs präzisiert24, wobei also durch die Aufrufung eines Details jener Naturabläufe, die mit der Konnotation von Jahreszeitenwandel behaftet sind, nun vollends die Ebene einer Bezugnahme auf den saisonalen Wandel erreicht wird, nämlich: die Zeit, in der die Vögel schweigen (Winter), wird von der abgelöst, in der sie singen (Frühling/Sommer25). Die Determination der aufgeführten Naturdetails durch den Jahreszeitenwandel zeigt sich dann auch beim folgenden Halbvers, ez grüenet wol diu linde breit (I,2), wo die Linde bezeichnenderweise im Stadium ihres Grünens erwähnt wird, was nun – in Umkehrung des Vorgangs, dass die Ankündigung des Vogelgesangs die Änderung der Jahreszeit assoziativ abgerufen hat – diesen wiederum als zeichenhaft an Naturabläufen ablesbar imaginiert. So bringt auch darauf der zweite Halbvers mit der Konstatierung zergangen ist der winter lanc (I,2) mit der expliziten Nennung der nicht mehr präsenten Jahreszeit die endgültige Festlegung des Zeithintergrunds. Diese wird noch weiter untermauert durch das folgende nu siht man bluomen wol getân (I,3), das nicht nur auf den Beginn der Strophe durch die Wiederaufnahme der Jetztzeitsuggestion (nu) und der Imagination von kollektiver Erfahrbarkeit (Wahrnehmung des Sehens, man) verweist26ReinmarMF 184,17, sondern mit der Bezugnahme auf die Sichtbarkeit der Blumen ein weiteres Naturdetail aufruft, das Frühling/Sommer indiziert. Schließlich wird das Blumenmotiv noch stärker auf die Anzeigungswirkung von Jahreszeitenwandel hin profiliert, indem die Angabe folgt, auf der Heide – eine allgemeine örtliche Festlegung, die zwar Lokalitäten suggeriert, diese aber nicht konkretisiert27 – blühten sie leuchtend (I, 3). Gerade am Beispiel der Blumen lässt sich gut demonstrieren, in welcher Weise die Aufrufung solcher Naturmotive realisiert werden kann, sind doch alle genannten Naturdetails (Verhalten der Vögel, Vegetationsstadium der Bäume, Blumen) gleichermaßen konventionell wie auch grundsätzlich in Bezug auf die Assoziationswirkung von saisonalem Wandel zunächst einmal indifferent. Erst die Angabe des Vorhandenseins oder Fehlens der hauptsächlichen Indikationscharakteristika (Vogelgesang vs. Schweigen der Vögel28Dietmar von EistMF 37,18; grünes Laub der Bäume vs. entlaubte Bäume29; Sichtbarkeit der Blumen vs. Fehlen derselben30Gottfried von NeifenKLD 15, V etc.) entscheidet über die eindeutige Signalwirkung des Motivs.31Rudolf von FenisMF 82,26Gottfried von NeifenKLD 15, II Nur so lässt sich m.E. die Tragweite dessen verstehen, wenn hier von jahreszeitlicher Organisation des Natureingangs die Rede ist: Jedes zeichenhafte Naturmotiv, das im Natureingang auftaucht, ist auf seine saisonale Ausrichtung hin mittels der Anwendung einer Basisopposition von Fehlen oder Vorhandensein strukturiert. Zusätzlich kann die jahreszeitliche Indikationswirkung aber noch durch Aktualität und sinnliche Erfahrbarkeit, ja sogar kollektive Geltung suggerierende Formeln wie das obige nu siht man, das nicht nur in Verbindung mit dem Blumenmotiv begegnet, verstärkt werden.32Gottfried von NeifenKLD 15, XXIII
Am Ende der Strophe erfolgt nun jene Anwendung der zuvor etablierten jahreszeitlichen Grundstimmung auf die Gefühlslage des Text-Ichs, die als besondere Möglichkeit der Profilierung des emotionalen Zustandes des Ichs für den jahreszeitlich organisierten Natureingang bereits mehrfach angesprochen worden ist. Wiederum ist hervorzuheben, dass dies in der Dietmar-Strophe zwar recht reduziert, aber wirkungsvoll realisiert ist, ja anhand ihrer durchaus auf ganz typische tektonische Mechanismen aufmerksam gemacht werden kann. Die im bisherigen Strophenverlauf präsent gemachte vröide (vgl. den emphatischen Ausruf zu Beginn und den Vogelsang) und Schönheit (z.B. der Blumen) des als aktuell imaginierten Sommers wird hier nämlich stufenweise in ihrer Wirkung auf den Menschen angewendet. So ist mit des wirt vil manic herzê vrô (I,4) zunächst eine nicht weiter spezifizierte Vielzahl von Individuen angesprochen, die durch das Eintreffen der schönen Jahreszeit wieder positiv gestimmt sind, wobei der Text selbst durch die kausale Anbindung (des) die Begründetheit einer solchen Gestimmtheit erst unterstellt, gerade weil es auch vil manic herze ist, dem es so ergeht. Insofern wird hier die Instanz der Gesellschaft, auf sie verweist ja das angesprochene vil manic herze, in einem anscheinend kausal sich aus dem Vorherigen ergebenden Zustand der vröide vorgeführt, der – so könnte man die Suggestionswirkung des Textes umschreiben – nicht nur der in der Natur vorherrschenden Stimmung entspricht, sondern sich gleichsam sinnfällig als jahreszeitenadäquates Verhalten ergibt.33 Dieser Zwischenschritt einer – wie auch immer – präsent gemachten Gesellschaftsebene, mit ihrer als jahreszeitlich passend suggerierten Gestimmtheit, begegnet sehr oft in den Natureingängen im Minnesang, ist manchmal aber auch verkürzend fortgelassen.34Ulrich von WinterstettenKLD 59, XII Jedenfalls scheint mir die Bindung der jahreszeitlichen Vorgänge in der Natur an die gesellschaftliche Gestimmtheit, die einen Rahmen eigentlich adäquaten Verhaltens entwirft, sehr bedeutsam im Kontext der poetischen Funktion des Natureingangs zu sein; sie wird im Folgenden in ihrem Zusammenhang mit der Gesellschaftsthematik des Minnesangs noch näher untersucht werden. Dieser Rahmen einer adäquaten Einstellung bezüglich der Jahreszeit, die durch die Gesellschaftsebene präsent wird, dient nun der Profilierung der emotionalen Gestimmtheit des Ichs, indem diese entweder kontrastiv oder komplementär dazu gesetzt wird.35 Im besonderen Falle von MF 33,15 geschieht dies in gleichgerichteter Form, wie es der letzte Halbvers der Strophe, des selben troestet sich daz mîn (I,4), zeigt. Dabei wird also nicht nur betont, dass sich die Wirkung des jahreszeitlichen Wandels beim Text-Ich in ähnlicher Weise als positive Aufhellung seiner emotionalen Befindlichkeit einstellt wie bei den vielen Anderen, sondern zudem auch hervorgehoben, dass es der gleiche Grund ist, der diese Veränderung verursacht. Dadurch ergibt sich der für den Natureingang relativ typische Dreischritt von jahreszeitlich gestimmter Natur, adäquater Haltung der Gesellschaft und emotionaler Befindlichkeit des Ichs, der hier im konkreten Fall Gesellschaftsinstanz und Ich als in Bezug auf die Ursache der Stimmungsaufhellung und in dieser selbst übereinstimmend parallel anordnet; allerdings ergibt sich durch die Angabe des Trostes, den das Herz des Text-Ichs von der jahreszeitlichen Entwicklung empfängt, für dieses gegenüber der Vielheit der Herzen eine feine, aber nicht unwesentliche, anders gelagerte Befindlichkeitsnuance. War bei der auf Gesellschaftsrepräsentation abzielenden Angabe des wirt vil manic herze vrô (I,4) die Implizierung eines zuvor wohl unglücklichen Befindens zwar durchaus gegeben, so tritt sie nun durch die Angabe einer Tröstung, die sich für das Herz des Text-Ichs ergibt, noch weiter hervor, da der vorherige, traurige Zustand doch stärker mitaufgerufen wird. Schließlich ist ja auch das Faktum des vrô-Werdens als völlige Umkehrung einer Gestimmtheit in Freude viel weitreichender als eine Tröstung, die impliziert, dass ein unglücklicher Zustand durch positive Impulse lediglich relativiert wird. Daher bleibt also – trotz der stark ausgeprägten Gleichschaltung der Befindlichkeit von Gesellschaft und Ich – ein fein nuancierter Restbestand von Differenz erhalten. Dies ist insofern bedeutsam, als diese Charakterisierung der emotionalen Befindlichkeit des Ichs nicht nur wie bei der Angabe einer stimmungsbezogenen Veränderung der anderen Personen den Konnex auf eine zuvor vom Winter erzeugte Traurigkeit zulässt, obwohl diese hier im Falle der Strophe auch für das Ich wohl doch hauptsächlich gemeint ist, sondern darüber hinaus einen potentiellen Anknüpfungspunkt für die Liebesthematik bereitstellt. Der unglückliche Zustand des Herzens beim Text-Ich könnte nämlich durchaus – zumindest ließe sich die sich nur in feinen Nuancen andeutende Differenz in dieser Hinsicht konzeptualisieren – auch durch Liebeskummer gegeben sein.36 Dieses Potenzial muss hier im Falle von Dietmars MF 33,15 nicht unbedingt als realisiert angenommen werden, ist doch die liedhafte Einheit der Strophen zumindest fraglich.37 Entscheidend ist aber, dass in der nur in Nuancen anders charakterisierten Stimmung des Ichs die Anknüpfung der Liebesthematik als Möglichkeit angelegt ist.
Lässt man nun die Anbindung der Jahreszeitenthematik an die emotionale Gestimmtheit des Ichs als poetische Anwendungsmöglichkeit des Topos beiseite, so sind besonders die folgenden Charakteristika des Natureingangs zur Findung einer Definition des Typs hervorzuheben: die Imagination von Aktualität einer bestimmten Jahreszeit, explizite Nennung von dieser und Durchführung durch auf die Saisonalität hin organisierte Naturdetails. Vergleicht man dies nun mit den anderen beiden Formen der Jahreszeiten- bzw. Naturrepräsentation, die hier im Übrigen durch zwei Beispiele vertreten sind, die immer wieder als der Kategorie des Natureingangs zugehörig eingeordnet worden sind38, so fällt eine grundsätzlich andere Realisation der Jahreszeiten- bzw. Naturthematik auf. Das berühmte ‹Lindenlied› L 39,11 von Walther von der Vogelweide präsentiert sich uns in diesem Zusammenhang als ein in Frauenrede gefasster, rückschauender – und gleichwohl aktualisierter39 – Bericht einer Liebesbegegnung im Freien40Carmina BuranaCB 185, der den Naturtopos des locus amoenus, den «ideal schönen Naturausschnitt»41, aufruft, den ERNST ROBERT CURTIUS als traditionellen literarischen Motivkomplex des Lustorts seit der Antike nachverfolgt und wie folgt umrissen hat: «Sein Minimum an Ausstattung besteht aus einem Baum (oder mehreren Bäumen) und einer Wiese. Als drittes Element pflegt fast immer ein Bach oder Quell dabei zu sein. Dazu treten häufig viertens Vogelgesang und fünftens Blumen»42. Zusätzlich kann auch noch der sanfte Lufthauch (aura) mitaufgerufen werden.43 Das mag zwar durchaus ein relativ unpräziser Merkmalskatalog zur Definition des Topos sein, schließlich überschneiden sich die obigen Naturmotive ja auch zu einem großen Teil mit der Naturmotivik des jahreszeitlich organisierten Natureingangs im Minnesang, dennoch ist er aber – gemessen an der Variabilität der konkreten Erscheinungsform, die trotz aller Konstanz des Topos möglich ist44, und die verschiedenen Realisationsweisen in einer Vielfalt von Gattungskontexten, in denen der Lustort auftreten kann45 – eine den wesentlichen Kern recht gut treffende Motivzusammenstellung, deren Elemente – über das Minimum hinaus – jeweils realisiert, aber auch fortgelassen werden können. So finden sich denn auch in Walthers L 39,11 die Bausteine des Baumes (linde [I,1]), der Wiese (gras [I,6]; ouwe [II,2]), der Blumen (I,6 sowie III,3 und 7) und des Vogelgesangs (I,9), während die typischen Versatzstücke Quelle und Lufthauch nicht explizit genannt sind. Viel entscheidender als die Identifizierung über das Vorhandensein bestimmter Motivbausteine und der Aspekt der Ausdehnung der Naturthematik über das Liedganze46,Albrecht von JohansdorfMF 90,32 der beim Natureingang nur in ganz besonderen Fällen begegnet, ist m.E. der Aspekt der Realisation der Naturrepräsentation, für die im Falle des locus amoenus wiederum CURTIUS die entscheidenden Hinweise gegeben hat, indem er durch seine Klassifikation des Lustorts als rhetorisches argumentum a loco auf die dominierend räumliche Organisation dieses Typs der Naturrepräsentation hingewiesen hat.47 Dies zeigt sich wiederum in ganz deutlicher Weise bei der in L 39,11 aufgerufenen Naturmotivik: So ist schon die erste Angabe des Textes Under der linden / an der heide (I,1f.) eine durchweg auf die Raumdimension hin organisierte Naturrepräsentation, wird doch die Heide nicht wie in MF 33,15 in einem bestimmten Stadium jahreszeitlichen Wachstums aufgerufen, sondern bezeichnenderweise in ein Präpositionalgefüge eingebunden, das eine Ortsinformation darstellt. Diese wird wiederum durch eine weitere räumliche Angabe einer Präpositionalphrase ergänzt, die die Örtlichkeit, von der berichtet wird, weiter spezifiziert, nämlich: unter der Linde, die auf der Heide steht, soll sich das Folgende abgespielt haben. Nun ist uns zwar die Angabe an der heide auch schon aus MF 33,15 bekannt, wo sie den Ort der Blumenpracht bezeichnet (vgl. I,3) und dort als allenfalls pseudo-konkrete Information eines allgemeintypischen Motivbausteins, der vielmehr auf suggestive Wirkung denn auf Raumfestlegung zielt, charakterisiert worden. Dies ist bei L 39,11 in Bezug auf die Pseudo-Konkretion kategorial freilich nicht anders – es ist ja nicht so, dass wir tatsächlich wüssten, welcher bestimmte Ort hier angegeben ist –; entscheidend ist, dass der Grad der Suggestion, es handle sich um eine gezielte Ortsinformation durch die präpositionale Reihung und die weitere Konkretisierung dâ unser zweier bette was (I,3), ja die in Publikumsanrede erfolgende, auf Beglaubigung zielende Beteuerung dâ mugent ir vinden (I,4) ungleich höher ausfällt. Die Betonung raumkonstituierender Gesichtspunkte ergibt sich ferner auch aus dem zweimaligen Anknüpfen an die Ortsangabe durch die Versanapher dâ. Schließlich setzt das vor dem walde in einem tal (I,7) mittels Fortführung der Örtliches festlegenden präpositionalen Reihung die Organisation der Naturrepräsentation unter dem Primat der Raumdimension noch weiter fort. Interessanterweise entsteht dabei gerade durch die Nutzung des unbestimmten Artikels im Falle von in einem tal eine noch viel stärkere Suggestionswirkung von tatsächlicher Ortsbeschreibung, als dies bei den Präpositionalgefügen mit bestimmten Artikeln zuvor der Fall gewesen ist.
Betrachtet man hingegen die Naturmotive der Blumen (bzw. des Grases) und des Vogelsangs, so fällt zunächst auf, dass sie weniger der Ortsbestimmung dienen, als einer Charakteristik der Situation der Liebesbegegnung, von der der narrative Bericht des weiblichen Ichs rückblickend handelt. Wir nähern uns hiermit einem zweiten wesentlichen Aspekt der locus-amoenus-Repräsentationen im Minnesang, der eine tendenzielle Differenz zwischen der Lustort-Topik und den jahreszeitlich geprägten Natureingängen darstellt. Obwohl viele Beispiele des letzteren Typs diese wohl zu unterlegende, unterschiedliche prinzipielle Ausrichtung durch kompliziertes Spiel mit den Zeitebenen verwischen48, kann man m.E. eine tendenzielle Neigung der locus-amoenus-Topik zur Einbindung in einen Erzählgestus beobachten, wobei Ich-Perspektive der Narration und Präteritum als Zeitebene gerade im weiteren Kontext der anderen europäischen Lyriktraditionen relativ häufig begegnen49, während der jahreszeitliche Natureingang, obwohl auch er über zahlreiche narrative Elemente verfügen kann, wohl wegen seiner tendenziellen Verpflichtung auf die Imagination von Aktualität grundsätzlich dem Präsens zuneigt, wobei zur reflexiven Ich-Perspektive des Werbungsliedes in solchen Passagen oft ein vereinnahmendes Wir tritt. Dies scheint mir als Ausdruck einer grundlegenden Differenz von suggestiver Inklusion (Natureingang) und vorgetäuschter Exklusion (locus amoenus) zu werten zu sein, mit der Lied L 39,11 wiederum in ganz eigener Weise umgeht, weist es doch durch die aktualisierenden Publikumsanreden wie da mugent ir vinden (I, 4) und seht, wie rôt mir ist der munt (II,9) partiell einen Sprechgestus auf, der in deutlicher Weise an das (männliche) Werbungslied erinnert, so dass kunstvoll an der Verwischung dieser Differenz gearbeitet wird. Betrachten wir die Schachtelung der Zeitebenen in Strophe I genauer, so fällt auf, dass die Einführung der Vergangenheit als Zeitebene – grammatikalisch noch in der Wir-Position – in Vers I,3 mit der Angabe dâ unser zweier bette was erfolgt und somit den narrativen Duktus, der einen ‹Erlebnisbericht› suggeriert, andeutet. Dies wird jedoch durch die Fortführung dâ muget ir vinden (I,4) sofort präsentisch unterbrochen, die aber durch den Hinweis auf das jetzt noch zu findende Resultat des im Folgenden Berichteten (gebrochen bluomen unde gras [I,6]) den suggestiven Sog des Berichts letztlich sogar noch verstärkt. Schließlich wird erst mit der Angabe schône sanc diu nahtegal (I,9) am Schluss der Strophe, nachdem die Zeitebene zunächst in der Schwebe gehalten ist, die Vergangenheitsform des Erzählberichts wieder restituiert, so dass der suggerierte ‹Erlebnisbericht› zu Beginn der II. Strophe nun in Ich-Perspektive in für die Einbindung des locus amoenus nicht untypischer Weise voll zur Geltung kommt (Ich kam gegangen / zuo der ouwe [II,1f.]). Zusammenfassend lässt sich also für die Art der Organisation der Naturmotive sagen, dass sie allesamt nicht in Hervorhebung ihres jahreszeitlichen Status erscheinen und somit auch nicht auf Jahreszeitindizierung hin profiliert sind50; stattdessen sind ein Teil der Naturmotive gerade auf Raumkonstitution hin organisiert (Linde, Heide, Wald, Tal), während andere zur weiteren Charakterisierung des Ortes der erzählten Begebenheit eingesetzt (Blumen, Gras, Nachtigall), also tendenziell schon stärker auf die Narrration hin verpflichtet sind (vgl. das gebrochen-Sein von Blumen und Gras!), aber dennoch insgesamt unter dem Primat der Ortsschilderung stehen. Die Determination der Naturrepräsentation durch räumliche Organisation der Naturmotive im Falle des locus amoenus hebt sich damit in deutlicher Weise von der Realisation der Naturrepräsentation beim jahreszeitlichen Natureingang ab, bei dem die Naturmotive in ihrem Erscheinungsbild vielmehr vom Standpunkt der Saisonalität gestaltet sind. Das heißt jedoch nicht – und es ist zu hoffen, dass der kurze analytische Durchgang durch den Liedanfang von L 39,11 dies auch gezeigt hat –, dass die Dimension der Zeitlichkeit für den locus amoenus und seine Naturrepräsentation keine Rolle spielte.51 Selbst aber, wenn die Zeitlichkeit eines Davor und Danach so deutlich in die Naturmotivik eingeschrieben ist, wie dies bei Under der linden im Falle von Blumen und Gras zu beobachten ist, so ist diese an der Natur ablesbare Veränderung eines Zustandes genau nicht durch jahreszeitlichen Wandel erreicht, sondern durch das erotische Erlebnis verursacht (deswegen sind ja Blumen und Gras gebrochen!), für das die Naturdetails in ihrer spezifischen Gestalt so zeichenhaft stehen. Am deutlichsten wird das sicher beim folgenden Hinweis des Text-Ichs aus der II. Strophe: Bî den rôsen er [=jemand, der dort vorbeikommt] wol mac, / tandaradei, / merken, wâ mirz houbet lac (II,7–9). Insofern ist in die Naturrepräsentation des Lustorts von L 39,11 – anders als beim jahreszeitlich organisierten Natureingang – gerade nicht der saisonale Wandel in die Naturmotive eingeschrieben, sondern der Liebesvollzug selbst.
Im Gegensatz zum Typ des locus amoenus, der zwar Naturdetails aufruft, aber auf eine Markierung von saisonalem Wandel und überhaupt eine explizite Nennung der als aktuell zu imaginierenden Jahreszeit verzichtet, weist der Typ des Jahreszeiteneingangs gerade solche saisonalen Festschreibungen auf, ohne jedoch diese durch Naturmotive zu untermauern.52ReinmarMF 167,31Walther von der VogelweideL 73,23Walther von der VogelweideL 99,6 Um dies genauer zu erläutern, ist an dieser Stelle die Eingangsstrophe des Liedes 205,1 von Hartmann von Aue als Beispiel gewählt worden. Zunächst einmal bereitet es keine Schwierigkeiten, die Charakteristika der Strophe, die das fünfstrophige Lied eröffnet, das um die Auslotung der Schuldfrage im Falle des aus der einseitigen Liebesverehrung resultierenden Leids des Text-Ichs kreist, zu bestimmen: In ihr wird an zwei Stellen – in I,1 der Sommer und in I,3 der Winter – explizit eine Jahreszeit genannt, auf jahreszeitliche Naturdetails wird jedoch nicht Bezug genommen. Die Schwierigkeiten beginnen allerdings dann, wenn man das Lied genauer betrachtet. So ist z.B. die Frage, was eigentlich für die Sprechsituation als aktuell zu imaginierende Jahreszeit angenommen werden muss, gar nicht so leicht zu beantworten.53 Meist ist in diesem Zusammenhang die Einlassung Sît ich den sumer truoc riuwen unde klagen (I, 1) als kausaler Nebensatz aufgefasst54 und der Liedanfang als Realisation eines Natureingangs gelesen worden, der so zusammenzufassen sei: «Der Trauernde erfährt am sumer nur, was des Winters ist»55. Aber ist deshalb die Sommerzeit als Sprechgegenwart des Ichs anzunehmen?56 Dies scheint mir aus mehreren Gründen nicht zutreffend zu sein.
Für das Verständnis der Strophe ist es an sich relativ unerheblich, ob der Nebensatz im Liedeingang nun als kausal oder temporal zu lesen ist, da durch den Tempuswechsel von truoc (I,1) zu ist (I,2) eine Vorzeitigkeit des im Nebensatz angegebenen Zustandes des Ichs angenommen werden kann, die nahelegt, dass mit dem sumer (I, 1) die vergangene Jahreszeit benannt ist; die Auffassung von sît (I,1) als temporaler Konjunktion im Sinne des heutigen ‹nachdem› würde dies nur noch deutlicher unterstreichen. Es ist deswegen die Sprechgegenwart durchaus als im Winter liegend anzunehmen. Der Liedanfang wäre demnach etwa so zu paraphrasieren: Da das Text-Ich den Sommer, der – das ist wohl zu ergänzen – doch als eine Zeit der Freude gilt, schon unglücklich und in Kummer verbracht hat, gibt es für dieses jetzt – im Winter – nun wirklich nicht mehr viel Hoffnung darauf, Freude zu erlangen (vgl. I,1f.). Es wird hier also vom Text-Ich durchaus implizit suggeriert, es gäbe eine präexistente, sich ‹natürlich› ergebende Zuweisung von vröide und leit an die zwei Jahreszeiten, gemäß welcher der Sommer besonders prädestiniert für Freude sei; damit ist natürlich die Vorstellung, die viele Natur- bzw. Jahreszeiteneingänge erwecken, dass der Sommer die Zeit gesellschaftlich geforderter Freude ist, konnotativ mitaufgerufen. Entscheidend ist allerdings, dass der Text hier implizit unterstellt, dies gelte auch für das persönliche Befinden. Insofern ist es richtig, dass die Vorstellung vom Sommer als Zeit der vröide im Kontrast steht zu der tatsächlichen Befindlichkeit des Ichs in der Vergangenheit, denn das Text-Ich habe im Sommer nur Kummer gehabt, und so wird erst der argumentative Sog erzeugt, dass es im Winter, als der an sich schon freudenarmen Zeit, nun wirklich nicht viel Positives zu erwarten habe. Damit erfüllt der Jahreszeiteneingang in Lied MF 205,1 durchaus eine dem Natureingang recht ähnliche Funktion, nämlich die der Profilierung der Gefühlslage des Ichs. Jedoch die sich in geringerem Ausmaß einstellende Eindeutigkeit der Zuordnung der als präsent zu imaginierenden Jahreszeit entsteht aber wohl mit Sicherheit auch dadurch, dass sie eben nicht durch Textstrategien der Suggestion von kollektiver Überprüfbarkeit und die Untermauerung durch Jahreszeitenwandel vorführende Naturdetails ‹festgezurrt› ist. Vielmehr muss die in der Sprechsituation als aktuell zu unterlegende Jahreszeit erst aus einer Interpretation des Nebensatzes vom Rezipienten erschlossen werden. So bringt denn auch der dritte Vers mit seiner Jahreszeitennennung winter bezeichnenderweise wiederum keine direkte Bestätigung dieser Annahme. Denn mit der Angabe des Text-Ichs mîn sanc süle des winters wâpen tragen (I,3), die auf die Sangesthematik überleitet, wird zwar die wohl zu imaginierende aktuelle Jahreszeit als Wort benutzt, allerdings stellt sich eine bedeutende Umschaltung im Gebrauch der Jahreszeitennennung ein. Denn mit der auf Rüstungsvokabular zurückgreifenden Formulierung, das Lied des Text-Ichs müsse das wâpen des Winters tragen, wird die Aussage, dieses müsse notgedrungen traurig klingen, in einer metaphorischen Weise realisiert, die für die Jahreszeitennennung die Funktion der Jetztzeitangabe suspendiert. So ist es für die Interpretierbarkeit der in I,3 gemachten Einlassung völlig unerheblich, ob der Winter auch die für die Sprechsituation anzunehmende aktuelle Jahreszeit ist oder nicht, ja betrachtet man die Passage isoliert, kann man das auch gar nicht mehr bestimmen. Damit zeigt der Anfang von Lied MF 205,1 m.E. ein wesentliches Charakteristikum des Jahreszeiteneingangs auf: Da von diesem bestimmte Suggestionsstrategien wie eben die Vorführung von Naturdetails im Jahreszeitenwandel nicht genutzt werden, ist die von ihm erzeugte Sogkraft der Aktualitätsimagination weniger stark ausgeprägt und kann jederzeit sogar durch ein Umschalten zur nur mehr metaphorisch zu verstehenden Jahreszeitenrede, die ihm als poetisches Potenzial inhärent ist, fast ganz suspendiert werden. Im Falle von Lied MF 205,1 ist dieser Vorgang der metaphorischen Nutzung der Jahreszeitenrede im dritten und vierten Vers, wo die Metapher winters wâpen ja auch noch auf den senenden muot des Ichs angewendet wird, noch weitreichender. Obwohl hier nämlich im Grunde weiter das Verständnis zu unterlegen wäre, dass das Lied des Ichs im Zeichen des Winters ja auch in der der Jahreszeit entsprechenden Weise realisiert ist, bewirkt die vorherige Betonung eines der Jahreszeitenordnung enthobenen Kummers und die Angabe des Ichs, daz selbe tuot ouch mîn senender muot (I,4), die als Ursachen der Traurigkeit des Liedes imaginiert werden, dass die Kongruenz von wohl aktueller Jahreszeit und Gestaltung des Liedes untergeht. Damit zeitigt die Nutzung der Jahreszeitenrede als Metapher in der Konsequenz das Ende der Jahreszeitenrepräsentation selbst, da sie eine Möglichkeit bereitstellt, die Jahreszeitentopik zu verlassen, ohne dass auf die Imagination des jahreszeitlichen Liedhintergrunds überhaupt noch eingegangen werden muss, weil dieser bereits durch den metaphorischen Gebrauch der Jahreszeit an den Rand gedrängt worden ist. Ab dem folgenden Wie lützel mir min staete liebes tuot! (I,6) wird die Minnethematik ohne weitere Nutzung der Jahreszeitenrhetorik behandelt. Schließlich ist zît in Vers 7 dann auch bezeichnenderweise nicht als Signalwort eines Jahreszeitenzustandes eingesetzt, sondern wird in allgemeiner Bedeutung im Kontext eines langen, aber dem Ich nutzlos erscheinenden Minnedienstes gebraucht. Der zweite Teil der Strophe steht wiederum nicht im Zeichen eines Klagegestus (wie man aufgrund der Angabe mîn sanc süle des winters wâpen tragen [I,3] eigentlich hätte annehmen müssen!), sondern realisiert sich als Unmutsäußerung eines im Dienst an der Dame verzweifelnden Ichs. Dabei ist es allerdings gar nicht so eindeutig, ob diese mit dem nicht weiter spezifizierten ir (I, 6), das die Instanz bezeichnet, an die das Ich seine Zeit, den Dienst und seine Hoffnung verschwendet habe (vgl. I,6f.), überhaupt gemeint ist; denkbar wäre auch, dass sich die Äußerung noch auf staete (I,5) bezieht.57 Dies hätte dann zur Folge, dass nicht die Dame vom Text-Ich angegriffen wird, sondern – wie es TRUDE EHLERT herausgearbeitet hat – das Konzept des Minnedienstes selbst.58 Aufgrund des Endes der Strophe, wo immer noch die Instanz, über die gesprochen wird, nur mit Personalpronomen gekennzeichnet (I,8: ir, I,9: si) ist, scheint mir aber eher die Dame gemeint zu sein, passt zu dieser Lesart doch das si hât niht wol ze mir getân (I,9) besser. Das Text-Ich gibt hier an, über die Dame nicht anders fluchen zu wollen, außer mit der – nicht gerade kräftigen – Verwünschung: «Sie hat mich nicht gut behandelt» (vgl. I,8f.), was m.E. weniger eine vornehme Zurückhaltung zeigende Geste des Text-Ichs darstellt.59 Vielmehr erklärt sich die Stelle als eine Pointe, die – etwas abgewandelt – auch bei Walther von der Vogelweide wieder begegnen wird60: Das Text-Ich kündigt an, einen Fluch auszustoßen, heraus kommt aber eine relativ ‹weichgespülte› Formulierung. Damit endet die Strophe letztlich in einer Ironisierung des eigenen Unmutsgestus durch das Ich.61
Auf einen wichtigen Aspekt ist hier noch einzugehen, durch den sich der Jahreszeiteneingang grundsätzlich vom Natureingang unterscheidet. Da nämlich – wie dies schon beschrieben worden ist – der Natureingang durch seine Aufführung jahreszeitlich determinierter Naturdetails im sonst eher auf konkrete situative Festlegung verzichtenden Sprechregister des Werbungsliedes leicht als ‹Fremdkörper› zu identifizieren ist, außer er wird diesem – wie dies bisweilen geschieht – durch seine sprachliche Realisation angeglichen, so stellt sich diese Differenz beim Jahreszeiteneingang mit seinem nicht auf konkrete Naturabläufe, sondern nur auf einen allgemeinen jahreszeitlichen Stimmungshintergrund des Liedes zielenden Gebrauch im Grunde gar nicht ein. Er ist gerade deshalb im Kontext des Werbungsliedes viel unauffälliger, weswegen es auch sinnvoll ist, ihn als eigenen Typ vom jahreszeitlichen Natureingang zu separieren, um die Differenz zwischen beiden nicht durch eine gemeinsame Subsumierung unter dem Begriff des ‹Jahreszeitentopos› – wie es jüngst häufig geschehen ist – zu verwischen.
Will man nun zu einer Definition des jahreszeitlich organisierten Natureingangs als eng umgrenztem Typ der Eingangsgestaltung gelangen, die erst ein zuverlässiges Bild über das zahlenmäßige Auftreten des Natureingangs in den verschiedenen Phasen der Minnesangtradition und die charakteristischen Techniken der Einmontierung des Topos in das Werbungslied erlaubt, dann scheint es mir dringend nötig, diesen von den hier näher betrachteten Typen der Jahreszeiten- bzw. Naturallusion in Binnenstellung, des locus amoenus und des Jahreszeiteneingangs möglichst trennscharf abzugrenzen. Deshalb soll an dieser Stelle noch einmal kurz zusammengefasst werden, was den Natureingang jeweils von diesen anderen Formen der Jahreszeiten- bzw. Naturrepräsentation unterscheidet. Der Natureingang bildet – im Gegensatz zur Naturallusion in Binnenstellung – die Möglichkeit einer Eingangsgestaltung eines Liedes bzw. einer Strophe; er knüpft also nicht an einen vorherigen Liedzusammenhang an, sondern setzt die Profilierung der emotionalen Befindlichkeit des Ichs selbst in Gang. Er besetzt somit eine ganz andere tektonische Funktionsstelle im Gefüge des Werbungsliedes und bleibt auch deutlicher von der Liedumgebung separiert als die in Binnen- und Endstellung auftretende Jahreszeiten- bzw. Naturrepräsentation, die – so hat es sich gezeigt – sich in den Werbungslied-Kontext eines immer wieder neuansetzenden Kreisens um die Thematik der Liebe unter jeweils anderer Schwerpunktsetzung tendenziell einpasst. Von der locus amoenus-Repräsentation im Minnesang, die hier auf den Liedeingang beschränkt oder aber das Liedganze umfassend begegnen kann, unterscheidet sich der Natureingang in der expliziten Angabe einer als aktuell zu imaginierenden Jahreszeit und der durchgängigen Organisation der Naturdetails auf die Anzeige eines saisonalen Wandels hin, so dass beide Typen besonders in der Ausrichtung der Naturrepräsentation anders strukturiert sind: dominieren beim locus amoenus die räumlichen Ordnungskriterien, so sind es beim Natureingang die (jahres-)zeitlichen. Schließlich differieren Natur- und Jahreszeiteneingang, die beide über eine explizite Nennung einer Jahreszeit verfügen, in entscheidender Weise in der Form ihrer Durchführung. Während sich der Jahreszeiteneingang dadurch organischer in den Kontext des Werbungsliedes einfügt, dass er keine konkreten Naturdetails vorführt, und so im weitgehend abstrakten Sprechregister der Minnekanzone nur einen nicht weiter ausgeführten saisonalen Hintergrund aufruft, repräsentiert der Natureingang durch seine Untermauerung des Jahreszeitenwandels anhand der Naturdetails eine Sphäre konkreter, situativer Festschreibung, die dem Werbungslied sonst eher nicht zu eigen ist. Dies bedeutet in der Konsequenz auch, dass der Natureingang tendenziell andere Techniken der Einbindung ins Liedganze fordert62 als der Jahreszeiteneingang. Im Vorgang der weitgehenden Angleichung des Jahreszeiteneingangs an das Sprechregister des Werbungsliedes mittels der dem Topos aufgrund seiner geringeren Suggestionswirkung von Aktualität als poetische Möglichkeiten inhärenten Techniken der spontanen Metaphorisierung bzw. des Aufgehens im generellen Sprechen zeigt sich dies in besonderer Weise. Somit müssen als die wesentlichen Differenzkriterien des Natureingangs gegenüber den anderen Typen der Jahreszeiten- bzw. Naturrepräsentation im Minnesang die Anfangsstellung, die Jahreszeitennennung und die Aufrufung von (saisonalen Wandel suggerierenden) Naturdetails festgehalten werden.
Bevor nun an dieser Stelle eine Minimaldefinition zur Identifizierung eines Natureingangs im deutschen Minnesang63 aufgestellt wird, ist Folgendes einschränkend hervorzuheben: Jeder diesbezügliche Bestimmungsversuch ist insofern angreifbar, als die Texte selbst sich bisweilen einer eindeutigen Einordnung entziehen. Deswegen werden immer wieder Lieder oder Strophen in den Blick geraten, bei denen die Zu- bzw. Abweisung der Zugehörigkeit in gewisser Weise Ermessenssache ist. Dies darf jedoch nicht heißen, dass auf eine – ausdrücklich als vorläufige Arbeitsgrundlage zu verstehende – Minimaldefinition verzichtet werden kann, da sonst die wichtige Abgrenzung des Topos von anderen Typen der Jahreszeiten- bzw. Naturrepräsentation nicht erfolgen kann, die erst zur Gewinnung von belastbaren Erkenntnissen über Vorkommen und tektonischer Organisation des Natureingangs führen mag. Deshalb scheint es mir wichtig, zur Identifizierung eines jahreszeitlichen Natureingangs folgende Grundbedingungen im Sinne einer Minimaldefinition herauszustellen, die es gewährleisten, ihn von Repräsentationen der Naturallusion im Liedinneren bzw. am Liedende, der locus amoenus-Topik und des Jahreszeiteneingangs relativ zuverlässig zu unterscheiden: «Ein Natureingang im deutschen Minnesang stellt eine am Anfang eines Liedes bzw. einer Einzelstrophe stehende thematische Einheit dar, in der neben der Nennung einer als aktuell bzw. aktuell anstehend suggerierten Jahreszeit64Heinrich von VeldekeMF 59,23 (möglich ist auch die Nennung eines Monats65Gottfried von NeifenKLD 15, VI) oder der nicht mehr aktuellen Jahreszeit66Heinrich von MorungenMF 140,32 auch die Untermauerung des saisonalen Wandels durch mindestens eine in der Natur zu findende, der Jahreszeit entsprechende Erscheinung67ReinmarMF 165,1 (bzw. durch die Angabe des ebenfalls jahreszeitlich passenden Fehlens dieser Erscheinung68Dietmar von EistMF 37,18) zu finden ist.»