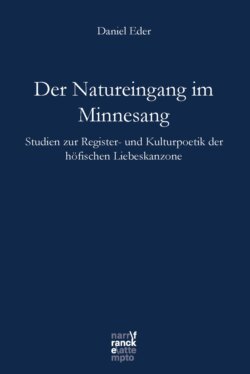Читать книгу Der Natureingang im Minnesang - Daniel Eder - Страница 6
I Der Natureingang als Forschungsproblem 1 Einordnung in die Minnesangforschung
ОглавлениеDass keine Deutung, ja keine noch so objektive Analyse1 von Kunstwerken überhaupt gänzlich unabhängig sein kann vom jeweiligen Standpunkt des Betrachters, der immer schon mit einem Vor-Wissen und Vor-Urteilen seinem Beobachtungsgegenstand gegenübertritt2, ist ein Dilemma, dem man wohl nicht anders begegnen kann, als dass man in einer wissenschaftlichen Untersuchung die eigenen theoretischen Vorannahmen und angewandten Methoden möglichst transparent macht. Deshalb erscheint es dem Verfasser vorliegender Arbeit über den Natureingang im Minnesang ratsam, erst einmal darzustellen, wie er sich in der Forschungslandschaft zum Minnesang generell positioniert3Hartmann von AueMF 218,5, da die Minnesangforschung – im Übrigen schon in ihrer Frühphase im 19. Jahrhundert – ganz unterschiedliche Sichtweisen auf ihr Phänomen hervorgebracht hat4 und bis heute zwischen den Polen einer biographisch-lebensweltlichen Referentialisierung5, einer sozialen Funktionszuschreibung6 oder der Auffassung vom Minnesang als artifiziellem, eigengesetzlichem und dezidiert literarischem Gebilde7 schwankt. Besonders umstritten ist in den letzten Jahrzehnten die Frage nach der (dominanten) medialen Existenzform der mittelhochdeutschen Lyrik gewesen, wobei sich das von der Forschung für die Texte des Mittelalters allgemein angesetzte Spannungsfeld von Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit für den Minnesang in der Opposition von Aufführungsbasiertheit vs. schriftliterarischem Status und (paralleler) Realisation als Leselyrik niedergeschlagen hat.8 In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist in der Altgermanistik vor allem der kommunikationspragmatische Ansatz, der durch HUGO KUHNS Aufsatz «Minnesang als Aufführungsform»9 initiiert worden ist, dominierend gewesen, der den – im Vergleich zur lebensweltlichen Existenzform als Verbund polymedialer Darstellungsformen wie Text, Musik und theatraler Mittel im Vortrag – defizitären Status der Minnesangtexte in der schon schriftliterarisch orientierten Überlieferung durch die drei großen Sammelhandschriften betont.10 Gegen den Traditionsstrang, den Minnesang biographisch zu lesen, ist so das Konzept einer Rollenlyrik11 gesetzt und auch mit zunehmender Trennschärfe zwischen einer internen Sprechsituation (d.h. auch die Anrede eines impliziten Publikums) und externer Rezeptionssituation (also dem externen Publikum) unterschieden worden.12 Die Zielsetzung dieser Forschungsrichtung, in Einzelinterpretationen von der Textgrundlage ausgehend auf Möglichkeiten der Darbietungsgestaltung zu schließen und so die verloren gegangene Aufführungsdimension zu rekonstruieren13, ist allerdings wegen ihres unausweichlich spekulativen Charakters auch in die Kritik geraten.14 Zwar ist in den letzten Jahrzehnten der mündlich-performative Vortrag vor der Öffentlichkeit der Hofgesellschaft als der eigentliche ‹Sitz im Leben› des Minnesangs zum häufig wiederholten Forschungskonsens erklärt worden15, aber es hat auch Gegenstimmen gegeben. Die Kritik am kommunikationspragmatisch ausgerichteten Forschungszweig hat sich vor allem an den weiteren theoretischen Annahmen entzündet, die sich an die Vorstellung vom Minnesang als Aufführungsform angelagert haben. Diese haben nämlich – 1976 niedergelegt von ERICH KLEINSCHMIDT in einem wirkungsmächtigen Aufsatz und fortgeführt von CHRISTA ORTMANN und HEDDA RAGOTZKY – dezidiert in die Richtung einer funktionsgeschichtlichen Deutung des Minnesangs als «Zeremonialhandeln»16 oder «Ritual»17 geführt, die jenen als Bestandteil des höfischen Festes zum Zwecke der höfischen Repräsentation und der Stiftung ständischer Identität sowie gemeinschaftlicher vröide verortet haben.18 Auch der von JAN-DIRK MÜLLER vorgeschlagene Begriff des ‹Pararituals›19, der u.a. die Differenz einer auf Variation ausgelegten Kunst zum iterativen Prinzip des Rituals zu berücksichtigen sucht, weist aber letztlich noch in dieselbe Richtung, da Müller sehr wohl für den Minnesang vor Neidhart die Vorstellung einer der adligen Hofgesellschaft normative Werte vermittelnden Ritualform beibehält.20 Gegen diese funktionsgeschichtlichen Vorstellungen haben sich aber MARK CHINCA21, THOMAS CRAMER22 und FRANK WILLAERT23 gewendet, die die These vom höfischen Fest als dem Ort öffentlicher und zeremonieller Aufführungen von Minnesang, da keine historischen Belege dafür zu finden sind, als ein mögliches Forschungsphantasma in Zweifel gezogen haben.24 Ferner hat besonders THOMAS CRAMER die Dominanz von anderen Rezeptionsweisen in den literarischen Quellen und handschriftlichem Bildschmuck herausgearbeitet, die eher in Richtung von ‹privaten›25 Gebrauchssituationen im kleinen (bis kleinsten) Kreis26 deuten.27 Im Übrigen sei mit der schriftliterarischen Konzeption, mit einer parallel laufenden Verankerung der Texte in einer Sphäre der Schriftlichkeit und damit der Rezeptionsmöglichkeit einer Lektüre zu rechnen.28 Im Gegensatz zu den Annahmen von der Repräsentationsfunktion und kollektiven Verbindlichkeit des Minnesangs, die diesen – auch aufgrund einer auf den Typ des Werbungslieds eingeengten Wahrnehmung – oft allzu schnell auf eine ethisierende Tendenz und die Verkündigung normativer Wahrheiten reduziert haben29, haben CRAMER und WILLAERT, sowie zuletzt TIMO REUVEKAMP-FELBER ein auf Literarizität abzielendes Minnesang-Bild propagiert, das diesen als artifizielles Spiel für Liebhaber und Kenner einordnet und seine kunstvolle rhetorische Gestaltung, den Reichtum an intertextuellen Bezügen, die Verschiedenartigkeit der Möglichkeiten über Liebe zu sprechen und nicht zuletzt auch die humorvolle Seite dieser Lyrik betont.30 Als von ganz anderen Grundannahmen ausgehende Kritik am herkömmlichen, vom neuzeitlichen Theater abgeleiteten Modell der rollenlyrischen Aufführungsform des Minnesangs haben sich um die Jahrtausendwende die Vorstöße HARALD HAFERLANDS herausgestellt, der die Minnesangforschung mit dem Vorschlag irritiert hat, die Minnesangtexte, da die vielen Aufrichtigkeitsbeteuerungen in diesen ernst zu nehmen seien, wieder ganz wörtlich, d.h. als authentische Gefühlsausdrücke und biographische Äußerungen zu lesen.31 Da auch dieser Versuch einer Rückkehr zu einem expressiv-biographischen Verständnis der Texte, der freilich von einem höheren Reflexionsniveau ausgeht als die an der Erlebnislyrik des Geniezeitalters orientierte Auslegung vergangener Zeiten, letztlich wiederum seinen Ausgangspunkt in der Vortragssituation höfischer Lyrik nimmt und somit Aussagen über eine Dimension der Texte zu machen sucht, die für uns nicht mehr zugänglich ist, erscheint mir der von HAFERLAND vorgeschlagene Weg äußerst problematisch;32 er hat auch in der Forschung – meinem Eindruck nach – wenig sympathisierenden Widerhall gefunden. Einmal abgesehen davon, dass in ihm die Gefahr besteht, Angaben in den Texten in ihrer literarischen Stilisierung und ihrer Funktion für den Text zu missachten33 und die zu Recht getroffene Unterscheidung von Text-Ich und dem Verfasser als biologischem Individuum einzuebnen; es ist m.E. bei einem in seinen Grundkonstellationen so stabilen Textkorpus mit einem relativ begrenzten Arsenal an Motiven und einer Vielzahl an intertextuellen Bezügen evident, dass Texte sich in viel stärkerem Maße auf andere Texte beziehen als auf lebensweltlich-biographische Vorkommnisse. Und schließlich scheint mir auch die Forschungsdiskussion der letzten Jahre vielversprechende Ansätze zu bieten, die in eine gänzlich gegenteilige Richtung weisen, nämlich die eben auch grundsätzlich in der Gattung angelegte Mehrstimmigkeit oder ‹Dialogizität› des Sprechens, die nicht bloß als Resultat ihrer Aufführungsbasiertheit, sondern als konzeptionell angelegt zu verstehen ist34, die Aufgeladenheit der Texte im Sinne einer diskursiven Vernetzung und Abspreizung der Texte35, die sie als tief in ein kulturelles Bedeutungsgeflecht eingebunden erkennbar macht36, und zuletzt: die mit möglichst neutralem Begriffsinventar – etwa dem der strukturalistischen Erzähltheorie37 – zu erfassende Technizität und Rhetorizität von Bedeutungsgenerierung.38
Auch die mittlerweile in ihrer Brisanz etwas entschärfte Debatte um die mediale und kommunikationspragmatische Fundierung des Minnesangs, scheint es, obwohl die Frage nach den die Gattungscharakteristika prägenden Realisationsgegebenheiten dieser Lyrik immer noch bei bestimmten Diagnosen eine bedeutende, wenn auch verdecktere Rolle spielt39Gottfried von NeifenKLD 15, VIKonrad von WürzburgLied 26 (Schröder), zuzulassen, sich auf die folgende Grundhaltung zurückzuziehen: Grundsätzlich ist mithin weder eine performativ ausgerichtete Vortragsrealisation, noch eine – sich möglicherweise schon früh abzeichnende – schriftgebundene Rezeptionsweise auszuschließen.40 Ja es fragt sich überhaupt, ob eine der beiden Varianten überhaupt ausgeschlossen werden soll – immerhin dürfte damit doch eher das Bewusstsein für die grundsätzliche Bandbreite der möglichen ästhetischen Dimensionen dieser Lyrik (Rhetorische Argumentationskunst, Ohrenkunst, Augenkunst41 etc.) erweitert werden, da sonst ein Erkenntnisverlust droht. Allerdings – selbst wenn sich diese Untersuchung damit dem Vorwurf einer allzu bequemen Haltung gegenüber der Überlieferungslage des Minnesangs aussetzen muss42 – scheint mir im Umgang mit dem Minnesang vor allem eines wichtig: Die Texte in ihrer überlieferten – und das heißt dezidiert buchliterarischen – Form erst einmal ernst zu nehmen und auf reduktionistische Festschreibungen43 der nicht mitüberlieferten Dimension von musikalischer und performativer Umsetzung, gerade wenn jene Konkretisierungen noch auf einen defizitären Status des Schrifttextes zielen, zu verzichten.