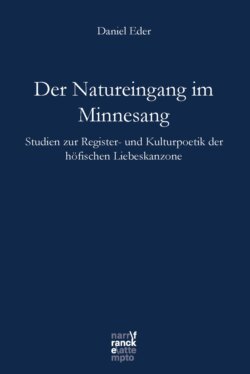Читать книгу Der Natureingang im Minnesang - Daniel Eder - Страница 5
Einleitung
ОглавлениеDass eine Arbeit, die sich für den Minnesang mit dem Problemfeld der forschungsgeschichtlich unter dem Namen ‹Natureingang›1 prominent gewordenen Einleitungstechnik beschäftigt, mit einem Blick auf das Neidhart-Œuvre beginnt, dürfte selbst für den oberflächlichen Kenner der mittelhochdeutschen Lyrik keine allzu große Überraschung sein. Denn es ist wohl hinlänglich bekannt, dass diese Form des Liedbeginns für dieses Corpus und die an es anschließende, mehr und mehr eigenwertig aus dem engeren Bereich des Minnesangs herausweisende Neidhart-Tradition, die im Laufe der Zeit sogar die Gattungsgrenzen der Lyrik zum Spiel und Schwankroman hin überschreitet2, nicht nur besonders beliebt und quasi als ‹Markenzeichen›3 eingesetzt, sondern zum anderen oft breit und kunstvoll ausstaffiert ist.4 In ihr kommt es gerade für den Sommereingang, wenn auch nicht zum ersten Mal, so doch in wohl bisher ungekannter Radikalität zur Motivverknüpfung mit Tanzaufrufen bzw. vom Ich mauerschauhaft eingespeisten Reigenimaginationen, der Wendung an die jungen Leute, sich an der allgemeinen Jahreszeitenfreude zu beteiligen, aber auch zur Erschließung ganz neuer, fernab von der Naturthematik liegender Bildbereiche im Sinne einer ungewöhnlichen Metaphorisierung.5 Dem steht für den Bereich des Wintereingangs etwa die gesteigerte Drastizität eines durch Personifizierung belebten Jahreszeitenkampfes, der nicht nur den Blick auf die mittellateinische Streitliteratur6, sondern eben auch auf die politisch-gesellschaftsthematisch Konflikt-Registratur der Sangspruchdichtung öffnet, gegenüber.7 Und schließlich ist darüber hinaus – darauf wird noch näher einzugehen sein – der Natureingang selbst zum Generator der bestimmenden typenbildenden Distinktion des Lied-Œuvres mit ihren beiden poetologisch grundsätzlich disparat eingerichteten Liedformen Sommer- und Winterlied geworden.8
Das alles mag nun sehr danach klingen, als solle hier einer Aussonderung des Neidhartschen Natureingangs aus dem Corpus des hier zu untersuchenden Feldes – der Einsatz dieser Topik9 im Minnesang – das Wort geredet und dieser der weiteren Einzeluntersuchung anempfohlen werden. Im Gegenteil: Der Verfasser vorliegender Arbeit ist – anders als dies die jüngst erschienende Forschung suggerieren mag10 – zutiefst überzeugt, dass auch und gerade der Natureingang in der Neidhart-Tradition nur im Rahmen des poetischen Systems ‹Minnesang› adäquat zu verstehen ist. Einmal abgesehen davon, dass gerade der Neidhartsche Natureingang im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts auch stark auf das traditionelle Register des Werbungsliedes zurückwirkt und sich so wiederum eine enge Bezogenheit zwischen diesen beiden Bereichen herstellt11, ist es auch gar nicht so, dass sich bestimmte Muster des vor Neidhart im Werbungslied etablierten Natureingang-Einsatzes nicht in der Neidhart-Tradition weiter fortpflanzten. Das kann man z.B. gerade dort ablesen, wo der ‹Natureingang› einmal ausbleibt. In Neidharts WL 22/SNE I: R 5NeidhartWL 22/SNE I: R 512 nämlich, ist – zumindest in der R-Fassung13 – ausgerechnet kein Wintereingang realisiert, so dass das Text-Ich nun in der zweiten Strophe ‹gespielt› entschuldigend und – bei der sonstigen Verve der den Liedeingang bildenden Sommerfreude bzw. Winterklage – wohl doch ironisierend anfügt:
| II(R) | Sumer unde windersint mir doch geliche lanch,swi ez unterscheiden si.dise rede lat ir iu zeloesen ane strit.niemen ist so chinder,tůt im iemen leiden wanch,im enchan der blůmen schintrouren niht erwenden, er ensen sih ze aller zit.also han ich mich gesentnah der lieben lange her,sit daz ich den muet an si gewent.nu ist vrag, wes ich tumber ger. |
[Sommer und Winter
erscheinen mir doch gleich lang,
obwohl man sie schon unterscheiden kann.
Diese Behauptung lasst euch ohne Widerspruch auflösen.
Keiner ist so einfältig, dass,
wenn an ihm jemand eine böse Wendung vollführt,
ihm der Glanz der Blumen
die Traurigkeit abwenden kann, so dass er sich nicht zu jeder Zeit vor Liebe verzehrt.
Gleichermaßen habe ich mich
nun lange nach der Lieben verzehrt,
seitdem ich das Herz mit ihr vertraut machte.
Jetzt ist die Frage, was ich Törichter eigentlich begehre.]
Die Technik ist bekannt. Denn zumindest seit Reinmars berühmten Diktum ich hân mêr ze tuonne denne bluomen klagen (I,6) aus Lied MF 166,9ReinmarMF 166,914 ist es für den Minnesang breit etabliertes Gestaltungsmittel, dass das Text-Ich auch einmal die poetische Möglichkeit realisiert, für sich den ‹Natureingang› – hier unterlegt als Konzept einer Beglückungswirkung der sommerlichen Natur – als denkbare Deutung von ‹Welt› völlig zu negieren. Mit dieser ‹Ablehnung der Geltung› der Topik15, die freilich selbst längst schon topisch geworden ist, gibt das Lied aber sozusagen aus der ‹Gegenperspektive› den Blick frei auf das, was eigentlich das dominante Ziel des Gestaltungsmittels im Gattungskontext des Werbungsliedes darstellt, nämlich die Herausarbeitung eines Ichs und seines emotionalen Innenraums. Denn mit der flapsigen Bemerkung, niemand sei so naiv zu denken, dass Liebeskummer durch das Einsetzen des Sommers mit seiner Blumenpracht zu heilen sei (vgl. II, 5–8), wird für das Ich ein Sonderbereich des Denkens und Fühlens, die Liebe, aufgespannt, die gerade – im Sinne einer durativen «Eigenzeit der Minne»16 – dem saisonalen Wandel und seinem stimmungsbezogenen Einfluss nicht unterworfen ist (vgl. also han ich mich gesent / nah der lieben lange her, / sit daz ich den muet an si gewent [II,9–11]; Hervorhebung von mir, D.E.). Diese argumentative Einbindung und Auswertung des Natureingangs aber, die im Ganzen eher typisch für den traditionellen Kontext des Werbungsliedes ist, denn dass sie tatsächlich irritierte, ist es, die hier besonderen Aufschluss über die Funktion der Topik für den Liedzusammenhang verspricht und damit die entscheidende Schaltstelle einer interpretativen Ausdeutung bildet. Und diese über den Einbau einer eigentlichen Fremdthematik sichtbar werdenden neuralgischen Punkte in der argumentativen Tektonik des Werbungsliedes sind es auch, die die vorliegende Untersuchung über eine genaue Auswertung des Natureingangs-Einsatzes in der Minnesangtradition aufsuchen will, um so neue Anregungen für eine Profilierung der Poetik des Werbungsliedes selbst zu gewinnen – was damit also weniger im Fokus dieser Arbeit steht, sind die spezifischen Erscheinungsweisen, oder gar: ‹Erfahrungswelten› von ‹Natur› im Mittelalter selbst oder bestimmte Einzelmotive der Natur- und Jahreszeitenthematik. Sumer unde winder / sint mir doch geliche lanch (II,1f.) – das könnte also auch paradigmatisch für die hier gewählte Herangehensweise an den Untersuchungsgegenstand gelten, die sich eben genau nicht einem besonderen Erkenntnisinteresse dem Bereich des ‹Naturalen›, gar verstanden als Kristallisationspunkt einer weltbezogenen ‹Erfahrung›, gegenüber verdankt, sondern der spezifischen Funktionsweise des literarischen Genres ‹Werbungslied›, und zwar dort, wo sie – aufgrund der thematischen Disparität des Einzubindenden – m.E. besonders klar zu Tage tritt, nämlich an der Schaltstelle der liebesthematischen Auswertung von Natur- und Jahreszeitentopik.
Innerhalb deren verschiedener Gestaltungsmittel, die im Folgenden für den Minnesang mit locus amoenus-Darstellung, Jahreszeiteneingang, Natur- und Jahreszeitenstrophe zu diskutieren und vom ‹saisonalen organisierten Natureingang› als einem spezifischen Modus der Realisation dieser Topik am Liedanfang abzugrenzen sind, wird dabei nach einigen einleitenden Worten zur Einordnung der Untersuchung in die Minnesangforschung (I.1) und zum in der Arbeit zur Anwendung kommenden Registerbegriff (I.2), sowie einem ausführlichen Forschungsbericht zum Thema, der auch einer Auseinandersetzung mit dem zugrundegelegten Topos-Konzept dienen soll (I.3), versucht werden, zu einer sinnvollen Konturierung des Terminus technicus ‹Natureingang› für den Minnesang zu gelangen (II). Dabei steht es freilich bei allem definitorischen Zuschnitt der Ausführungen gerade nicht im Interesse dieser Arbeit, den ‹wahren› Kern des Topos, verstanden als dessen tatsächlich ‹existentes› Substrat – dieses ‹gibt› es mithin so sehr (und so wenig) wie ‹die Novelle› und überhaupt alle Klassifikationssysteme unserer Disziplin! –, aufzufinden, sondern im Gegenteil, den in vielem nicht unproblematischen, aber eben doch forschungsgeschichtlich etablierten wie offenbar sehr eingängigen interpretationstechnischen Begriff erst dahingehend zu modifizieren, dass er überhaupt sinnvollerweise weiterverwendet werden kann.
In einem daran ansetzenden Arbeitschritt soll daraufhin das Unterfangen einer Binnentypologisierung des Topos ‹Natureingang› entwickelt und diskutiert werden (III), wobei zwar ein eigener – hoffentlich hinreichend offener und als hilfreiches Arbeitsinstrument pragmatisch anwendbarer – Entwurf einer Typenspezifizierung vorgestellt wird, aber auch verschiedene mögliche Unterscheidungskriterien abgeschritten und problematisiert werden sollen.
Damit ist in der folgenden Untersuchung sicherlich eher ein systematischer, denn streng diachron-historisch fortschreitender methodischer Zugang an das Thema gewählt, der die vielfältigen möglichen Erscheinungsformen der Topik im Rahmen der fast zweihundert Jahre andauernden Minnesangtradition – bei aller Disparität von deren Ausfaltungen – dennoch unter einem übergreifenden Blickwinkel zu betrachten sucht. Dies mag mit Sicherheit auch einige Schwachstellen im Zuschnitt der Arbeit mit sich bringen, z.B. dass einige höchst interessante literarische Realisationsweisen des ‹Natureingangs› nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie mithin verdient hätten; er scheint mir jedoch deshalb geboten, um die Konstanten und das stabil bleibende Gemeinsame in der Funktion des Topos für das Werbungslied besser profilieren zu können. Gleichwohl wird es einige Nebenwege und Exkurse abzuschreiten gelten, die sich immer wieder im Verlauf der Untersuchung dem Verfasser geradezu aufgedrängt haben, aber anzeigen mögen, wie sich aus scheinbaren Einzelerscheinungen die Notwendigkeit zu ganz grundsätzlichen Fragestellungen für die Gattung ergibt, und an deren Ende hoffentlich ein noch weiter differenziertes Bild davon steht, was hier etwas vollmundig angekündigt worden ist: der Poetik der Minnekanzone. Dass dabei dann am Ende der Arbeit die hierbei gemachten Beobachtungen vor dem Hintergrund eines erweiterten, kulturgeschichtlich geöffneten Blickes noch einmal weiter zugespitzt werden können (IV), zeigt mithin noch einmal mit Nachdruck die perspektivenreiche Ambiguität des Topos-Begriffs selbst zwischen rhetorischem Instrument der Argumentationsgewinnung17, der Bildung von Verständnishorizonten über literarische Muster und einer Speicherfunktion soziokultureller Überzeugungen – und eben der Anreizstiftung, ihm immer wieder eine ‹neue› Seite abzugewinnen.18