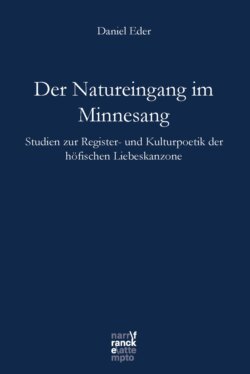Читать книгу Der Natureingang im Minnesang - Daniel Eder - Страница 8
3 Der Natureingang in der Minnesangphilologie
ОглавлениеVorher gilt es jedoch abzuklären, was im Zusammenhang dieser Arbeit mit dem Terminus ‹Natureingang› eigentlich genau gemeint sein soll. Dies mag vielleicht insofern irritierend klingen, als es mittlerweile eine ansehnliche Zahl von Forschungsarbeiten und Aufsätzen gibt, die sich mehr oder weniger ausführlich mit dem ‹Natureingang› im deutschen Minnesang beschäftigen. Dennoch hat sich bisher – gemessen an dieser Breite der Anstrengung – nur ein recht diffuses Bild über das Vorkommen und die Funktion dieses Eingangstopos im Minnesang abgezeichnet.1 Dies liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Frage, welche Merkmale überhaupt zwingend vorliegen müssen, um bei einem Lied einen Natureingang diagnostizieren zu können, in der Forschung keine übergreifende Lösung gefunden hat. Ja es hat mehrere Beiträge gegeben, die die Bezeichnung selbst in Zweifel ziehen und stattdessen von ‹Jahreszeitenbild› oder ‹Jahreszeitentopos› sprechen.2 Wenn hier also trotzdem am Terminus des ‹Natureingangs› festgehalten wird, der noch dazu in der vom Verfasser im Folgenden vorgeschlagenen Konturierung als ‹jahreszeitlich organisierter Natureingang› einen spezifischen und relativ eng umgrenzten Typus der Eingangsgestaltung im Minnesang umreißen soll, so bedarf dieses Vorgehen zunächst einer Begründung, die nur in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen in der Forschungsliteratur gewonnen werden kann. Dies soll zu einem eigenen Vorschlag einer pragmatisch zu verstehenden Minimaldefinition des hier in den Blick zu nehmenden Topos führen, die phänomenologisch ähnliche, aber nicht in den engeren Bereich des ‹Natureingangs› gehörende Erscheinungsformen der Naturrepräsentation im Minnesang trennscharf auszuscheiden versucht, so dass ein zutreffenderes Bild über das Vorkommen des Topos und seine Bedeutung im deutschen Minnesang überhaupt erst gewonnen werden kann.
Nach der zunächst vornehmlich am ‹Naturgefühl› und ‹Naturerlebnis› der Minnesänger interessierten älteren Forschung3 hat man sich dem Problemfeld des Natureingangs dann nach einiger Zeit auch verstärkt im Hinblick auf stilistische Dimensionen angenähert4, wobei es besonders das Verdienst des 1942 erschienenen Aufsatzes «Rhetorische Naturschilderung im Mittelalter» von ERNST ROBERT CURTIUS5 ist, den Natureingang als einen literarischen Topos ins Bewusstsein gerückt zu haben.6
Obwohl sich CURTIUS› Überlegungen nur am Rande mit dem jahreszeitlich organisierten Natureingang in der mittelalterlichen Liebeslyrik beschäftigen7, weil sie sich vor allem auf die Tradition des sog. locus amoenus konzentrieren, der laut CURTIUS «von der Kaiserzeit bis zum 16. Jahrhundert das Hauptmotiv aller Naturschilderung»8 bilde, ist auf dessen Studien, die auch auf die mit dem Natureingang beschäftigte Minnesangforschung großen Einfluss ausgeübt haben, an dieser Stelle etwas ausführlicher einzugehen. Allerdings kann eine erschöpfende Darlegung und Diskussion des Topos-Begriffs von CURTIUS und des von ihm propagierten methodischen Konzepts einer ‹Historischen Topik›9 sowie ein Überblick über die kritische Auseinandersetzung mit CURTIUS› Thesen in der späteren, interdisziplinären Toposforschung hier nicht gegeben werden.10 Deswegen mögen die folgenden kurzen Bemerkungen genügen: CURTIUS geht in seiner Herleitung des Topos-Begriffs von den vielfältigen Beziehungen zwischen Rhetorik und Poetik seit der Spätantike aus, um jenen aus der Redekunst stammenden Terminus als Analyseinstrument auch für poetische Texte zu etablieren. In der systematisch-normativen Rhetorik ist der Topos dem Vorgang der inventio zuzuordnen und meint im Bereich der ‹künstlichen› Beweiserzeugung des genus iudicale gewisse ‹Orte›, an denen der Redner Beweisgründe (argumenta) für seine Rede auffinden kann;11 nicht unumstritten ist allerdings die Gleichsetzung dieser argumenta mit ihren Fundorten (den Topoi)12 durch CURTIUS, die letztere auch zu einer inhaltlichen Kategorie werden lässt.13 Im mit dem Bedeutungsverlust von Staats- und Gerichtsrede einhergehenden Vorgang einer Rhetorisierung der Dichtkunst gewinnen jedenfalls diese rhetorischen Muster eine neue Bedeutung, so CURTIUS: «Sie werden literarische Klischees, die allgemein verwendbar sind»14, die, wobei es in der Spätantike sogar zur Bildung neuer Topoi komme, über das gesamte Mittelalter hinweg – etwa durch die Vermittlung über die mittellateinische Poetik15 – in der Literatur produktiv blieben, bisweilen darüber hinaus.16
Was die verschiedenen Formen der literarischen Repräsentation von ‹Natur› im Mittelalter im Speziellen betrifft, deren Zugehörigkeit zu solchen topischen Traditionen CURTIUS herauszuarbeiten versucht, sind folgende Aspekte hervorzuheben: CURTIUS wendet sich nicht nur einerseits gegen die Ansicht, dass ‹Naturschilderungen› in der mittelalterlichen Literatur als ‹Wirklichkeitswiedergabe› gedacht seien17, sondern andererseits auch gegen die Auffassung, aus ihnen sei ein spezifisches ‹Naturgefühl› abzuleiten.18 Stattdessen betont er deren rhetorische Basierung in den topischen Traditionen von Gerichts- und Lobrede und die Tatsache, dass sie aus der Anwendung einer literarischen Technik resultieren.19 Denn gerade vor dem Hintergrund der Übertragung des Fragenkatalogs zur Findung von Beweisgründen aus der normativen Rhetorik auf die literarische descriptio in der mittelalterlichen Poetik20, sei es beispielsweise durchaus gerechtfertigt, den Motivkomplex des locus amoenus der rhetorischen Kategorie des argumentum a loco zuzuordnen, ja der (jahreszeitliche) Natureingang der Lyrik sei eventuell dem argumentum a tempore zugehörig.21 Dies beweise, dass es sich bei ihnen um zwei eigentlich voneinander unabhängige Typen topischer ‹Naturschilderung› handle.22 Auf diese – m.E. völlig zutreffende – Diagnose wird im Folgenden, wenn es um die Abgrenzung des jahreszeitlich organisierten Natureingangs als konzisem Typ der Eingangsgestaltung im Minnesang geht, noch zurückzukommen sein. Schließlich bleibt zu bemerken, dass, auch wenn an Hintergrund, Herleitung und Konzeption des Topos-Begriffs von CURTIUS – nicht nur von Seiten der spezialisierten Toposforschung – kritische Einwände geäußert worden sind, es als Leistung von dessen Studien angesehen werden muss, dass auch der Natureingang des Minnesangs von der Forschung als topisches Element erkannt worden ist23 und so vor allem dessen rhetorische Dimension – verstanden als eine hinsichtlich einer Wirkungsabsicht geformte Sprachlichkeit von Texten24 – immer mehr in den Fokus gerückt ist.25
Ferner ist – neben ersten Ansätzen einer (tendenziellen) Neubewertung des Natureingangs in der älteren Forschung und der Toposforschung von CURTIUS – noch ein dritter Zweig der Bestrebungen, die in der Forschung einen Paradigmenwechsel für die Betrachtung des Natureingangs angeregt haben, zu nennen, denn auch die schon mehrfach angesprochene Studie «Minnesangs Wende» von HUGO KUHN hat für die Erforschung des Natureingangs im Minnesang in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedeutende Impulse gegeben, obwohl in ihr die Thematik ebenfalls nur kurz behandelt wird.26 KUHN bezweifelt in seiner Darstellung sogar, dass es bei den Natureingängen im Minnesang überhaupt um ‹Naturschilderung›27 gehe, und erfasst diesen Einleitungstyp allein über dessen symbolische Verweisfunktion, die Objektivierung der für die Liebesthematik so zentralen Dialektik von vröide und leit, die durch eine Anbindung der gesellschaftlichen Haltung an die Naturvorgänge erfolgt.28 Insofern tragen die Überlegungen KUHNS zur symbolischen Verweisfunktion des Natureingangs ebenfalls wesentlich dazu bei, dass dieser als Bestandteil einer textlichen Konstruktion erkennbar wird und die Frage nach dessen funktionaler Leistung für den literarischen Text in den Mittelpunkt rückt.
An KUHNS Überlegungen schließt sich die Untersuchung von BARBARA VON WULFFEN aus dem Jahr 1963 an, die als grundlegend zu nennen ist, da sie sich erstmals um eine Systematisierung der einzelnen Erscheinungsformen des Motivkomplexes bemüht.29 Dennoch fällt die Arbeit aber in ihrem Verständnis des Natureingangs eigentlich hinter den bereits erreichten Stand der Forschung zurück: So würdigt VON WULFFEN beispielsweise den methodischen Ansatz von CURTIUS zwar als «Bereicherung jeder neueren Forschung, gleichgültig, welches ihr Anliegen sein mag»30, suspendiert ihn aber gleichzeitig als Ausgangspunkt ihrer eigenen Darstellung.31 Ja der Natureingang im Minnesang sei, so VON WULFFEN, nicht als Topos aufzufassen:
Seine [=Curtius’] Vermutung […], der Natureingang gehöre zum «argumentum a tempore», so wie der «locus amoenus» zum «argumentum a loco» der aristotelischen Lehre vom Beweis, wie sie die lateinische Rhetorik für die Gerichtsrede empfiehlt, trifft nicht das Wesen des Natureingangs, der als übergeordnete Gestalteinheit inhaltlich nicht auf irgendeinen Topos, hier Beschreibung von Jahreszeiten, festgelegt werden kann. Er kann alle möglichen Topoi zum Inhalt haben, ohne selbst ein solcher zu sein.32
Schon in dieser Äußerung deutet sich an, dass VON WULFFEN für den Natureingang in ihrer Studie ein sehr viel weiter gefasstes Verständnis unterlegt als die vorliegende Untersuchung, die sich einem ganz bestimmten Typ der Eingangsgestaltung widmet, der sehr wohl strikt an den jahreszeitlichen Wandel gebunden ist.33Wolfram von EschenbachMFMT XXIV, Nr. IIWalther von der VogelweideL 39,11 Auch erachtet VON WULFFEN ferner weder die Anfangsstellung des Natureingangs im Lied als notwendig, noch seine wirkliche Durchführung im Lied, und gibt so folgende recht wenig brauchbare Definition:
«Natureingang» muß daher im Folgenden nicht wie bisher üblich als eine poetische Gewohnheit, eine Art Einleitungsform verstanden werden, sondern als lebendiges selbständiges Gebilde, das keineswegs an den Beginn eines Liedes gebunden sein muß – obwohl es in der Hauptsache dort vorkommt. […] Es kann verschiedene Stufen von sprachlicher Abstraktion durchmachen – aber immer bleibt jenes Ding «Natureingang» irgendwie lebendig.34
Zunächst einmal muss heute das organizistische Denken, das VON WULFFEN einer rein auf literarische Techniken zielenden Betrachtungsweise des Phänomens vorzieht, Skepsis hervorrufen. Gerade die Vorstellung von einem ‹lebendigen Ding› Natureingang, das gleichsam ‹hinter› den poetischen Konkretionen als existente Wesenheit imaginiert wird, führt aber wohl bei VON WULFFEN überhaupt erst zu der sehr unpräzisen Eingrenzung. Da sie den Natureingang also nicht an seine Anfangsstellung im Lied bindet35 und Realisationsformen von derart weit gehender Abstraktheit annimmt, dass selbst die bloße Nennung einer Jahreszeit im Lied sie von einem Natureingang sprechen lässt,36 geraten so viele eigentlich nicht zugehörige Erscheinungen mit in den Blick, die in der Gesamtschau das Bild vom Vorkommen des eng zu umgrenzenden Typs ‹Natureingang› im deutschen Minnesang eher verschwimmen lassen.37 Deshalb scheint es durchaus sinnvoll zu sein, den literarischen Topos des Natureingangs ausschließlich als eine poetische Möglichkeit der Anfangsgestaltung zu betrachten, ihn andererseits aber auch auf seine tatsächliche Durchführung im Lied mittels Aufrufung von durch den jahreszeitlichen Wandel ausgelösten, zeichenhaften Naturdetails zu verpflichten. Dabei soll hier nicht in Abrede gestellt werden, dass durch Bezugnahme auf durch Jahreszeitenwandel hervorgerufene Naturerscheinungen im Liedinneren oder bloße Jahreszeitennennung konnotativ auf den literarischen Topos des Natureingangs angespielt werden kann; als wirkliche Realisationsformen einer spezifischen poetischen Technik der Eingangsfindung sind solche Fälle aber dennoch nicht in den Blick zu nehmen.
An den viel zu unscharfen Erfassungskriterien VON WULFFENS übt 1979 schließlich auch WOLFGANG ADAM zu Recht Kritik,38 der den Natureingang selbst als «das ein Lied eröffnende Jahreszeitenbild»39 definiert. Sehr hilfreich sind auch die weiteren Ausführungen ADAMS, die sich damit beschäftigen, in welchen Fällen die Verwendung des Terminus ‹Natureingang› überhaupt sinnvoll ist: «Zunächst müssen einige […] Wirklichkeitsmerkmale vorhanden sein, die eine bestimmte Zeit des Jahres ankündigen. Zum zweiten ist die Position des Naturbildes genau markiert: der Liedanfang»40. Es muss an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob der Terminus des ‹Wirklichkeitsmerkmals› besonders günstig ist; dennoch ist hervorzuheben: Mit ADAMS Diktum sind die drei zentralen Aspekte benannt, die einer Minimaldefinition des jahreszeitlich organisierten Natureingangs, wie sie im Folgenden noch genauer zu entwickeln ist, m.E. zugrunde gelegt werden müssen: Eingangsstellung im Lied, Bezugnahme auf eine Jahreszeit bzw. auf den Wandel der Jahreszeit, und schließlich die Aufrufung von Naturdetails, an denen diese saisonale Ausrichtung vorgeführt wird. Es ist ferner aber auch festzuhalten, dass gerade ADAMS grundsätzliche Überlegungen zum Typ des jahreszeitlich geprägten Natureingangs, die sich für die vorliegende Untersuchung als in gewinnbringender Weise anschlussfähig erweisen werden, als eine besondere Leistung der Studie noch nicht ausreichend gewürdigt worden und daher in der Forschung relativ wirkungslos geblieben sind.41Hadloub, JohannesSMS 30,21Hadloub, JohannesSMS 30,47
An dieser Stelle muss der Vollständigkeit halber – durchaus auch im chronologischen Rückgriff – noch auf einige weitere Arbeiten zum Natureingang im Minnesang kurz eingegangen werden, die bedeutsame Beiträge in der Behandlung des Untersuchungsgegenstandes darstellen, aber bei der hier gewählten Akzentuierung des Forschungsberichts nicht als eigenständige Stationen aufzuführen waren, da sie sich mit der Unterlegung einer adäquaten Definition für jenen Typ der Exordialgestaltung nur am Rande beschäftigen. Dennoch finden sich in ihnen wichtige Überlegungen zum Status des Natureingangs im Spannungsfeld von Wirklichkeitsrezeption, Rhetorizität und literarischer Valenz sowie weitere Vorschläge zu einer Typologie desselben, so dass sie hier überblicksartig behandelt werden sollen.
Bereits 1964 hat ANTHONIUS H. TOUBER in seiner vornehmlich mit den Liedern Gottfrieds von Neifen beschäftigten Studie «Rhetorik und Form» den Natureingang als topisches Element des deutschen Minnesangs behandelt, wobei er vergleichend auch andere europäische Liebeslyriktraditionen des Mittelalters in den Blick nimmt.42 TOUBER betont in diesem Zusammenhang zwar, dass es zur Klärung der Funktion von Naturrepräsentationen im Minnesang ratsam sei, besonders die Verbindung zwischen Natureingang und der Liebesthematik in den Liedern näher zu betrachten,43 konstatiert bei Gottfried aber vorschnell, dass der Natureingang dort «wie ein beziehungsloser, isolierter Block, sprachlich unintegriert am Anfang des Liedes»44 stehe; dies sei jedoch durch die Tradition des Natureingangs im deutschen Minnesang schon vorgezeichnet, der nämlich zwei Typen bezüglich der Behandlung der Naturthematik aufweise: bei der ersten Gruppe von Liedern sei der Natureingang blockhaft und ohne weitere Beziehungen an den Anfang gesetzt (Hauptvertreter: Heinrich von Veldeke, Gottfried von Neifen), bei der zweiten (v.a. Walther, Neidhart) spiele die Naturthematik auch im weiteren Verlauf eine bedeutende Rolle und sei mit dem Inhalt quasi organisch verwoben.45 Diese Gruppeneinteilung TOUBERS ist insofern als problematisch anzusehen, als einerseits durch sie beim Gros der Natureingänge im Minnesang (Gruppe 1) durch die vorschnelle Klassifizierung der Eingangsgestaltung als blockhaft-isoliert die tatsächlich bestehenden Verbindungen zwischen Natur- und Liebesthematik gekappt werden, so dass die Funktion solcher Passagen genau nicht geklärt wird; andererseits ist im Falle der Gruppe 2 – TOUBER gibt hier bezeichnenderweise WaltherWalther von der VogelweideL 39,11s berühmtes ‹Lindenlied› L 39,11 als Beispiel an46, das im Folgenden in Abgrenzung zu dem hier umrissenen Typ des jahreszeitlichen Natureingangs noch genauer betrachtet wird – zu fragen, ob bei solchen Spezialfällen die Bezeichnung ‹Natureingang› überhaupt noch adäquat ist. Für eine Typologie des Natureingangs scheint die Einteilung TOUBERS jedenfalls, auch aufgrund ihrer Abhängigkeit von neuzeitlichen ästhetischen Wertungskriterien wie dem der Kohärenzbildung, nicht zu taugen.
Ferner ist an dieser Stelle auch noch auf einen schon 1969 publizierten Aufsatz WOLFGANG MOHRS zu verweisen, in dem dieser für die Sommer- und Frühlingseingänge besonders auf naturhafte Erotizität zielende konnotative Anhaftungen vermutet.47 Fraglich ist aber vor allem, ob mit der von MOHR vorgeschlagenen Sichtweise vor dem Hintergrund einer Partizipation an einer allgemeinmenschlichen Erfahrung des Idyllischen, die sich als ‹welthistorische Konstante› im ‹Motiv des Ländlichen› materialisiere, das für die «Suche nach dem a-sozialen Ort der menschlichen Freiheit»48 stehe, den Natureingängen im Minnesang, deren topischen und typischen Charakter er durchaus anerkennt49, generell beizukommen ist.50 Schließlich wird auch die Behauptung MOHRS, dass in der mittelalterlichen Lieddichtung besonders der noch heute vertraut erscheinende «Einklang des menschlichen Lebensgefühls mit der lebendigen Natur»51 auffalle, so dass Liebesfreude zum Frühling gehöre, während der Winter die Zeit der Entbehrung und Liebesklage sei,52 zu Widerspruch herausfordern, da sie der im Minnesang zu findenden Variationsbreite möglicher Bezüge zwischen Natureingang und der in der Ich-Rede präsentierten Liebesthematik nicht im Ansatz gerecht wird;53 diese Verbindungsmöglichkeiten zu klassifizieren, wird sich im Folgenden als wichtige Aufgabe einer Typologie des Natureingangs erweisen.
1982 hat sich auch VIOLA BOLDUAN in ihrer mit dem späten Schweizer Minnesang beschäftigten Studie «Minne zwischen Ideal und Wirklichkeit» ausführlich mit dem Natureingang in der Minnesang-Tradition befasst54, um in diesem Zusammenhang anhand der Spätzeugnisse aus dem Schweizer Raum zu klären, «ob und inwieweit sich die in bisheriger Forschung betonte Tendenz der Spätzeit zum Konkreteren, Realistischen, Individuelleren feststellen»55 lasse. Dieses Frageinteresse führt nun bezeichnenderweise – in Widerspruch zu den Überlegungen BRINKMANNS, CURTIUS› und KUHNS – zur Restituierung der Kategorie des ‹Real-Erlebbaren› für die ästhetische Bewertung des Natureingangs durch BOLDUAN.56 Betrachtet man ferner das Verständnis, das die Verfasserin für das Gestaltungselement des Natureingangs unterlegt, so fällt auf, dass sie im Wesentlichen die Typeneinteilung und Definition VON WULFFENS übernimmt, weshalb auch sie den Natureingang im Minnesang nicht an seine Anfangsstellung im Lied bindet.57
Wie schon bei MOHR und BOLDUAN erweist sich die Rückgewinnung der Kategorie der Wirklichkeitsbezogenheit für den Umgang mit dem Natureingang in der Literaturwissenschaft als zentrales Interesse der 1984 veröffentlichten Studie JUTTA GOHEENS, die sich ebenfalls recht ausführlich mit Naturrepräsentationen im Minnesang beschäftigt.58 Dabei geht es GOHEEN vorrangig um eine Korrektur zentraler Ergebnisse der Toposforschungen von CURTIUS; dies betrifft nicht nur den Topos-Begriff selbst59, sondern auch die Fragen nach der Dominanz des locus amoenus in der mittelalterlichen Literatur60 und dem Zusammenhang zwischen den mittellateinischen Poetiken und den lyrischen Erzeugnissen der Volkssprache in der Behandlung der Naturthematik.61 Die Feststellung einer nur partiellen Applizierbarkeit des Toposbegriffs auf die Naturrepräsentationen in der mittelalterlichen volkssprachlichen Lyrik62 ist m.E. jedoch zu deutlich vom problematischen Ansatz GOHEENS bestimmt, eine Restituierung der Kategorie der dichterischen Individualität in Naturperzeption und Jahreszeitempfinden einzuleiten, so dass die Leistungen von CURTIUS› auf Rhetorizität zielendem Konzept für die angesichts mittelalterlicher Literatur recht fragwürdigen ästhetischen Paradigmen geniezeitlich-romantischer Prägung aufgegeben werden.63
In der Folgezeit erweisen sich für die weitere Entwicklung der einschlägigen Forschung besonders zwei Aspekte als zentral: Dies ist zunächst die schon erwähnte, im Großteil der Forschung zu bemerkende Aufgabe des Begriffs ‹Natureingang› zugunsten von Termini wie ‹Jahreszeiteneingang› / ‹Jahreszeitentopos› / ‹Jahreszeitenlied› etc.64, die nicht nur verstärkt auf den dominanten saisonalen Bezug der Naturrepräsentationen im Minnesang aufmerksam machen, sondern auch dem Unbehagen an der mit der Bezeichnung ‹Natureingang› verbundenen Fortschreibung von geniezeitlich-romantischen ästhetischen Paradigmen entspringen65, ja schließlich der Skepsis, ob das (volkssprachliche) Mittelalter überhaupt ein der heute hauptsächlichen Sinnunterlegung vergleichbares Verständnis des Wortes ‹Natur› hat.66Rudolf von FenisMF 82,26SteinmarSMS 26,13Heinrich von MorungenMF 125,19
Im Zusammenhang mit der Debatte um die Bezeichnungen ‹Natureingang›/‹Jahreszeiteneingang› muss hier m.E. zwingend auch auf die dichtungstheoretisch-normative Vorschaltung eingegangen werden, die die Göttinger Mügeln-Handschrift g67 zum 16. Buch, dem der Liebeslieder, vornimmt, und auf deren Bedeutsamkeit für die Forschungsdiskussion zum Natureingang SUSANNE KÖBELE aufmerksam gemacht hat.68 Diese Überschrift lautet nämlich:
Hie wil der meister leren, wie alle vorrede gegen dem Meyen, gegen dem Somer, gegen dem wintter setzen vnd blumen sal, wer von der mynne tichtet69.
[Hier möchte der Meister zur Anschauung bringen, wie der, der von der Liebe dichtet, jeden Prolog auf den Mai, auf den Sommer oder auf den Winter hin anlegen und schmücken soll70].
Die Forschung hat nun dieses ‹Programm› der Liedgruppe in der Handschrift g, das zumindest auf der Ebene der handschriftlichen Präsentation die grundsätzliche Organisation der acht Lieder Heinrichs von Mügeln nach dem Jahreszeitenprinzip propagiert, nicht nur im Hinblick auf ihre poetologische Dimensionierung als ‹Dichtungsanleitung› mit Stilempfehlung (blumen) untersucht71, sondern auch – sicher mit Recht – auf jenen Topos bezogen, der in der Minnesang-Forschung unter der Bezeichnung ‹Natureingang› bekannt geworden ist.72 Diese Identifizierung ist nun nicht nur deswegen naheliegend, weil im obigen Zitat die zwingende Anfangsstellung (vorrede) und grundlegende Bedeutung der Jahreszeitenausrichtung (Meye, Somer, wintter) für die in Frage kommende Topik betont wird – beides ist schon als zentrales Kriterium des hier zu konturierenden Typus eines saisonal organisierten Natureingangs angesprochen worden –, sondern auch, weil im auf diese Überschrift folgenden Block von acht Liedern dann tatsächlich vier Lieder mit einem solchen Natureingang gesetzt sind (Lied IHeinrich von MügelnLied I–VI-III und VI).73 Dieser Zusammenhang wird zudem im Falle der Lieder II, III und VI durch die in der Handschrift den Liedern jeweils beigegebenen Einzelüberschriften, die mit den Angaben Gegen den Meyen aber also vnd der tzyd des Somers (IIHeinrich von MügelnLied I–VI), Gegen dem winter also (IIIHeinrich von MügelnLied I–VI) und Gegen dem meyen ein clage lidel also (VIHeinrich von MügelnLied VI)74 explizit auf jene Buchüberschrift rückverweisen, noch bestätigt. So haben sowohl BEATE KELLNER, als auch SUSANNE KÖBELE und zuletzt BURGHART WACHINGER diese Überschrift als eine direkte produktionsästhetische Anweisung verstanden, dass jedes Lied, das von der Liebe handle, mit einer vorrede75 in Form eines ‹Natureingangs› zu versehen sei.76 Damit scheint die Aussage aber auch durchaus an die vorausliegende Minnesangtradition zumindest des 13. Jahrhunderts hin anschließbar, wie es etwa KELLNER tut, die betont, dass hier «die Lieder an jene Traditionen des späten Minnesangs gebunden [werden], die mit Gottfried von Neifen, Neidhart, Konrad von Würzburg, Hadlaub u.a. verbindlich geworden sind».77 Diese Perspektivierung der Überschrift auf den engeren Bereich der Minnesangtradition zeigt sich auch bei KÖBELE, die die Passage als Hinweis für die bleibende normative Strahlkraft des ‹Natureingangs› einordnet, der quasi zum Signum des Minnesangs selbst werde, in einer Phase, in der «die Minnesangwelt beinah schon versunken ist, die Attraktivität des Minnesangs so abgesunken ist, daß er hinter der Sangspruchdichtung zu verschwinden beginnt, genauer: die Grenzen zwischen beiden Gattungen fließend werden, man aber doch nicht ganz auf Minnesang verzichten will»78. Ja BURGHART WACHINGER hat die immer wieder als Fehldiagnose des Überschriftenurhebers gewertete Tatsache, dass selbst das sich in der Handschrift anschließende Liedcorpus der angeblichen Radikalität der Forderung nach einem Natureingang für jedes Liebeslied gar nicht nachkomme 79Heinrich von MügelnLied IVHeinrich von MügelnLied I–VIHeinrich von MügelnLied VIIIHeinrich von MügelnLied VII, gerade über die Beliebtheit des Topos in der vorausliegenden Minnesangtradition erklärt: «Die Generalisierung alle vorrede ist selbstverständlich überzogen […]. Aber daß die Generalisierung unterlaufen konnte, ist die Folge einer außerordentlichen Beliebtheit des Natureingangs im Minnelied»80. Damit stellt sich freilich die Frage, inwiefern nun die Aussage der Überschrift aus g tatsächlich Aufschluss über die Konzeption des im Folgenden näher zu bestimmenden Minnesangtopos ‹Natureingang› zu geben vermag. Dass freilich die Akzente jenes in dieser Form ja einzigartigen, gleichwohl aber sehr späten historischen Belegs für eine ausformulierte poetologische Einordnung dieser Topik nun aber nur mit äußerster Vorsicht auf die Minnesangtradition des 12. und 13. Jahrhunderts übertragen werden dürften, versteht sich von selbst; daran nämlich, dass ein solches Vorgehen auf recht problematischen Prämissen beruht, könnte m.E. selbst die Plausibilisierung der Annahme, dass die Überschrift schon vom Autor selbst oder seinem Umfeld im späten 14. Jahrhundert stammen mag, nicht grundsätzlich etwas ändern.81
Darauf, dass das obige Zitat z.B. die zur Erarbeitung einer Definition des Topos ‹Natureingang› bereits angesprochenen Kriterien ‹Anfangsstellung› und ‹Jahreszeitenausrichtung› recht deutlich bestätigen dürfte, habe ich in diesem Zusammenhang schon hingewiesen. Auch scheint mir die auf die Liebesthematik perspektivierte Ausrichtung der vorgeschalteten Naturrepräsentation, die im Folgenden als dominanter Funktionsbereich des Topos zu beschreiben sein wird (s. unten, Kap. III.1), in der Ausführung der Überschrift eingefangen zu sein, die Demonstration kunstvoll eingesetzter Jahreszeiten-vorrede gelte für den besonderen Bereich der Dichtung über die minne.82 Es wäre aber darüber hinaus zu diskutieren, inwiefern etwa die Aufzählung der saisonalen Festlegungen Meye, Somer und wintter in der Lehranweisung für eine Typeneinteilung des Natureingangs zu nutzen wäre. Dies würde allerdings die in der Forschung breit etablierte Grobgliederung in Sommer- und Wintereingänge empfindlich treffen, suggeriert die Überschrift doch mit ihrer Parallelisierung von Mai, Sommer und Winter mittels der jeweils wiederholten Präposition gegen eigentlich ein Dreierschema, das weder den verschiedenen mittelalterlichen Jahreszeitenkonzepten, noch den tatsächlichen technischen Einbauweisen der Topik im Minnesang entspricht, wo die Festschreibung des als aktuell imaginierten Jahreszeitenzeitpunktes in Mai oder Sommer, wenn nicht im Grunde frei austauschbar ist, so doch sicherlich aber keinen kategorial anders ausgerichteten Typus markiert.83 Dies belegt aber in der Göttinger Handschrift allein schon das Mügeln-Lied IIHeinrich von MügelnLied I–VI, das dort mit dem Vorverweis Gegen dem Meyen aber also vnd der tzyd des Somers84 eingeführt ist, was schnell klar werden lässt, dass selbst für die Lieder des hier betrachteten Autors die beiden Jahreszeitangaben Mai und Sommer also genau nicht zu einer Konstituierung von zwei disparaten und klar umrissenen Liedtypen dienlich sind. Somit erklärt sich die Nennung von Mai, Sommer und Winter in der Buchüberschrift nicht als eine Angabe von funktional divergierenden Genera einer Jahreszeiten-vorrede, sondern stellt sich eher als eine Aufzählung von rein inhaltlichen Möglichkeiten der temporalen Festlegung heraus.
Noch entscheidender ist aber die Auswertung der Überschrift aus der Mügeln-Handschrift in unserem eigentlichen Zusammenhang, der Forschungsdebatte über die terminologische Einfassung des hier zu konturierenden Topos (‹Jahreszeiten-› vs. ‹Natureingang›). Vor allem in diesem Punkt wird sich die vorliegende Untersuchung aber fragen lassen müssen, inwiefern jene Lehranweisung nicht als Ausgangspunkt einer Benennungsfindung für diesen zu nutzen wäre, stellt sie doch im Gegensatz zur neuzeitlichen Wortprägung ‹Natureingang›, die ja zudem ideologisch nicht gerade unbelastet ist, den historisch zumindest näher am Kontext des Minnesangs liegenden Versuch dar, den Topos auf einen Begriff zu bringen. Allerdings scheint der Befund KÖBELES, das Wort vorrede sei als Äquivalent des Terminus ‹Natureingang› aufzufassen85, insofern etwas vorschnell zu sein, als in der Notiz zwar der Eingangscharakter der Topik (vorrede) betont wird, dieser Begriff allein aber eben noch nicht kategorial auf die ‹Natur› / ‹die Jahreszeiten› hin perspektiviert ist; seine Entsprechung wäre in den dichtungstheoretischen Fachbegriffe ‹Prolog›, oder ‹Praefatio› zu suchen. Zudem besteht bei einer begrifflichen Gleichsetzung der in der Überschrift aus g besprochenen vorrede mit der Bezeichnung ‹Natureingang› die größte Schwierigkeit darin, dass die ‹Natur› als kosmologisches Konzept in dem Zitat gar nicht angesprochen ist, ja die vorrede im Gegenteil eindeutig allein über den Jahreszeitenbezug thematisch präzisiert wird (gegen den Meyen, gegen dem Somer, gegen dem wintter), der somit nach Einschätzung des Überschriftenurhebers den dominanten thematischen Zielpunkt der von ihm bestimmten Topik bildet.
Dies würde nun aber die hier aufgeführten Überlegungen zu einer Ersetzung des Begriffs ‹Natureingang› durch ‹Jahreszeiteneingang› eher noch untermauern, ebenso wie übrigens die in der Handschrift den Liedern beigefügten Überschriften, die ebenfalls als die Besonderheiten der vorrede-Umsetzung den jeweiligen saisonalen Bezug hervorheben (s. oben).86Heinrich von MügelnLied VIHeinrich von MügelnLied IVHeinrich von MügelnLied I–VI Deshalb erscheint es zunächst auch als besser abgesichert, dass vormals BURGHART WACHINGER für die Mügeln-Lieder – anders als STACKMANN87, KELLNER88, KÖBELE89, und HUBER90 – den Terminus ‹Jahreszeiteneingang› präferiert hat.91 Allerdings wird dieser Begriff in der vorliegenden Arbeit für einen verwandten, letztlich aber technisch doch ganz anders ausgerichteten Topos reserviert werden müssen, nämlich die Möglichkeit einer Eingangsgestaltung über einen Jahreszeitenbezug ohne Aufführung von Naturdetails.92ReinmarMF 167,31 Denn gerade die in der Forschung immer wieder begegnende Verwischung dieser beiden Formen saisonaler Perspektivierung hat nicht nur zu m.E. fehlgehenden Urteilen über den quantitativen Einsatz der Topik im Minnesang geführt, sondern auch Unterschiede wie deren fundamental anders ausgerichtete registrale Realisation verschwinden lassen (s. dazu unten, Kap. II.1.). Solche tatsächlich sinnvollerweise als ‹Jahreszeiteneingänge› zu kennzeichnenden Liedanfänge mit Jahreszeitenaussage, aber fehlender Aufführung von Naturerscheinungen, begegnen übrigens im von g überlieferten Liedcorpus Heinrichs von Mügeln im Gegensatz zu den durchgeführten Natureingängen von Lied I, II, III und VI nicht ein einziges Mal. Dies wird man dahingehend deuten müssen, dass die Überschrift des XVI. Buchs mit ihrem Hinweis auf die saisonal organisierte vorrede zwar gegenstandsbezogen sicherlich auf das, was die Forschung als ‹Natureingang› bezeichnet hat, zielt, terminologisch dafür aber aus heutiger Sicht zur systematischen Ordnung der verschiedenen Formen von Natur- und Jahreszeitenrepräsentationen im Minnesang ergänzungsbedürftige Akzente setzt. Ganz unberechtigt ist die Einordnung in g aber sicherlich nicht, wird die prinzipielle jahreszeitliche Organisation des Topos doch auch als eine zwingende Grundbedingung des ‹Natureingangs› erkennbar. Deshalb wird in vorliegender Arbeit auch präziser vom ‹jahreszeitlich organisierten Natureingang› im Minnesang zu reden sein.
Somit bleibt zu sagen, dass trotz aller begrüßenswerten Bemühung, für die Mediävistik literaturwissenschaftliche Kategorien wie Gattungstermini und eben Toposbezeichnungen aus der Ableitung aus (annähernd) zeitgenössisch verbürgten Begrifflichkeiten bzw. historischen Denkkategorien zu gewinnen, es mir aber nicht nur im Falle der Mügeln-Lieder, sondern für den Minnesang generell sinnvoll erscheint, an der Bezeichnung ‹Natureingang› festzuhalten, da es so im Sinne einer differenzierten Systematik der verschiedenen Typen von Naturrepräsentationen im Minnesang möglich ist, diesen Topos von der eben liedfunktional doch anders einsetzbaren Möglichkeit der Eingangsgestaltung, dem Jahreszeiteneingang im hier aufzustellenden engeren Sinne, zu separieren.
Was die zweite bedeutende Entwicklungstendenz der weiteren Forschungsarbeiten zum Thema anbelangt, ist auf die seit dem Ende der 1980er Jahre – übrigens in Deckung mit der allgemein für die Minnesangphilologie zu bemerkenden Ausrichtung an der ‹Aufführungssituation›93 – verstärkt erfolgte Betrachtung der Natur- und Jahreszeiteneingänge unter kommunikationspragmatischer Perspektive zu verweisen, die zuletzt in Richtung einer die soziokommunikativen Leistungen dieses Topos im Rahmen der institutionellen Absicherungen des Minnesangs verfolgenden Lesart weiterentwickelt worden ist. Dabei erweist es sich als aufschlussreich, dass die derart orientierte Forschung wiederum am Aspekt der (möglichen) Wirklichkeitsbezüge des Topos ansetzt.
CLAUDIA HÄNDL argumentiert in ihrer 1987 erschienenen Arbeit «Rollen und pragmatische Einbindung» in Bezug auf die Wirklichkeitsbezogenheit des Natureingangs zunächst noch etwas vorsichtiger: «Die temporale Deixis auf der Textebene leistet in historischer Hinsicht nichts, und auch die Jahreszeitangaben sind immer mit Rücksicht auf die Topik des Natureingangs zu sehen»94, betont aber anschließend generell: «Allerdings scheint bei der lokalen und temporalen Deixis, anders als in selbstreflektierender Lyrik späterer Zeit, ein n i c h t fingiertes hic et nunc durch, das die Bindung der Minnelieder an die aktuelle Aufführungssituation betont»95. 1999 baut dann THOMAS BEIN diese recht allgemein bleibenden Hinweise HÄNDLS in einem Aufsatz zur theoretischen Fundierung einer kommunikationspragmatischen Lektüre der Jahreszeiten- und Natureingänge im Minnesang aus und nutzt jene, um zu einer Typologie des Topos zu gelangen.96 BEIN beantwortet hierbei die Frage, ob die Angaben der jahreszeitlichen Liedanfänge als deiktische Signale auf die außerliterarische Wirklichkeit gelesen werden können, aufgrund der angenommenen Aufführungssituation dieser Lyrik vor der höfischen Gesellschaft – zumindest für den früh- und hochhöfischen Minnesang – durchaus positiv.97 Ja erst mit der möglichen Rezeption der Lieder als Leselyrik, so BEIN98, oder, wie JAN-DIRK MÜLLER herausarbeitet, durch die mit Neidhart einsetzenden Literarisierungstendenzen des späthöfischen Minnesangs99, die das auf gemeinsame Außenrealität referierende und damit konsensstiftende Mittel100 des Natur- oder Jahreszeiteneingangs endgültig zum Kunstprinzip werden lassen, sei ein Auseinandertreten von Außenrealität und literarischer Aussage in diesem Punkt überhaupt denkbar.
Einmal davon abgesehen, dass gerade die Inanspruchnahme der Aufführungsbasiertheit des Minnesangs durch den kommunikationspragmatischen Ansatz vom Verfasser vorliegender Arbeit wegen des damit verbundenen Abhebens auf den defizitären Status des schriftlich überlieferten Textes als problematisch angesehen wird und verlässliche Aussagen über die genauen Verhältnisse der Textangaben zu solchen möglichen außerliterarischen Referenzpunkten sowieso nicht mehr getroffen werden können, ist bezüglich einer solchen Einordnung dieser Topik folgender Einwand zu machen: Zunächst einmal trifft sich die neuere Forschung bei einer derartigen Auffassung in bedenklicher Weise mit der älteren, deren Verständnis vom Natureingang als Referenzmedium auf außerliterarische Bezugspunkte durch die Arbeiten von BRINKMANN und CURTIUS eigentlich trefflich revidiert worden war; schließlich wird ja auch beim aufführungspragmatischen Ansatz wiederum die Wahrnehmung dieses Topos in seiner literarischen Stilisiertheit und seiner innertextlichen Argumentation behindert. Betrachtet man aber bei aller Variabilität der Einbindungsmöglichkeiten die dominante Konzeption des Einbaus des Natureingangs in das Ich-Sprechen des Werbungsliedes, wie sie sich besonders deutlich am sehr häufig auftretenden Typ des kontrastiven Sommereingangs zeigt, so ist – im Gegensatz zur propagierten Funktion einer kommunikativen Verständigung mittels Abheben auf gemeinsame Wahrnehmungsbereiche – doch gerade die gegenläufige Textstrategie nicht zu übersehen: Das Ich separiert sich durch die Andersartigkeit seiner Empfindungen, die konträr zur sozial erwarteten, jahreszeitlich ‹angemessenen› Haltung gesetzt sind, von der Gesellschaft, eine mögliche kommunikativ hergestellte Gemeinsamkeit als Ausgangsbasis des Liedes wird also sofort destruiert. Um die Funktion des Jahreszeiten- bzw. Natureingangs im Minnesang zu ergründen, dürfte es demnach sinnvoller sein, die genaue argumentatorische Einbauweise zu beschreiben und in der Analyse ausschließlich auf der Textebene zu verbleiben, ja auf die Herstellung von Bezügen zu außerliterarischen Gegebenheiten und möglichen kommunikativen Abläufen, die sich durch eine Vortragssituation ergeben könnten, über deren genaue Modalitäten uns nichts bekannt ist, zu verzichten.
So scheint mir auch die jüngst in Aufsätzen von LUDGER LIEB vorgenommene Weiterentwicklung der kommunikationspragmatischen Lesart zu einer Analyse des Topos unter der Perspektive seines möglichen Beitrages zum Institutionalisierungsprozess des Minnesangs in einigen Punkten nicht unproblematisch zu sein.101 Diese spezifische Modifizierung durch LIEB hat sich im Übrigen schon bei THOMAS BEIN angedeutet, der bereits auf eine weitere Funktion des Topos aus kommunikationspragmatischer Sicht hingewiesen hat, nämlich dass dieser es gewährleiste, «das ‹Wiedererkennen› literarischer Situationen zu erleichtern bzw. allererst zu ermöglichen»102. LIEB hat nun in seinem 2001 erschienenen Aufsatz «Die Eigenzeit der Minne» die Frage, inwiefern der Jahreszeitentopos, unter dem der ‹Natureingang› zu subsumieren wäre, der institutionellen Absicherung des Minnesangs dient, ausführlich behandelt.103 Dieser Prozess sei für den Minnesang, der weder in seiner Form der literarischen Kommunikation noch in Bezug auf sein Thema, die Liebe, über eigene institutionelle Absicherung verfüge, als ein Versuch darzustellen, wie es RAINER WARNING für die Trobadorlyrik herausgearbeitet hat, bestehende symbolische Ordnungen konnotativ auszubeuten.104 Für LIEB bildet nun auch der Jahreszeitentopos eine «vorgängige institutionalisierte Denkform»105, die sich der Minnesang im Prozess seiner Institutionalisierung nutzbar mache. Jener stehe hierbei als kultureller Wissensspeicher von Zuschreibungen – wie im Falle des Sommers von der Jahreszeit als causa amoris106 und Grundbedingung sozialer Akte wie Kontakt der Liebenden bzw. öffentliches Singen107 – bereit, an den der Minnesang anknüpfen kann, um das richtige Sprechen über die Liebe zu verankern und einzuüben108; schließlich diene der Jahreszeiten- bzw. Natureingang als konventionalisiertes Bild der Garantierung gelingender Kommunikation.109 Es muss allerdings gegen die Thesen von LIEB der Einwand erhoben werden, dass die von ihm vorgenommene inhaltliche Füllung des angeblich vorgängigen habituellen Jahreszeitenkonzepts durch textliche Zeugnisse genau nicht zu belegen ist, da es in eine Zeit vor der Verschriftlichung der volkssprachlichen Lyrik weist. Denn, selbst wenn man annimmt, dass es derartige Konzepte gegeben hat, wären diese bereits in den Texten des frühhöfischen Minnesangs durch Umdeutung und Neubesetzung modifiziert, teils sogar massiv verändert worden110, so dass bezweifelt werden muss, dass überhaupt ein verlässlicher und methodisch sauberer Weg, ihnen näher zu kommen, gefunden werden kann. Insofern erweist sich die philologische Rekonstruktion solcher angeblich vorgängigen institutionellen Denkformen als viel zu spekulativ. Auch ist zu fragen, ob die Vielfalt an Möglichkeiten der Inbezugsetzung von Jahreszeiten- und Liebesthematik, die die höfische Lyrik von Anfang an präsentiert, wirklich auf ein präexistentes Modell mit derart festen Zuschreibungen zurückgeführt werden sollte, wie uns LIEB vorschlägt. Denn mithin hat es die Theoriedebatte auch als eine bedeutsame Leistung der topischen Raster herausgestellt, dass die Topoi als «Leerformen»111 gerade nicht vorausgehend in ihrer Auswertung bereits eingeschränkt sind, sondern vom Anwender prinzipiell in alle denkbaren Richtungen auflösbar sind (in utramque partem).112 Schließlich ist auch zu fragen, was die Annahme solcher vorgängigen habituellen und institutionalisierten Vorstellungen für die Textanalyse überhaupt zu leisten vermag, wenn doch die uns überlieferten Texte sowieso stets ganz eigene Wege in der Realisation gehen. Es wäre stattdessen ratsam, die jeweilige Einbauweise des Topos und den innertextlichen argumentatorischen Verlauf präzise in der Analyse nachzuverfolgen und dabei nicht mit derart spekulativen Größen zu arbeiten; denn die methodisch heikle Operation mit vorgängigen Konzepten ist für die analytische Betrachtung des Textes weder nötig noch zusätzlich gewinnbringend. Darüber hinaus muss noch ein weiterer Aspekt angesprochen werden: LIEBS Rekonstruktion einer institutionellen Denkform des Jahreszeitentopos deckt sich mit den Ergebnissen der vorherigen Forschung vor allem darin, dass das Konzept einer Kongruenz von Jahreszeit bzw. jahreszeitengemäß gestimmter Gesellschaft und Liebesverhalten des Ichs als primär vorausgesetzt wird.113 Diese Annahme ist aber wiederum mit dem Hinweis darauf, dass alle Möglichkeiten der Anbindung von Jahreszeitenthematik und Befindlichkeit des Text-Ichs im Minnesang auch von Anfang an begegnen, zu entkräften; denn dass die gleichgerichtete Einbautechnik einer kongruenten Haltung von liebendem Ich und jahreszeitengemäß gestimmter Gesellschaft/Natur primär und die kontrastive Setzweise sekundär wäre, ist aus dem überlieferten Bestand nicht abzuleiten. Statt also von einer präexistenten, festen Zuschreibung in Form von einem institutionalisierten, kollektiven Jahreszeitenkonzept auszugehen, die dann erst durch die literarischen Texte experimentell gelockert wird, wäre der Jahreszeiten- und Naturtopos als ein nur in (literarischen) Texten greifbares rhetorisches Modell zu betrachten, dass von Anfang an für eine Vielzahl denkbarer Bezüge zwischen jahreszeitlicher Natur und Gestimmtheit des Ichs offen ist. Schließlich stellen ja auch die Texte, die suggerieren, es gebe eine sich aus der Jahreszeit ableitende, gesellschaftlich geforderte Haltung für das Ich, diesen Anspruch durch eine textuelle Konstruktion erst her und sind – gleichgültig, ob es einen solchen in der Realität gegeben haben mag oder nicht – diesbezüglich ebenso deutlich literarisch stilisiert wie die anderen Varianten.
Dennoch ist ein Punkt hervorzuheben, auf den JAN-DIRK MÜLLER und LUDGER LIEB mit ihrem Befund einer Literarisierungstendenz aufmerksam gemacht haben, die beide anhand des Topos – in jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – nachverfolgt haben, wenn sie die Minnesangtradition als eine literarische Emanzipationsbewegung lesen, die sich von der in den Rhythmus der höfischen Lebenswelt eingeschriebenen Zweiteilung des Jahres mit fester Zuordnung von vröide und trûren ablöst (MÜLLER114), wobei im Gegensatz zum jahreszeitlichen Zyklus eine der Liebe eigene Zeitstruktur hervortritt, die die Minne der Determination durch den saisonalen Wandel enthebt, um die Werthaftigkeit der Liebe noch stärker herauszupräparieren (LIEB115). Dass aber in der Minnesangtradition durchaus eine deutliche Tendenz zu bemerken ist, über Techniken wie die Herstellung von Rissen in der Kohärenzbildung, Ablehnung der Geltung des Topos oder Überbietung desselben, die Außergewöhnlichkeit einer besonderen Liebe des Ichs herauszustellen, die es solcher als gesellschaftlich habitualisiert imaginierter Konzepte und überhaupt der Determination durch fremde Zeitordnungen enthebt; darauf wird noch zurückzukommen sein. Es ist jedoch als Verdienst des kommunikationspragmatischen Ansatzes zu würdigen, auf diese Techniken der literarischen Stilisierung hingewiesen zu haben; die Frage nach den außerliterarischen Referenzpunkten des jahreszeitlich organisierten Natureingangs scheint mir allerdings, selbst in ihrer kommunikationspragmatischen Zuspitzung, prinzipiell in eine Sackgasse zu führen.116
Bevor hier später nun eigene Vorschläge zu einer Definition des jahreszeitlich organisierten Natureingangs im deutschen Minnesang und zu einer Typologie desselben gemacht werden können, muss an dieser Stelle noch auf die diesbezüglichen Einteilungsvorschläge von BEIN und LIEB eingegangen werden, die als hilfreiche Vorarbeiten vom Verfasser vorliegender Arbeit ebenfalls zur Erstellung seiner Typenunterteilung mitbenutzt worden sind, dennoch aber in einigen Punkten kritisch kommentiert werden sollen.
THOMAS BEIN hat in seinem hier bereits mehrfach erwähnten Aufsatz eine Typologie des Jahreszeiten-topos aus kommunikationspragmatischer Perspektive vorgestellt.117 Hierbei führt BEIN neben dem Grundtyp eines Natureingangs mit deiktischer Signalsetzung folgende Typen literarischer Jahreszeitenaneignung an, bei denen der außerliterarische Bezug auf das hic et nunc jeweils nur mehr oder weniger eingeschränkt vorliegt und die so als Ergebnis von spezifischen Literarisierungstechniken in den Blick zu nehmen sind: Jahreszeitenstrophen ohne Deixis / ohne Publikumsbezug (I)118Walther von der VogelweideL 94,11Albrecht von JohansdorfMF 90,32Kristan von LuppinKLD 31, I, Jahreszeiten in Rollenrede (II), wobei er in diesem Zusammenhang nochmals in die Typen (a) Tagelied, (b) Botenlied, (c) Frauenrede und (d) Anonyme Dritte unterteilt119Walther von der VogelweideL 88,9NeidhartSL 6/SNE I: C Str. 260a-265Wolfram von EschenbachMFMT XXIV, Nr. IX, Jahreszeiten und Sangeskunst (III)120, Jahreszeiten und dichterische Gelehrsamkeit / Formkünstlichkeit (IV)121Der KanzlerKLD 28, XIVBurkhard von HohenfelsKLD 6, XI, Jahreszeit und Minne (V)122WinliSMS 17,4, Herbstlieder (VI)123 sowie als letzten Typ die Mischformen (VII).124Der von GlierSMS 8,2Walther von der VogelweideL 45,37 Von der Kritik in einzelnen Detailfragen abgesehen, scheint mir die Konstituierung einer Typeneinteilung auf der Basis des Referenzbezugs auf das hic et nunc der Vortragssituation generell zweifelhaft: Zum einen ist die argumentative Heranziehung von Aufführungsmodalitäten methodisch heikel, zum anderen führt dieses Typenkriterium bei einer Einteilung des Jahreszeiten- bzw. Natureingangs im Minnesang auch nicht zu überzeugenden Merkmalsgruppen – man denke nur an die recht disparat bestimmten Typen bei BEIN: während Typ I und II noch rein kommunikationspragmatisch konstituiert sind, überwiegen bei III und V doch eher inhaltliche, bei Typ IV formalästhetische Gesichtspunkte. Schließlich spielt für die von BEIN vorgeschlagene Typologie, bei der ein bisweilen auftretendes stilistisches Charakteristikum (deiktische Signalsetzung, Publikumsanrede) herausgegriffen und unbegründet zum Grundzug des Topos erklärt wird, gerade das Moment, das zur Bestimmung der Funktion des Natureingangs und der Besonderheiten in der Einbauweise Aufschluss zu geben vermag, überhaupt keine Rolle: die Frage nämlich, wie Jahreszeitenthematik und Befindlichkeit des Ichs (in Bezug auf die Liebe bzw. den Sang) gegeneinander gesetzt sind.
Die Art und Weise des Einbaus des Jahreszeiten- bzw. Naturtopos hat dann 2001 LUDGER LIEB in seiner Darstellung zwar als wichtiges Kriterium einer Typenbestimmung berücksichtigt125Burggraf von RietenburgMF 19,7, jedoch nicht deutlich genug herausgestellt.126 LIEB versucht hier – in Abgrenzung zum konventionellen Fall einer die Geltung des vorgängig institutionalisierten Jahreszeitenkonzepts anerkennenden, kongruenten Einbauweise des Topos – die Vielfalt der möglichen Applikationswege des Jahreszeiten- bzw. Naturtopos, die sich im Prozess der Distanzierung des Minnesangs von dieser präexistenten Ordnung ergeben127, anhand von vier exemplarischen Anwendungstypen zu dokumentieren, nämlich denen der Kontrastierung128Heinrich von RuggeMF 106,24, Überbietung129ReinmarMF 203,10ReinmarMF 169,9, Verkehrung130Heinrich von MorungenMF 125,19 und Substitution131Wolfram von EschenbachMF 7,11. Damit weist LIEB zwar einerseits auf die Fülle an Möglichkeiten der Sinnherstellung zwischen Jahreszeitentopos und Liebes- bzw. Sangesthematik hin, überdeckt aber andererseits die zur basalen Distinktion einer typologischen Systematik geeignete Opposition von kongruenter und kontrastiver Setzweise durch die Annahme eines vorgängig habituellen Konzepts und daran anschließender literarischer Distanzierung, so dass die vier von LIEB herausgestellten Typen, die von ihm ja auch gar nicht als komplettes Einteilungssystem konzipiert sind, zur Konstituierung einer anbindungsbezogenen Typologie nicht ausreichen, da sie nur den Bereich der Relativierung des Topos betreffen.132 Schließlich ist es aber auch ein Manko der Darstellung bei LIEB, dass er bezüglich des prinzipiellen Status nicht zwischen einer tatsächlichen Realisation des Topos und einer bloßen Allusion unterscheidet.133 Diese Distinktion scheint mir jedoch für die Aufstellung einer Typologie des jahreszeitlichen Natureingangs, wie sie hier im Folgenden angestrebt wird, eine notwendige Vorraussetzung sein. Es ist zur Verteidigung der verschiedenen hier vorgestellten Typologisierungsvorschläge aber hervorzuheben, dass ein solches Einteilungsvorhaben durch die Vielfalt an Anbindungsmöglichkeiten, die uns die Minnesang-Texte präsentieren, und die oftmals begegnende Variierung in feinen, aber bedeutungsvollen Nuancen fast unmöglich gemacht wird. So hebt auch PETER L. JOHNSON hervor, welch große Schwierigkeit es darstellt, angesichts dieses Variantenreichtums überhaupt zu einer adäquaten Typologisierung der Natureingänge im Minnesang zu kommen, die ja immer eine Komplexitätsreduktion mit sich bringt: «Der Versuch, die Natureingänge sinnvoll zu sortieren, scheiterte sofort daran, daß es bei relativ wenigen Beispielen so viele Kombinationen von Elementen und ihren Mischungen gibt, daß man entweder, Einzelheiten verwischend, Verschiedenes in einen Topf werfen mußte, oder beinahe mehr Kategorien hatte als Beispiele»134. Dazu ist allerdings zu sagen, dass das Risiko der zu stark oder zu gering ausgeprägten Abstrahierung sich für jede Form der Systematisierung ergibt, weshalb man aber lange noch nicht völlig auf sie verzichten sollte. Dennoch – und das gilt in besonderem Maße für eine zu entwerfende Typologie des Natureingangs im Minnesang – muss die typologischen Systematik von Vorneherein so offen konzipiert sein, dass fließende Übergänge zwischen den einzelnen Typen, die so nur als relativer Kern einer Merkmalsgruppe zu verstehen sind, stets denkbar sind.135 Dies soll auch für die vom Verfasser vorliegender Arbeit später vorgeschlagene Typeneinteilung, die sich keinesfalls als absolut versteht, geltend gemacht werden. Schließlich scheint es aber auch wichtig zu sein, das Feld der Typologisierung möglichst eng zu halten und präzise zu erfassen – ein Vorhaben, das mit einer Typeneinteilung des recht weitgespannten Bereichs disparater Erscheinungen, die unter dem Begriff des ‹Jahreszeitentopos› von BEIN und LIEB versammelt worden sind, nun einmal nicht zu erreichen war –, da sich so die von JOHNSON benannten Risiken durchaus reduzieren lassen. Insofern stellt sich hier noch einmal in aller Deutlichkeit die Frage nach einer adäquaten definitorischen Füllung des Topos ‹Natureingang› und der sinnvollen Einfassung seiner möglichen Erscheinungsformen und Spielarten.
In diesem Zusammenhang hat sich nun SUSANNE KÖBELE mit ihrer 2003 erschienenen Studie «Frauenlobs Lieder» aus einer dezidiert literarhistorischen Perspektive heraus136 in ausführlicher Weise mit den vielfältigen Erscheinungsweisen des Natureingangs in der vorausgehenden Minnesangstradition und der Anwendung bzw. Transformation dieser Topik bei Frauenlob und Heinrich von Mügeln beschäftigt.137 KÖBELE gelingt es darin nicht nur, die weit über das 13. Jahrhundert hinaus andauernde Relevanz des Natureingangs für die Literaturproduktion und -rezeption anhand diverser Beispiele einleuchtend nachzuzeichnen, ja zu erweisen, «daß der sogenannte ‹Natureingang› keineswegs als bloßes literaturwissenschaftliches Phantom sein Dasein fristet, vielmehr innerhalb der spätmittelalterlichen Literatur gewußte und zentrale Kategorie ist»138, sondern auch immer wieder generell für diesen Topos im Minnesang grundlegende Bemerkungen hinsichtlich seiner tektonisch-funktionalen Ausrichtung im Sinngefüge des traditionellen Werbungsliedes zu treffen.139 Vor allem aber muss die von KÖBELE entwickelte Zusammenstellung eines Merkmalskatalogs, mit dessen Hilfe zum einen das breite Spektrum verschiedenster Realisations- und Allusionsmöglichkeiten für den Natureingang im Minnesang eindrücklich vorgeführt wird, zum anderen der konkrete Einzeltext auf die bei ihm jeweils angewendeten Gestaltungsprinzipien hin befragt werden kann140, als verdienstvolle Ausgangsbasis der hier im Folgenden zu erarbeitenden typologischen Binnendistinktion des Topos ‹saisonal organisierter Natureingang› gewürdigt werden, der die vorliegende Arbeit so viele wertvolle Hinweise verdankt.141 Dabei fällt es dann letztlich gar nicht so stark ins Gewicht, dass das von KÖBELE dem Topos des Natureingangs unterlegte Verständnis wiederum zu weit gefasst ist, schließt es doch etwa nicht nur die im Folgenden von ihm zu separierenden Techniken der Naturstrophensetzung in Binnen- und Endstellung mit ein, sondern auch die der Reduktion bis zur Schrumpfung «auf ein einziges Stichwort»142. Ferner bleibt etwa auch im Falle der Anwendung von Verfahrensweisen der Metaphorisierung bzw. Allegorisierung die Frage einer trennscharfen Abgrenzung des eigentlichen Topos von seinen Transformationsformen (bzw. den Transformationsformen seiner Transformationsformen143) offen; denn schließlich werden sich letztere zwar – mehr oder weniger deutlich – auf diesen beziehen lassen, müssen aber seine Minimalanforderungen – wie z.B. die Imagination der ‹Faktizität› des aktuellen Jahreszeitengeschehens (s. unten) – nicht mehr unbedingt erfüllen. Dies kann im Extremfall, etwa durch Verfahren der «metaphorischen Umlenkung»144, so weit getrieben werden, dass sie statual überhaupt nicht mehr als eigentliche Aussagen über die jahreszeitliche Natur gelten können.145 Solche Transformationsformen müssten somit aus dem engeren Geltungsbereich der Topik ausgesondert werden, worauf später noch näher eingegangen werden soll.
Wie die obigen Überlegungen zur Interpretation der Überschrifft aus der Göttinger Mügeln-Handschrift bereits gezeigt haben, hat sich darauf zuletzt BURGHART WACHINGER mit dem Thema ‹Natureingang› auseinandergesetzt, indem er in seiner 2011 erschienen Aufsatzsammlung «Lieder und Liederbücher» auch einen bisher unveröffentlichten Aufsatz mit dem Titel «Natur und Eros im mittelalterlichen Lied» publiziert hat.146 Darin steckt WACHINGER einen beeindruckend breiten Rahmen von Naturrepräsentationen im mittelalterlichen Lied ab, wobei er von der mittellateinischen Dichtungstradition über den Minnesang bis hin zu Oswald von Wolkenstein Verbindungslinien nachzuzeichnen sucht. Es gelingt ihm hierbei durchaus eindrucksvoll, ganz verschiedene Formen des Einbaus von Naturmotivik wie den locus amoenus, Naturbezüge im Tagelied oder den jahreszeitlich ausgerichteten Natureingang auszumachen und in ihrer jeweils unterschiedlichen Ausrichtung auf das «Hauptthema Liebe»147 zu ergründen.148 Für den weiteren Fortgang der vorliegenden Untersuchung wird sich hierbei besonders die Beschreibung der grundlegend anders gelagerten Funktionsweise der raum- und zeitbildlichen Organisationstypen, deren schärfere Abgrenzung WACHNGER zu Recht einfordert149, als hilfreich bei der Distinktion der verschiedenen Topoi der Jahreszeiten- und Naturrepräsentationen im Minnesang erweisen.150 Gerade im Falle der jahreszeitlich ausgerichteten Sparte dieses Komplexes vermeidet WACHINGER jedoch leider eine trennscharfe Unterscheidung zwischen jenen unterschiedlichen Topoi, die hier im Folgenden als ‹jahreszeitlich organisierter Natureingang›, und ‹Jahreszeiteneingang› näher umrissen werden sollen.151ReinmarMF 167,31
Zudem ist aber zu bemerken, dass sich WACHINGER mit seinem eigentlichen Thema, der Ergründung des Zusammenhang von Natur und Eros im mittelalterlichen Lied,152 dann einer Fragestellung annimmt, die m.E. für einen Aufsatz viel zu global gestellt ist und eigentlich nur jeweils anhand des konkreten Einzeltextes durch eingehende Analyse beantwortet werden kann. Gleichwohl sollen die diesbezüglichen Ergebnisse Wachingers, der sich mit der These einer vorgängigen erotischen Aufgeladenheit der Naturmotive153, die im Minnesang «höfisch gezähmt»154 allenfalls als (anrüchige?) konnotative Anhaftung durchscheine155, dezidiert an MOHRS Aufsatz aus dem Jahr 1969 anlehnt156, hier kurz vorgestellt werden.
Aus der Annahme einer weitgehenden Vorbesetztheit der Naturmotivik durch das klerikal-lateinische Modell von einer Wirkmacht der Natur als causa amoris157 bzw. des brauchtümlichen Konzepts von der schönen Jahreszeit als der Zeit der Liebe heraus wertet Wachinger hierbei den Befund eines – quantitativ und qualitativ – relativ zurückhaltenden Einsatzes der Topik im höfischen Minnesang so, dass diese womöglich gerade aufgrund ihrer auf Erotik zielenden Konnotationen den deutschen Autoren als suspekt erschienen sein müsse.158 Als äußerst missverständlich und in dieser genderspezifischen Zuspitzung auch recht überholt erscheint mir etwa in diesem Zusammenhang die Anmerkung WACHINGERS, dass im Minnesang, der «zweifellos auch vor Damen vorgetragen» worden und in dem (deshalb?) «Sexuelles weitgehend tabuisiert» sei, anders als etwa in der mittellateinischen Lyrik der clerici, jener «männlichen Jungakademiker», Bezugnahmen auf die erotisches Begehren weckende Macht der Natur bis auf wenige Ausnahmen weitgehend reduziert seien.159 In dieser «höfisch gezähmten»160 Form, die stattdessen die «Eigenzeit der Minne»161 etabliere und einfordere, sei nun der Topos in seiner «argumentativen Kraft deutlich geschwächt» worden, weil dort, «wo Jahreszeiteneingänge vorkommen, […] sie daher meist in irgend einer Form kontrastiv auf die Liebe bezogen» würden.162 Dazu scheinen mir einige grundsätzliche Anmerkungen nötig zu sein: Erst einmal gilt es zu bedenken, dass zum einen der Minnesang – trotz der Abstraktheit und Indirektheit seiner Ich-Aussagen – stets auch auf die erotische Dimension einer erfüllten Liebe als zu erreichendes Idealbild transparent bleibt, man also von einer tatsächlichen ‹Tabuisierung› der Sexualität nicht sprechen können wird.163 Zum anderen ist es im Falle der Minnesangtradition m.E. gar nicht sinnvoll, von einer vorbestehenden, festen Besetztheit der Jahreszeiten- und Naturtopik auszugehen, wie sie etwa als konnotativer ‹Ballast› aus einer diffusen klerikal-brauchtümlichen Mischsphäre von WACHINGER vermutet wird. Vielmehr dürfte es – wie bereits angedeutet – adäquater sein, von einer weitgehenden Offenheit des Motivkomplexes auszugehen, der von Anfang an für eine Vielzahl von denkbaren Verknüpfungsmöglichkeiten zur Verfügung steht und somit diese Konzeptualisierungen im jeweiligen Einzeltext dann von Fall zu Fall anders herstellen bzw. gewichten kann. Wie nun aber ausgerechnet die diffizil aufgefächerten rhetorischen Strategien zur Einbindung des Narureingangs in das Register des Werbungslieds, ja die verschiedenen im Minnesang begegnenden Möglichkeiten einer eben nicht immer nur kontrastiv angelegten Inbezugsetzung von Natur- und Liebesthematik nun aber mit der Diagnose einer Abschwächung der Argumentationskraft der Topik zusammenpassen sollen, erschließt sich dem Verfasser der vorliegenden Arbeit nicht. Zudem ist auch die Einordnung gar nicht überzeugend, dass im höfischen Minnesang die bewusste erotischer Aufladung der jahreszeitlichen Naturmotive nicht signifikant anzutreffen wäre. Allerdings verlangt diese Zuspitzung m.E. eben Maßnahmen der besonderen Markierung164Gottfried von NeifenKLD 15, XIV und ergibt sich somit gerade nicht als genereller Subtext einer bloßen Erwähnung von Naturdetails. Für jene besonderen Fälle einer erotische Konnotationen herstellenden Einsatzweise der Motivik finden sich nämlich – eben nicht nur ausgerechnet auf dem Gebiet des Frauenliedes (!), wie WACHINGER zugesteht165, sondern auch andernorts – auffallende Beispiele.166Heinrich von VeldekeMF 58,11 Ein solches begegnet etwa in Heinrichs von Morungen Lied MF 140,32Heinrich von MorungenMF 140,32: Uns ist zergangen der lieplîch sumer mit seiner Nutzung der erotischen Metapher des bluomen brechens167, und damit also gerade bei einem Autor, der den Natureingang sonst eher vermeidet, was somit nahelegt, dass er diesen Topos wohl kaum aus Scheu vor dessen generell anzüglichen Implikationen nicht häufiger zum Einsatz gebracht haben wird.168
Mit den obigen Überlegungen WACHINGERS zum konnotativen Potential des Natureingangs im Kontext des werbungsliedtypischen Registersprechens ist aber freilich ein Themenfeld erreicht, dem es im weiteren Zusammenhang dieser Untersuchung – gerade auch im Hinblick auf die anderen europäischen Lyriktraditionen des Mittelalters – noch nachzugehen sein wird. Dabei wird es jedoch weniger um bestimmte, für den Minnesang als vorgeordnet zu verstehende saisonale Konzepte oder bestimmte motivliche Überschneidungen gehen, als vielmehr um charakteristische Tonfälle und unterschiedliche Möglichkeiten in der registralen Präsentation des Natureingangs, die im deutschen Minnesang zur konkreten Ausgestaltung im Kontext der europäischen Lyriktraditionen zur Verfügung stehen. Dies wird freilich den Blick darauf lenken, dass der Natureingang in seiner tendenziell narrativ-festschreibenden Ausrichtung169Ulrich von GutenburgMF 77,36 (Lied) im Register des Werbungsliedes mit seinem abstrakten, reflexiv-kreisenden Ich-Sprechen, das situationale Festlegungen ja gerade meidet, im Grunde ein eigens einzubindender ‹Fremdkörper› ist.170 Dabei wird es sich übrigens als eine interessante Frage herausstellen, inwiefern sich diese Überlegungen mit einem aktuell sehr bedeutenden Gebiet der Minnesangforschung verbinden lassen, in dem der Natureingang zuletzt auch verständlicherweise eine zunehmend wichtigere Rolle gespielt hat, nämlich der narratologischen Lyrikanalyse und der durch sie neue Impulse erhaltenden Bestrebung, die vielfältigen narrativ-lyrischen Übergangsphänomene in der mittelalterlichen Literatur zu ergründen.171