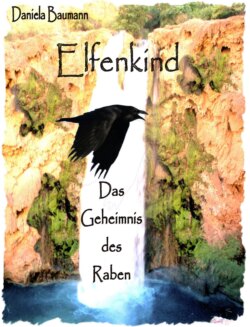Читать книгу Elfenkind - Daniela Baumann - Страница 3
1. Ein seltsames Baby
ОглавлениеEs war schon spät, als Mrs. Duncan, die Heimleiterin, ihren letzten Kontrollgang des Tages machte. Wie immer waren die Kinder in ihren Betten und schliefen tief und fest. Das Waisenhaus war stark überbelegt, fast doppelt so viele Kinder wie Betten hatte sie inzwischen hier, sodass sich immer öfter zwei Kinder ein Bett teilen mussten. Der Krieg war an den meisten Familien nicht spurlos vorübergegangen und daher hatten viele Kinder nun keine Eltern mehr und landeten bei ihr. Nicht wenige dieser Kinder hatten indianische Wurzeln, was es ihr sicher nicht leichter machen würde, diese zu vermitteln. Sie seufzte. Natürlich liebte sie die Kinder, aber am liebsten war es ihr, wenn sie sie vermitteln konnte und die Kleinen eine neue Familie bekamen. Dennoch, Kinder mit indianischen Wurzeln würden so schnell nicht genommen werden.
Die meisten Menschen in dieser Gegend waren den Indianern gegenüber sehr ablehnend. Wenn nicht sogar hasserfüllt. Obwohl in vielen Familien auch indianisches Blut war. Das war hier in Arizona nicht selten, aber es wurde abgestritten. Der Krieg zwischen den Siedlern und den Indianern war blutig gewesen, auf beiden Seiten, und nun waren die Indianer zurückgedrängt worden, als die Armee eingegriffen hatte. Sie wurden in Reservaten zusammengetrieben und ihre Freiheiten deutlich eingeschränkt. Noch gab es einzelne Widerstandskämpfer unter ihnen, aber sie hatten wohl kaum eine Chance. Mrs. Duncan seufzte wieder. Sie verstand nicht, was alle gegen die Indianer hatten, die Meisten waren freundlich und zuvorkommend, wenn man ihnen die Chance gab, sich zu öffnen. Natürlich gab es auch dort welche, die gegen Recht und Gesetz verstießen, aber wo gab es solche Menschen nicht?
Sie horchte auf. Was war das eben gewesen? Ihre Runde hatte sie gedankenverloren beendet und war zurück in ihre eigenen Räume gegangen. Die Kinder wussten, dass sie sie jederzeit wecken konnten, wenn etwas sein sollte. Das kam relativ häufig vor, da die meisten von ihnen die Schrecken des Krieges mit eigenen Augen erlebt hatten und nun unter Alpträumen litten. Doch das war keines der Kinder gewesen. Nein, es kam von unten. Mrs. Duncan stand auf und wollte nachsehen gehen. Sie war unruhig, hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Doch das Geräusch, das sie irritiert hatte, war inzwischen weg. Es war still. Zu still. Normalerweise konnte man in der Nacht hier viele verschiedene Geräusche hören, doch außer den einzelnen Schnarchern der Kinder konnte sie nichts hören. Absolut nichts.
Unruhig verließ sie ihr Zimmer und lief nach unten. Ein Instinkt sagte ihr, dass sie nach draußen sehen musste. Als sie die Tür öffnete, stockte ihr der Atem. Vor ihr auf der Treppe lag ein Baby. Eingewickelt in ein paar Tücher und auf eine Decke gebettet. Dabei war es kalt, eiskalt. Auch wenn sie in Arizona waren, der Winter konnte selbst hier tödlich enden, vor allem für ein Neugeborenes. Es war kurz vor Weihnachten und es sollte Schnee geben. Das Baby sah sie mit großen, dunklen Augen an. Die Haut war extrem hell, die wenigen Haare, die zu sehen waren, wirkten schwarz, aber in der Nacht konnte das täuschen.
Schnell sah sie sich um, doch sie konnte niemanden entdecken. Das Waisenhaus stand an einem Hügel, vor ihr fiel das Gelände ab, ein Weg führte in den Ort, doch kein Mensch war zu sehen. Wer hatte dieses Baby hier abgelegt? Die Stadt war klein, sie wusste nur von wenigen schwangeren Frauen in der Gegend, aber diese Babys dürften noch nicht so weit sein. Mrs. Duncan wandte sich wieder dem Baby zu. Das Kleine war ihr mit Blicken gefolgt und sah sie durchdringend an. Es wirkte unheimlich, so von einem Baby angesehen zu werden. Die Heimleiterin besann sich auf ihre Aufgabe und hob das Bündel vorsichtig hoch. In dem Moment, als sie das Baby im Arm hatte, schloss es seine Augen und schlief ein. Ein paar Meter weiter flatterte lautlos ein Rabe davon, der auf dem Treppengeländer gesessen und das Baby beobachtet hatte.
Mrs. Duncan eilte nach drinnen in den Waschraum. Darin war es immer so warm wie möglich, damit vor allem die Kleinsten nicht froren. Dort wickelte sie das Bündel auseinander. Schnell stellte sie fest, dass es sich um ein Mädchen handelte, das höchstens ein paar Stunden alt sein konnte. Die Nabelschnur war noch ganz frisch und es sah aus, als wäre der kleine Körper direkt nach der Geburt schnell in ein paar Tücher gewickelt und dann bei ihr abgelegt worden. Vorsichtig säuberte sie die Kleine und wickelte sie, bevor sie ihr ein paar saubere aber abgetragene Babysachen anzog. Das Mädchen wachte nicht auf. Daher legte sie sie in ein Gitterbett, das in der Ecke des Schlafraumes stand und zog es in ihr Zimmer. Da die Kleine immer noch tief und fest schlief, wandte sie sich den Tüchern zu, vielleicht konnten die ihr helfen, herauszufinden, wer das Baby war, und möglicherweise auch etwas über seine Eltern.
Die Tücher waren indianisch, das war eindeutig. Diese Webarbeiten stammten nicht von einem Stamm hier in der Nähe, das bunte Muster verriet selbst ihr so viel. Mrs. Duncan kannte sich nicht besonders gut aus mit den verschiedenen Stämmen, aber da einige der nahe wohnenden Indianerstämme immer wieder einen Markt im Ort abhielten, kannte sie deren Muster, und das hier war vollkommen anders. Die Tücher waren abgetragen und die Farben ein wenig ausgeblichen, als wären sie schon älter, aber sauber und gepflegt. Sie legte sie auseinander und ein Blatt Papier fiel heraus.
Das ist Kristina. Bitte kümmern Sie sich um sie. Ich kann es nicht tun.
Mehr stand nicht auf dem Papier. Einige Male drehte sie es hin und her, in der Hoffnung, mehr zu entdecken, aber da war einfach nichts. Seufzend ging Mrs. Duncan wieder in ihr Zimmer, noch immer grübelnd über diesen Fund. Als ihr Blick auf die Uhr fiel entschied sie, jetzt auch zu schlafen. Es war kurz nach drei Uhr morgens. Gedanken könnte sie sich später machen.
Am nächsten Morgen war Mrs. Duncan ziemlich unausgeschlafen. Das kleine Mädchen ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie hatte so zart und verletzlich gewirkt, als sie in der Nacht auf dem Tisch gelegen hatte. Ihr weniges Haar, noch feucht von der Geburt, war kohlrabenschwarz, was die Theorie unterstützte, dass sie ein Indianerkind war. Ihre Augen waren von einem dunklen blau, wenn man nicht genau hinsah, wirkten sie schwarz, allerdings hatten sie kleine, helle Sprenkel darin, was sie geheimnisvoll aussehen ließ. Aber ihre Haut war so hell, das hatte die Heimleiterin noch nie gesehen. Sie wirkte fast so weiß wie Porzellan, aber das Kind sah dennoch absolut gesund aus. Und sie konnte auf jeden Fall einschätzen, ob ein Kind einen Arzt brauchte oder nicht. Nicht dass ein Arzt da gewesen wäre, wenn sie denn einen brauchten. Der Ort war einfach zu klein und zu ärmlich, um für einen Arzt interessant zu sein. Supai hatte fast weniger Einwohner, als Kinder in dem Waisenhaus waren.
Die Indianer nicht mitgezählt hatte der Ort etwas über 300 Einwohner, vor dem Krieg waren es etwas über 400 gewesen. Carol Duncan kannte jeden Einzelnen. Rund um den Ort hatte es früher viele verschiedene Indianerdörfer gegeben, doch jetzt, nach diesem verheerenden Krieg gegen die Indianer, waren die Meisten in die Reservate zurückgedrängt worden. Einzelne Indianer wehrten sich noch dagegen und streunten wild umher, aber die Soldaten machten Jagd auf sie und wollten auch die letzten freien Rothäute in die Reservate drängen. Immer wieder kamen Soldaten durch den Ort und befragten die Menschen, ob sie wilde Indianer gesehen hätten, doch hier in der Nähe gab es ein Reservat, von dem aus viele indianische Frauen Waren auf dem örtlichen Markt verkauften. Gehörte das Mädchen zu ihnen? Doch der Name sprach gegen diese Theorie, er klang eher nordisch, vor allem die Schreibweise. Auch wenn das Aussehen zumindest zum Teil für die Indianer-Theorie sprach. Es war verwirrend.
Was sollte sie nun mit dem Baby machen? War es ein Indianerkind, so würde sich niemand groß kümmern, was mit ihr wurde. Doch ihre Haut sah so untypisch für diese Rasse aus, dass sich die Heimleiterin unsicher war.
In dem Moment öffnete das Mädchen die Augen und sah sie an. Die Augen waren dunkel, fast schwarz. Solche Augen hatte Carol Duncan noch nie bei einem Baby gesehen. Die Kleine musste langsam Hunger haben, aber sie weinte nicht. Schnell machte die Heimleiterin eine Flasche fertig. Sie musste unbedingt sehen, dass sie eine Leihmutter für das Baby fand, da sie selber mit ihren fünfzig Jahren schon aus dem Alter raus war, in dem sie Kinder gehabt hatte, sie konnte keine Milch geben. Ihre eigenen Kinder waren schon erwachsen, ihre Töchter beide verheiratet und weg gegangen in die Städte im Westen, ihr Sohn war in den Krieg gezogen und bisher nicht wiedergekommen. Sie befürchtete, dass er nicht mehr lebte, ihr Jüngster. Das Abbild seines Vaters und sein ganzer Stolz.
Als die Kleine ihre Flasche trank, drängte sie den Gedanken an ihren Sohn zurück. Sie brauchte nun ihre ganze Aufmerksamkeit für das Mädchen. In einer halben Stunde würden auch die anderen 45 Kinder aufstehen und dann war es vorbei mit der momentanen Ruhe. Bis dahin wollte sie die kleine Kristina versorgt haben, damit sie sich um die anderen Kinder kümmern konnte. Sie hatte zwar zwei Mädchen, die ihr halfen, aber Susannah und Deborah kamen immer nur für ein paar Stunden tagsüber. Sie waren von ihren Eltern geschickt worden, um zu lernen, wie man Kinder erzog. Sie müssten jeden Moment kommen, um das Frühstück mit ihr zusammen vorzubereiten. Die größeren Kinder hatten dabei ihre eigenen Aufgaben. Jeder musste mithelfen, sonst konnten sie nicht zurechtkommen. Die meisten Bewohner von Supai halfen ihr, wo sie konnten, spendeten Lebensmittel, Brennmaterial und Kleidung. Dennoch war sie zumeist auf verlorenem Posten. Vor vielen Jahren, als ihre Kinder anfingen, eigene Wege zu gehen, hatte sie dieses Waisenhaus gegründet, damals noch gemeinsam mit ihrem Mann, der kurz danach in den Krieg ziehen musste und nicht zurückkam. Sie hatten Kindern ohne Eltern eine Perspektive bieten wollen, doch im Moment fühlte sie sich ein wenig überfordert mit der Masse an Kindern. Ausgelegt war das Haus auf fünfzehn bis zwanzig Kinder, gerade hatte sie mehr als doppelt so viele. Es war schwer, sie gut zu versorgen, es gab selten wirklich genug zu essen und Kleidung hatte jedes Kind auch nur wenig. Und doch wies sie kein Kind ab, das Hilfe brauchte. Sie konnte es einfach nicht.
Kristina hatte inzwischen die Flasche leergetrunken und nun wurde sie unruhig. Wahrscheinlich war ihre Windel voll. Carol Duncan brachte sie in den Waschraum, wo die ältesten Kinder schon dabei waren, sich zu säubern. Erstaunt sahen sie zu dem Baby in den Armen ihrer Heimleiterin. „Das ist Kristina. Ich habe sie heute Nacht vor unserer Tür gefunden. Rebecca, Emma, ich werde eure Hilfe brauchen bei ihrer Versorgung.“, erklärte sie den beiden ältesten Mädchen.
Die beiden 13-jährigen Mädchen nickten ihr zu. Sie waren gezwungen, sehr erwachsen zu sein, konnten ihre Kindheit nicht genießen. Sie waren in ihrem Heim, seit sie sechs Jahre alt waren. Beide hatten ein ähnliches Schicksal hinter sich, waren aber nicht verwandt miteinander. Sie waren Kinder von einem weißen Vater und einem indianischen Mädchen. Diese Kinder wurden oft verstoßen und kaum einer wusste, wer der Vater war. Die meisten Männer vergnügten sich mit den roten Mädchen und ließen sie anschließend alleine. Wenn dann ein Baby geboren wurde, hatte es selten eine Chance. Das vermutete Carol Duncan auch bei Kristina, aber der Brief, den sie bei dem Mädchen gefunden hatte, deutete auf einen anderen Hintergrund hin. Die wenigsten Indianer konnten schreiben, vor allem nicht in Englisch. Die Frauen der Indianer noch weniger, die meisten von ihnen konnten noch nicht einmal Englisch sprechen. Auch der Name des Mädchens passte nicht dazu. Sie würde mit dem Sheriff reden. Sheriff Carlsen und vielleicht auch Mayor Grant würden sicher einen Weg wissen, um ihr zu helfen. Sobald sie diesen Entschluss gefasst hatte, war sie ruhiger.
Direkt nach dem Frühstück, das sie immer mit den Kindern zusammen einnahm, gab sie das Baby in die Obhut von Rebecca und Emma. Die beiden Mädchen machten das nicht zum ersten Mal, sie wussten, wie sie mit einem Baby umgehen mussten. Dann ging sie die kürzeste Strecke bis zum Rathaus, direkt am Fluss entlang. Es war ein Gebäude wie jedes andere in Supai, aber es war eines von zwei Häusern, an denen die amerikanische Flagge hing. Das andere war das Büro des Sheriffs. Mayor Grant hatte wie immer ein offenes Ohr für die Heimleiterin. Er konnte ihr nicht viel helfen, aber was er tun konnte, das tat er auch. Er rief sofort den Sheriff hinzu, der ein paar Minuten später kam. In einer Kleinstadt wie Supai gab es relativ wenig für ihn zu tun. Sie erzählte ihnen kurz die Geschichte, wie sie das Mädchen gefunden hatte, und zeigte Beiden den Brief.
„Ich stimme ihrer Theorie zu, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass eine Indianerin die Verfasserin dieses Briefes ist, aber vielleicht war die Mutter trotzdem eine. Sie kann ja immerhin Hilfe gehabt haben. Ich würde das Kind gerne einmal sehen.“, erklärte Mayor Grant, als er die wenigen Worte gelesen hatte.
„Auch ich denke, es könnte dennoch eine Indianerin gewesen sein. Aber ihre Erzählung hat mich ebenso neugierig gemacht. Wenn sie schon sagen, dass das Kind ungewöhnlich aussieht. Und sie haben es wirklich schon mit vielen Kindern zu tun gehabt.“, stimmte Sheriff Carlsen zu.
„Vielleicht haben sie beide gleich Zeit, mit mir zu kommen?“, fragte Mrs. Duncan. „Dann könnten wir vielleicht auch kurz darüber sprechen, dass ich Hilfe bräuchte, damit das Dach wieder dicht wird, der letzte Sturm hat Spuren hinterlassen.“
„Natürlich, Mrs. Duncan. Wir werden sehen, was wir da tun können. Ich werde mit den Männern im Ort reden, es findet sich sicherlich eine Lösung. Auch wenn die Kinder niemanden haben, wir müssen dennoch tun, was wir können. Die Kinder können schließlich nichts für ihre Eltern. Sie werden es nicht leicht haben in ihrem Leben, aber wir werden alles tun, um ihnen den Start dennoch zu erleichtern. Sie tun so viel für diese armen Kinder, da ist es auch an uns, sie zu unterstützen!“, versprach Mayor Grant.
Mrs. Duncan nickte ihm zu. Solche Versprechungen hatte sie schon viele von ihm bekommen. Doch ob sie dann die Hilfe auch bekam, war oft mehr als fraglich. Ihr war klar, dass es in einem so kleinen Ort nicht einfach war, als Bürgermeister zu bestehen, dennoch erhoffte sie sich mehr Hilfe, als sie bisher gehabt hatte, die Kinder hatten sich das wirklich verdient. Sie würden es nie einfach haben in ihrem Leben, dennoch hatten auch sie ein Recht auf eine unbeschwerte Kindheit. Doch alleine konnte sie das den Kindern nicht bieten. Es überstieg einfach ihre Möglichkeiten. Schnell gingen sie zu dritt den Weg auf den Hügel zurück zum Waisenhaus. Mrs. Duncan ließ sich die kleine Kristina von Rebecca geben und brachte sie in den Aufenthaltsraum, wo die Kinder normalerweise zum Essen saßen, oder bei schlechtem Wetter lernten und spielten. Dort blickten Mayor Grant und Sheriff Carlsen sie genau an.
„Wenn ihre schwarzen Haare nicht wären, würde ich ganz sicher sagen, dass sie kein Indianerkind ist. Aber die Haare sehen wirklich indianisch aus. Und auch die Augen sind dunkel wie bei den Indianern. Aber die Haut, sie sieht aus wie jemand aus dem nördlichsten Europa.“, überlegte Mayor Grant nach ein paar Minuten.
„Ja, die Hautfarbe irritiert auch mich, ich habe noch nie so helle Haut gesehen. Das ist ja fast wie ein Albino. Ich habe mal einen Mann gesehen, der war ein sogenannter Albino, aber er hatte rote Augen.“, wusste Sheriff Carlsen.
„Ich glaube nicht, dass sie ein Indianerkind ist, aber sicher bin ich mir nicht.“, erklärte der Bürgermeister schließlich.
Kristina hatte sie die ganze Zeit aus großen Augen angeblickt, als wüsste sie, dass hier etwas Wichtiges stattfand. Mrs. Duncan war fasziniert von diesem Baby, wie sie noch nie eines erlebt hatte. Sie würde Kristina auf jeden Fall hierbehalten. Der Sheriff entschied, dass er eine Vermisstenmeldung herausgeben und nach der Mutter suchen werde, war sich aber sicher, dass das wohl nichts bringen würde. Sie war schließlich bewusst vor dem Kinderheim ausgesetzt worden. Also war klar, dass dieses Mädchen das neue Kind von Mrs. Duncan wurde.