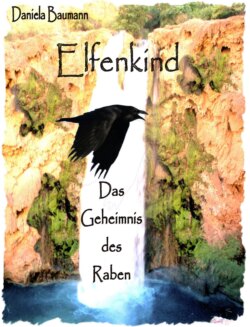Читать книгу Elfenkind - Daniela Baumann - Страница 7
5. Lagerleben
ОглавлениеAm nächsten Morgen verließen die Männer nach dem Frühstück das Lager in Dreier-Gruppen, sie wollten die nähere Umgebung erkunden. Nur die beiden Ältesten blieben zurück, sowie Kristina mit den beiden Frauen. Diese drei machten sich daran, das Lager auf Vordermann zu bringen, alle Arbeiten zu machen, die gestern nicht mehr erledigt werden konnten. In dieser Zeit saßen die beiden Ältesten, Ma’ee und Sáni, am Flussufer und fischten erneut. Die anderen Männer hofften, nicht nur die Umgebung erkunden zu können, sondern auch etwas zu finden, das sie jagen konnten. Sollten sie länger hierbleiben, wollten sie auch wieder mit Ackerbau beginnen, aber das war nur dann sinnvoll, wenn sie bis zur Ernte auch an einem Ort bleiben konnten. Aufgrund der Flucht war es ihnen in den letzten Jahren nicht möglich gewesen, so zu leben, wie sie es gewohnt waren.
Kristina, oder Yas, wie sie hier eigentlich nur genannt wurde, hatte zunächst die Wasserbehälter aufgefüllt, dann trockenes Holz gesammelt und an einem Platz nahe der Feuerstelle gestapelt. Anschließend half sie Mósí, die Zelte auszufegen. Dazu hatten sie ein wenig Reisig fest um einen längeren, geraden Stock gebunden. Der Boden der Zelte bestand aus hastig fest getrampelter Erde. Sie stampften noch eine Weile darauf herum, um die Erde noch fester zu bekommen, damit es nicht gleich aufweichen konnte, sollte es regnen und die Erde sich voll Wasser saugen. Als sie damit fertig waren, brachten die beiden Ältesten einige Fische und Mósí begann, sie auszunehmen, während Shadi ein Gitter aufbaute, damit sie die Fische trocknen konnte. Die Achtjährige folgte ihren Handgriffen dabei immer mit den Augen, wollte scheinbar alles lernen, was sich ihr zeigte.
„Yas, es ist gut, du kannst ein wenig spielen, du hast sehr fleißig geholfen.“, lächelte Shadi, als das Mädchen helfen wollte. „Bleib aber in der Nähe, damit du dich nicht verlaufen kannst. Spätestens wenn es dämmert, solltest du wieder hier sein.“ Sie nickte strahlend und lief davon, in den Wald hinein. Wie immer war sie barfuß unterwegs und Shadi überlegte, dass sie ihr zur Sicherheit aus dem nächsten Leder ein paar Mokassins machen sollten. Sie brauchte auch wenigstens einen Satz Wechselkleidung, konnte nicht immer in den gleichen Sachen herumlaufen, diese Leggins und die Tunika, die sie trug, würden sicher nicht sehr lange halten. Sie seufzte lautlos, ihr waren durchaus die Blicke ihres Bruders aufgefallen. Die Kleine wirkte auch auf sie vertraut. Sie kannte die Geschichte ihres Bruders so gut wie kaum ein Anderer, aber er wusste, sie war verschwiegen. Wahrscheinlich konnte auch nur sie erkennen, wie sehr es Gaagi innerlich zerriss, seit die Kleine aufgetaucht war. Einerseits schien er sich zu ihr hingezogen zu fühlen, andererseits erinnerte sie ihn an SIE, das konnte er sicherlich nur schwer ertragen. Und doch erschien er ihr nun lebendiger als all die Jahre seither. Lebendiger, aber auch gedankenverlorener als ohnehin schon in den letzten Jahren. Shadi nahm sich vor, auf die Beiden zu achten und notfalls einzugreifen. Sie wollte verhindern, dass ihr Bruder noch mehr verletzt würde. Aber sollte das Mädchen ihm gut tun, dann würde sie dafür sorgen, dass sie mehr Zeit miteinander hatten. Shadi machte sich gleich daran, Leggins und Tunika für Yas aus weichem Leder zu machen, als die Fische auf dem Gestell hingen.
Kristina ahnte von diesen Gedanken nichts, sie lief am Fluss entlang durch den Wald. Obwohl er dicht bewachsen war, konnte man doch gut laufen, das Unterholz war erstaunlich offen. Es wirkte, als würde sich jemand um den Wald kümmern. Der Boden war moosbewachsen, an anderen Stellen sah sie Pilze, Farne und vereinzelt Buschwerk, hauptsächlich Himbeeren, Brombeeren und verschiedene andere Beeren, die sie nicht kannte. Nahe dem Flussufer, an sonnigen Stellen, wuchsen Obstbäume, weiter drinnen im Wald waren es eher Nadelbäume. Es roch so erdig, ein bisschen modrig, aber vor allem lebendig. Die Vögel zwitscherten fröhlich, ab und zu hörte sie etwas davon huschen, wahrscheinlich Eichhörnchen oder Hasen. Einmal sah sie sogar ein Reh aus der Ferne. Sie merkte nicht, dass der Rabe immer in ihrer Nähe blieb, spürte aber durchaus die beobachtenden Augen auf sich. Doch das kannte sie bereits und ließ sich dadurch nicht stören. Als sie Hunger bekam, zupfte sie einige Beeren und pflückte einen Apfel von einem der Bäume. Die Früchte an den Bäumen und auch den Sträuchern erschienen ihr viel größer, als sie es gewohnt war. Selbst die Fische gestern Abend waren größer gewesen, als sie es vom Fluss nahe dem Waisenhaus her kannte. Die ganze Welt hier fühlte sich anders an, auch wenn Kristina es nicht bestimmen konnte, was genau anders war. Nur eines war sicher: Sie waren in einer völlig anderen Welt gelandet. Ohne es genauer benennen zu können, spürte sie es einfach.
Sie aß gerade den Rest ihres Apfels und ließ die Füße im Fluss baden, als sie am Ufer ein wenig flussaufwärts jemanden aus dem Wald kommen sah. Es war Gaagi und er war alleine unterwegs. Da sich Kristina nicht sicher war, ob er ihre Gesellschaft wünschte oder nicht, sah sie ihn zwar an, blieb aber auf dem Stein sitzen. Gaagi zögerte eine Weile, kam dann aber zu ihr. „Hast du etwas Essbares gefunden?“, erkundigte er sich bei dem Mädchen. Kristina nickte nur, sie spürte, dass er sich nicht richtig wohlfühlte. Daher schwieg sie, und auch er sagte nichts weiter, setzte sich einfach auf einen weiteren großen Stein und reichte ihm einen Apfel. Gemeinsam blickten sie in das schnell fließende Wasser und hingen ihren Gedanken nach. Das Mädchen genoss einfach nur das Leben um sich herum, während die Gedanken des Häuptlings immer weiter um SIE kreisten. Egal wie sehr er sich dagegen wehrte, es half nicht.
„Gehen wir ein Stück.“, entschied Gaagi schließlich und stand auf. Sie drangen tiefer in den Wald ein und fanden sich bald auf einer Lichtung wieder. Strahlender Sonnenschein schien sie in pures Licht zu tauchen, es wirkte so unnatürlich. Die Blumen, die ganz anders aussahen als alle, die Kristina in ihrem Leben gesehen hatte, leuchteten, als hätten sie eine eigene Lichtquelle. Jede einzelne Pflanze schien in der Sonne zu baden. Schmetterlinge flatterten überall, wo man hinsah, Bienen und Hummeln erfüllten die Luft mit einem leisen Summen, und einige kleine Vögel, die Kolibris sehr ähnlich sahen, schwirrten ebenfalls von Blüte zu Blüte. Der Indianer und das Mädchen standen ruhig am Rande der Lichtung, wollten diesen zarten Tanz nicht unterbrechen, indem sie einfach in dieses Paradies eindrangen.
Gaagi sah sich genauer um. Diese Blumen, diese Vielfalt und solche Arten hatte er noch nie gesehen, und doch schienen sie ihm bekannt. Er hatte die Erinnerung tief in sich vergraben, aber er hatte sie doch schon einmal gesehen, wenn er sich auch nicht bewusst daran entsinnen konnte. Doch an den Duft konnte er sich erinnern, das roch wie SIE. Plötzlich wollte er nur noch weg, weg von dieser Lichtung, weg von Yas, weg von der Erinnerung, die ihn vollkommen überwältigte. Alles, was er in sich vergraben hatte, drängte zurück an die Oberfläche. Er konnte es nicht mehr ertragen und drehte sich einfach um, rannte leichten Fußes in den Wald zurück. Jetzt musste er eine Weile alleine sein, konnte nicht mehr in ihrer Gegenwart bleiben, die Erinnerungen waren zu viel für ihn. Erst nach etlichen Minuten hielt er wieder an, er hatte eine andere Lichtung erreicht. Ein kleiner Zufluss zum Bach nahm hier seinen Ursprung, sprudelte einfach aus der Erde. Gaagi setzte sich daneben, trank einige Schlucke und schloss dann die Augen, um zur Ruhe zu kommen.
Langsam beruhigten sich sein rasendes Herz und seine hektische Atmung, was auch die Gedanken zur Ruhe kommen ließ. Er konzentrierte sich nur auf die Atmung und den Herzschlag, bis er ganz ruhig war. Jetzt schlug er seine Augen wieder auf, sah sich um. Die Gerüche, die auf ihn einströmten, waren fremd und bekannt gleichzeitig. Diese Blumen, die er gerade vor sich sehen konnte, wie sie sich sanft in der leichten Brise wiegten, das waren die gleichen, die SIE um ihren Kopf geschlungen hatte, als er SIE das erste Mal gesehen hatte. Zarte, dunkelblaue Blütenblätter, die zu mehreren um den langen Stiel wuchsen; und diese Blume mit den vier länglichen roten Blütenblättern und den gelben Sprenkeln in ihrer Mitte, die in großer Zahl seitlich von ihm wuchs, hatte er schon gesehen und erkannte auch den Geruch sofort wieder, es war der von IHR. Obwohl der Gedanke an SIE wehtat, konnte er doch nicht umhin, zu erkennen, wie sehr SIE in diese Welt gepasst hätte. Oder war SIE gar aus dieser Welt gekommen? Damals hatte er es nicht verstanden, aber es würde passen. SIE hatte gesagt, dass sie von weither und doch aus der Nähe käme, ein Ort, den niemand finden konnte, obwohl er nahebei war. Das alles traf auf diesen Ort zu, wo immer sie genau waren.
Gaagi ahnte, dass es in dieser Welt noch mehr geben würde, was ihn an SIE erinnern würde. Er durfte sich von den Erinnerungen nicht mitnehmen lassen, sein Stamm brauchte ihn, auch wenn sie nur so wenige Freie waren. Ma’ee und Sáni konnten die Männer nicht alleine führen. Dieses Mädchen, das er Yas nannte, weil er ihren Namen kaum aussprechen konnte, hatte sie hierher gebracht, und nun mussten sie sehen, wie sie weitermachten. Welche Entscheidung sollte er treffen? Er wusste es einfach nicht. Noch nie hatte er so lange gezögert, eine Ansage zu machen. Seine Männer wollten wissen, ob sie hierbleiben oder weiterziehen würden. Blieben sie hier, könnten sie eine Wache an den Felsen stellen und abwarten, ob es wieder einen Durchgang in ihre Welt geben würde. Gingen sie weiter, könnten sie ein völlig neues Leben beginnen, vielleicht fanden sie auch hier Menschen, mit denen sie in Frieden und in Freiheit leben konnten. Möglicherweise hatte er hier eine Chance, seine Suche erfolgreich zu beenden, diese Suche, die ihn immer weiter antrieb.
Aber, wenn er vollkommen ehrlich zu sich selber war, wollte er nicht hierbleiben. Hier, wo alles an SIE erinnerte, wo er IHR so nahe war. Und doch war SIE so fern wie nie. Der Schmerz zerriss ihn beinahe, und doch sah man kaum ein Anzeichen dafür an ihm, nur die Augen umwölkten sich ein wenig. Wenn man ihn nicht genau ansah, konnte man es leicht übersehen.
Er musste dringend noch einmal mit Ma’ee und Sáni reden. Der Rat der beiden Ältesten war ihm viel wert. Bisher hatte er sich immer darauf verlassen können, sie waren viel weiser und erfahrener als er selber. Und doch hatten sie keine Ambitionen, seinen Platz einzunehmen und ihre Gruppe anzuführen. Auch er selber hatte es eigentlich nicht gewollt, aber sein Vater war der letzte freie Häuptling seines Stammes gewesen und so war ihm diese Rolle zugefallen, als sie sich den Soldaten entzogen hatten und in die Freiheit geflohen waren. Nur sehr Wenige hatten es geschafft, und diese Wenigen hatte er um sich geschart. Obwohl er weg von seinen Erinnerungen wollte, Einsamkeit suchte, konnte er damals die Männer nicht alleine lassen. SIE war verschwunden, hatte ihn zurückgelassen, und er hatte die Einsamkeit gesucht.
Doch die Männer hatten sich um ihn geschart, da er der Sohn ihres vorherigen Häuptlings war, der einzige noch lebende Sohn, wie es schien. Seine älteren Brüder waren nicht mehr zurückgekehrt. So war er zu seinem kleinen Stamm gekommen. Lange hatten sie gesucht, ob es noch andere geschafft hatten, aber nach einer Weile hatten sie niemanden mehr gefunden. Nur Mósí, die trauernd bei ihrem toten Mann gesessen hatte. Aditsan, ein junger Krieger ihres Stammes, der kaum aus der Ruhe zu bringen war – das hatte ihm auch den Namen Aditsan, Zuhörer, eingebracht – war hinterrücks erschossen worden und verblutet. Seine Frau Mósí, die aus einem anderen Unterstamm der Navajo stammte, hatte mehrere Tage an seiner Seite ausgeharrt, bis Shadi beim Pilze und Beeren suchen auf sie gestoßen war. Sie hatte sie mitgebracht. Seither zog sie mit ihnen herum, schon seit mehreren Jahren.
Da es langsam dämmerte, machte sich Gaagi nun auf den Rückweg in ihr Lager. Er ging zum Fluss und von dort aus war es nicht mehr sehr weit bis zu ihren Zelten. Nach einer knappen Stunde war er dort angekommen und sah bereits das Feuer brennen, an dem Fische und einige Fleischstücke brieten, der Duft verriet ihm außerdem, dass die Frauen wohl etwas gefunden haben mussten, aus dem sie Fladenbrot machen konnten. Es buk auf mehreren, vom Feuer geheizten Steinen. Etwas weiter weg hatten sie ein Netz gespannt, an dem Fleisch und Fisch zum Trocknen hing, gesichert hatten sie es mit Zweigen und Steinen, damit keine Tiere an ihre Vorräte kamen. Die Männer kamen nach und nach alle zurück, Ma’ee und Sáni saßen bereits ein wenig abseits und rauchten Pfeife, die Krieger setzten sich zu ihnen, sobald sie den Staub des Tages im Fluss abgewaschen hatten. Kein unnötiges Wort wurde gesprochen, bevor nicht der Häuptling den Rat eröffnete. „Was habt ihr gefunden?“, wollte Gaagi wissen, nachdem er sich gesetzt und in Ruhe seine eigene Pfeife angesteckt hatte.
„Kaum Leben außer einigen kleineren Tieren wie Hasen und Rehe, keine Raubtiere, auch keine Spuren oder Hinweise darauf. Hier gibt es viele Bäume, die reichlich Frucht tragen, aber auch viele, die gerade in der Blüte sind. Insekten und Vögel fliegen in der Luft, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, Kolibris und viele mehr, die ich nie zuvor gesehen habe, aber alles wirkt friedlich, ich konnte keine Gefahren entdecken.“, begann Doli. Sein Name, blauer Vogel, kam daher, dass er kurz nach dem Beginn ihres gemeinsamen Lebens einen stahlblauen Vogel gefunden hatte, der verletzt gewesen war, und ihn gesund pflegte. Er liebte Tiere über alles und tötete nur, wenn es unbedingt sein musste. Besonders gut verstand er sich daher mit Yas, obwohl er selber kein Wort Englisch konnte und sich mit Händen und Füßen mit ihr verständigen musste. Doch das würden sie nun ändern, Yas sollte ihre Sprache lernen. Doli war eher durch Zufall bei ihnen gelandet, sie hatten ihn gefunden, da war er noch ein namenloser Junge eines befreundeten Stammes gewesen, der auf der Suche nach einem Namen von Soldaten gejagt wurde und bei ihnen Zuflucht fand. Drei Tage später hatte er den Vogel gebracht, da stand sein Name fest.
„Keiner von uns fand etwas, das auf Gefahren hindeutet.“, ergänzte T'iis, oder auch Pappel. „Aber viele uns unbekannte Pflanzen und Tiere. Wir sollten vorsichtig bleiben.“
„Der Durchgang zu unserer Welt blieb verschlossen.“, berichtete Tsiishch'ili, der so hieß, weil sein Haar untypisch lockig war. „Es ist nichts erkennbar, dass er sich wieder öffnen wird. Aber auch nichts, dass er jemals überhaupt vorhanden war. Dieser Weg scheint uns versperrt.“
Das bedeutete, Gaagi musste keine Entscheidung treffen? Einerseits erleichterte ihn das, andererseits bedeutete es, sie mussten das Unbekannte entdecken und sehen, wie sie hier leben konnten. Sie mussten sich anpassen, genau das, was sie mit ihrer Flucht vor den Soldaten eigentlich vermeiden wollten, denn sie wollten einfach nur ihr gewohntes Leben weiterführen, ihre Traditionen und Rituale beibehalten. Doch die Weißen hatten es ihnen verboten und angefangen, sie in Reservate zu sperren, wo sie nach den Regeln der Weißen leben sollten. Da waren sie geflohen, um ihr Leben in Ruhe weiterführen zu können, doch Ruhe war ihnen seither nicht gegönnt gewesen. In den letzten etwa neun Jahren waren sie rastlos umhergezogen. Die Zeit, die sie in der Nähe von Supai verbracht hatten, war unwahrscheinlich lange gewesen, mehrere Monde war ihr Lager dort gestanden, ohne dass sie entdeckt worden waren. Außer von einigen Kindern, die sie nie verraten hatten. Und Yas hatte sie hierher gebracht, in Sicherheit vor den Soldaten, aber waren sie nun wirklich sicher? Konnten sie hierbleiben, ohne dass wieder etwas passierte? „Sáni, Ma’ee.“, sprach Gaagi die beiden Ältesten an. „Was ist euer Rat an uns?“
„Wir sollten eine Weile hierbleiben und in dieser Zeit die Gegend noch genauer erforschen und unsere Vorräte aufstocken.“, erwiderte Sáni nach einem längeren Schweigen, in dem er sich mit Ma’ee durch Blicke verständigte. „Sollte der Winter auch in dieser Welt kommen, müssen wir vorbereitet sein. Vieles, was sich mir zeigt, ist so fremd, dass es nur eine andere Welt sein kann, auch der Weg, auf dem wir hierher kamen. In meiner Jugend hatte ich eine Vision, dass ich in einer anderen Welt leben werde, bevor ich in die ewigen Jagdgründe einziehen kann. Ich habe den goldenen Wasserfall gesehen und noch Einiges, was ich hier sicher auch bald sehen werde. Nach dieser Vision werden wir hier sicher sein vor denen, die wir fliehen mussten. Das Mädchen ist absolut vertrauenswürdig, ich habe eine Ahnung, dass sie noch mehr bedeutet, als uns bisher klar ist. Seit sie bei uns ist, muss ich immer wieder an die Legende von Ashkii-dighin, dem heiligen Kind, denken. Ob sie es ist, da bin ich mir nicht sicher, meine Überzeugung war bisher, dass es ein Krieger sein wird, aber davon ist in der Legende nicht die Rede. Einzig unsere Traditionen haben uns beigebracht, dass nur Männer zu solchen Taten in der Lage sind, aber warum sollte dieses Kind das nicht können? Sie ist anders als alle Kinder, die ich bisher erlebt habe. Vielleicht führt sie uns in die Freiheit, vielleicht auch nicht. Wir werden es nur wissen, wenn wir ihr die Chance dazu geben.“
„Auch mein Gefühl sagt mir, dass sie etwas Besonderes ist, aber was genau, das müssen wir abwarten.“, fügte Ma’ee hinzu.
„Gut, dann ist es entschieden, wir werden erst einmal hier bleiben. Sollten wir einen Lagerplatz finden, der besser geeignet ist, werden wir das Lager hier abbauen.“, entschied Gaagi und stand auf, um sich etwas zu Essen zu holen.
Auch die nächsten Tage verliefen in etwa genauso, sie erkundeten die Gegend und besprachen am Abend ihre Entdeckungen. Einen anderen Lagerplatz fanden sie am zehnten Tag, eine verzweigte Höhle, die sie gut ihren Bedürfnissen anpassen konnten, und die ebenfalls in der Nähe des Flusses lag. Es war Zufall, dass sie darauf stießen, denn Tsiishch'ili hatte auf einer Jagd nach einem hasenartigen Tier die Zeit vergessen und musste sich einen Platz zum Übernachten suchen. Dabei entdeckte er ein flaches Uferstück am Fluss, in dessen Nähe eine geräumige Höhle war. Er schlief darin und stellte fest, dass sie trocken und angenehm warm war, dabei aber gut durchlüftet, ohne dass es hinein regnen konnte. Da die Nacht, in der er dort schlief, verregnet war, hatte er den idealen Test gehabt, und so berichtete er am Abend von seiner Entdeckung. Am nächsten Morgen brachen Gaagi, Ma‘ee und Manaba auf, ließen sich von Tsiishch'ili die Höhle zeigen. Einen Tag später zogen sie um.
Kristina hatte es nach der ersten Nacht im Zelt mit den beiden Frauen vorgezogen, im Freien unter einem Baum zu schlafen. Sie hatte auch im Kinderheim eher selten die Nacht in ihrem Bett verbracht, es hatte sie immer wieder ins Freie gezogen, und meist gab sie dem Drang in ihrem Inneren nach. Die Navajo akzeptierten ihre Einstellung und ließen sie draußen schlafen, gaben ihr nur eine zusätzliche Decke. Frieren sollte sie nicht. Nach dem Aufstehen half sie Mósí und Shadi, das Frühstück für die Männer zu richten und sobald diese unterwegs waren, kümmerte sie sich gemeinsam mit ihnen um die anfallenden Arbeiten. Dabei plauderten die Frauen fröhlich mit ihr und sie lachten viel. Schnell lernte das Mädchen die ersten Worte der ihr fremden Sprache und verstand bald, was die Männer untereinander besprachen. Beim Umzug musste ihr diesmal niemand sagen, was zu tun war, sie packte wie selbstverständlich mit an und schnell war das Lager abgebaut.
Die Ponys zogen die Zelte und einen Teil der Vorräte, der Rest wurde unter allen Mitreisenden verteilt. Normalerweise würden die Männer nichts tragen, erklärte Shadi Kristina, aber da sie nur zwei Frauen und ein Mädchen waren, mussten die Männer mit anpacken, die Ponys konnten nicht noch mehr leisten. Es war eine Notwendigkeit, vor allem auf ihrer Flucht gewesen, damit sie so schnell wie möglich vor den Soldaten in Sicherheit waren, aber auch jetzt war es wichtig, wenn die Frauen nicht mehrmals laufen sollten. Dann hätten sie das Lager niemals an einem Tag verlegen können. So aber waren sie am späten Abend fertig und konnten wieder in ihren Zelten schlafen. Vor der Höhle bauten sie ihre Zelte auf, in der Höhle konnten sie nun Vorräte lagern und sich gemeinsam um ein Feuer im vorderen Teil setzen. Sie konnten auch im Inneren schlafen, wenn es zu kalt werden sollte, aber bisher zogen sie die Zelte vor, da sie dort einfach mehr frische Luft hatten. Im Inneren der Höhle stand die Luft eher still, auch wenn immer genug Frischluft hereinkam.
Einige Tage, nachdem sie das Lager verlegt hatten, war die Kleidung für Yas fertig. „Hier, Yas, nimm diese Kleidung für dich.“, gab Shadi sie ihr nach dem Frühstück, als die Männer weg waren. „Deine Sachen sind zu dünn, wenn der Winter kommt. Mósí und ich machen dir noch weitere Kleidung, sobald wir wieder genug Häute haben.“
„Danke, Shadi!“, lächelte das Mädchen. „Das ist wunderschön, und so weich. Vielen Dank!“ Schnell zog sie sich um und rief dann den Raben, er solle sie ansehen, welche tollen Sachen sie bekommen hatte. Auch hier war der Rabe wieder zu ihnen gestoßen. Seit sie in dieser Welt waren, kam er Kristina wieder näher, blieb aber weiterhin außerhalb ihrer Reichweite. Er nistete sich oben auf dem Felsen ein, der die Höhle bildete. Das Mädchen gewöhnte sich daran, ihn jeden Morgen zu begrüßen, wenn sie aufstand. Der Rabe antwortete mit einem Krächzen und flog dann meist davon, kam aber spätestens am Abend wieder. Wenn Kristina tagsüber Holz oder Beeren sammelte, dann hörte sie ihn immer wieder über sich krächzen. Er war niemals weit weg. Einmal, im letzten Winter, hatte sie Mrs. Duncan davon erzählt, die ihr daraufhin etwas anvertraut hatte: „In der Nacht, als du vor dem Haus abgelegt wurdest, da saß ein Rabe auf dem Treppengeländer. Er hat mich genau beobachtet, jeden meiner Handgriffe. Und erst, als ich dich mit nach drinnen genommen habe, ist er weggeflogen. Ich hatte das Gefühl, er wollte sichergehen, dass du gut aufgehoben bist.“ Auch jetzt hatte sie wieder das Gefühl, der Rabe passe auf sie auf. Den anderen Kindern wäre das lächerlich erschienen, aber Doli, mit dem sie darüber geredet hatte – so gut es eben ging mit den wenigen Wörtern, die sie bisher kannte – hatte ihr bestätigt, dass es sein konnte. Er meinte wohl, dass die Geister der Vorfahren in die Tiergestalten schlüpfen konnten und so auf ihre Nachkommen achten. Das war der Glaube der Navajos, sie wurden von ihren Ahnen geschützt und würden daher niemals schlecht über diese reden, ansonsten verlören sie ihren Schutz. Diese Schutzgeister galten als heilig, keiner würde Tieren, in denen er Geister vermutete, etwas antun.
Seit sie in der Höhle lebten, setzten sie sich abends ans Feuer. Untypisch war dabei, dass auch die Frauen mit am Feuer sitzen durften. Oftmals wurde nur wenig gesprochen, aber sie teilten etwas Anderes: Nähe. Kristina fühlte sich so wohl in ihrer Gesellschaft wie nie zuvor. Das hatte sie bisher nur bei Steven gekannt. Er war im Waisenhaus ihr einziger Freund gewesen, hatte mit ihr gesprochen und sie mit zu den Spielen genommen. Aber hier galt sie genauso viel wie jeder andere. Mehr und mehr verstand sie auch, was erzählt wurde, wenn sie über die alten Legenden und Geschichten sprachen. Ihre Sprachkenntnisse verbesserten sich von Tag zu Tag, und bald konnte sie auch längere und komplexere Unterhaltungen in der Sprache ihrer neuen Familie führen , denn als das sah sie die Indianer. Vor allem mit Doli, der noch relativ jung, gerade mal etwa zwanzig Jahre, war. Mósí war nicht viel älter, dann kam bereits Gaagi, der trotz seines jungen Alters von nur 29 Jahren der Häuptling war. Sáni war der Älteste, er zählte bereits fast 100 Sommer, gefolgt von Ma’ee, dem Wolf, der etwas über 80 Sommer alt war. Die meisten der Krieger waren zwischen 35 und knapp 50 Jahren.
Wieder einmal saßen sie am Feuer. Sie lebten nun schon etwa einen Monat in der Höhle. Gaagi war still geworden, noch stiller, als er vorher gewesen war. Er sprach nur noch selten, nicht mehr als absolut notwendig. Dennoch war er abends der Letzte, der Schlafen ging und morgens der Erste, der wach war. Kristina beobachtete ihn heimlich, wenn sie am Feuer saßen, und bemerkte, dass das Leuchten in seinen Augen langsam erlosch. Er wirkte so traurig, so absolut verzweifelt, und ließ doch niemanden an sich heran. Seine Schwester hatte es wohl auch bemerkt, Kristina konnte sehen, dass auch Shadi ihn immer wieder beobachtete. Heute aber richtete sie den Großteil ihrer Aufmerksamkeit auf Ma’ee, der eine alte Legende erzählte.
„Vor vielen Leben lag unter dieser Welt die erste Welt in tiefster Dunkelheit. Dort lebten sechs Individuen: Erster Mann, Erste Frau, Salzfrau, Feuergott, Kojote und Begochiddy, das Kind der Sonne, das goldenes Haar hatte. Begochiddy schuf vier Berge in der Ersten Welt, den weißen Berg im Osten, den blauen Berg im Süden, den gelben Berg im Westen und den schwarzen Berg im Norden. Dann hat Begochiddy die Pflanzen und Insekten geschaffen. Aber es gab Streit und die ersten Lebewesen wurden der Ersten Welt und deren Dunkelheit müde. Sie entschieden, die Erste Welt zu verlassen. Daher schuf Begochiddy den roten Berg im Zentrum der Ersten Welt und pflanzte ein riesiges Schilfrohr darauf. Die Lebewesen trafen sich dort und krochen in das Innere der hohlen Pflanze. Das Schilf wuchs und wuchs und brachte sie so in die Zweite Welt. In der Zweiten Welt, die blau war, schuf Begochiddy immer neue Dinge. Als die Katzenmenschen, die in dieser Zweiten Welt lebten, die Neuankömmlinge entdeckten, benutzte der Erste Mann Magie, um sie zu überwältigen.
„Wieder zerstörten Streitigkeiten die Harmonie der Welt und die ersten Lebewesen sammelten ihre Habseligkeiten ein und reisten mit dem riesigen Schilfrohr in die Dritte Welt hinauf. Die Dritte Welt war wunderschön, gelb und voller Licht. Dort hat Begochiddy Flüsse und Quellen geschaffen, Tiere und Vögel, Bäume und Blitze und viele verschiedene Menschenrassen. Als die Menschen zu streiten begannen, trennte Begochiddy sie, doch sie waren so unglücklich, dass Begochiddy sie wieder vereinte, sie aber warnte, dass diese Dritte Welt überflutet werden sollte, wenn es wieder Ärger gäbe.
„Und dann hat Kojote Ärger verursacht. Er ging am Fluss spazieren und sah dort ein Baby mit langen schwarzen Haaren im Wasser. Er hat das Baby mitgenommen und unter einer Decke versteckt, niemandem davon erzählt. Bunte Stürme und sintflutartige Regenfälle kamen von allen Seiten. Alle flohen davor in die beschützende Höhle des riesigen Schilfrohrs, das sie wieder nach oben trug. Aber das Schilfrohr wuchs nicht ganz bis zur Vierten Welt, also half eine Heuschrecke Begochiddy, ein Loch zu machen, das sie in die Vierte Welt, auf eine vom Wasser umflutete Insel, brachte.
„Begochiddy sah, dass die Wasser in der Dritten Welt noch immer in Aufruhr waren und fragte, wer das Wassermonster verärgert hatte. Kojote schlang seine Decke enger um seinen Körper und Begochiddy befahl ihm, sie wegzunehmen. Dort fand sich das Wasserbaby. Als Kojote das Wasserbaby zurück in die Dritte Welt gab, beruhigte sich das Wasser. In der Vierten Welt pflanzte Begochiddy die Berge und setzte den Mond, die Sonne, und die Sterne in den Himmel. Begochiddy brachte allen bei, wie man richtig lebt, einschließlich der Pflege der Pflanzen wie Mais, Bohnen und Kürbis, und wie man sich bei der Erde bedankt.“
Als Ma’ee seine Erzählung beendet hatte, war es weiterhin still um das Feuer und die Männer und Frauen gingen nach und nach schlafen, ohne dass mehr als ein Gute-Nacht-Gruß gesprochen wurde.