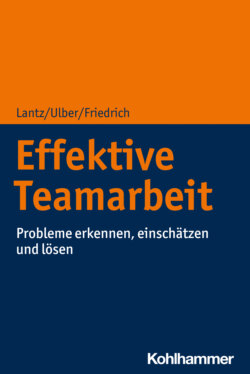Читать книгу Effektive Teamarbeit - Daniela Ulber - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2 Outcomes für das Team
ОглавлениеEingangs wurde bereits beschrieben, dass ein Team mit der Zeit bestimmte ›Gewohnheiten‹ bzw. Routinen des Denkens, Fühlens und Handelns entwickelt, die sogenannten emergenten Zustände. Emergente Zustände werden als Outcomes für das Team selbst gesehen. Allerdings stellt sich dabei die Frage, was das Huhn und was das Ei ist: Einige Konzepte sehen emergente Zustände als Output, der im Laufe der Zeit aus Erfahrungen mit der gemeinsamen Teamarbeit resultiert, andererseits können sie aber auch als Zustand betrachtet werden, der die Interaktion eines Teams charakterisiert. So wird die Selbstwirksamkeit eines Teams als Outcome gut funktionierender Teamarbeit bezeichnet, aber sie bildet gleichzeitig einen emergenten Zustand der Teaminteraktion. Individuelle Selbstwirksamkeit ist definiert als ein persönliches Urteil darüber, wie gut man dazu in der Lage ist, zukünftige Situationen erfolgreich zu bewältigen (Bandura, 1982). Die Selbstwirksamkeit eines Teams (oder auch Teamwirksamkeit) bezeichnet dasselbe auf einem kollektiven Niveau (Gully, Incalcaterra, Joshi & Beaubien, 2002). Selbst- und Teamwirksamkeit hängen mit Vertrauen zusammen. Stajkovic (2006) konzeptualisiert Selbstwirksamkeit als eine manifeste Variable des Kernvertrauens, welches Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Optimismus und Resilienz umfasst. Vertrauen ist der Glaube eines Individuums (oder eines Teams) an die Fähigkeit, die Anforderungen der Arbeit in einem bestimmten Bereich sowie die damit verbundenen Aktivitäten zu bewältigen. Ohne ein solches Vertrauen übernimmt ein Team keine anspruchsvolleren Aufgaben und verlässt seine Komfortzone nicht. Vertrauen ist das Ergebnis früherer Erfahrungen mit der erfolgreichen Bewältigung verschiedener Aufgaben im Team.
Teamwirksamkeit sollte entsprechend Einfluss darauf nehmen, was ein Team tut (Zielsetzung), wie hartnäckig es beim Auftreten von Hindernissen und deren Überwindung ist und wie viel Aufwand es in die Arbeit investiert. Entsprechend wird angenommen, dass Teamwirksamkeit sich auf das Verhalten des Teams auswirkt. Die Metaanalyse von Gully et al. (2002) stützt diese Annahme. Sie zeigt eine signifikante Korrelation2 von ρ = .41 zwischen Teamwirksamkeit und Teamleistungsoutcomes.
Einige Wissenschaftler*innen, z. B. Sy, Côté und Saavedra (2005), betrachten das affektive Gruppenklima als Outcome von Teamarbeit. Ebenso kann argumentiert werden, dass es sich dabei um ein Merkmal der Teaminteraktion handelt. Kohäsion ist ein weiteres Beispiel, auch diese wird von einigen Autoren als Outcome von Teamarbeit eingeordnet (z. B. Greene & Schriesheim, 1980; Gully, Devine & Whitney, 2012). Kohäsion wird aber auch als Konzept verwendet, um die Kräfte zu beschreiben, die ein Team zusammenhalten, und somit als Merkmal der Interaktion. Kohäsion umfasst das Commitment der Teammitglieder für das Team und das Ergebnis aller Kräfte, die auf die Mitglieder dahingehend einwirken, dass sie in der Gruppe bleiben (Festinger, 1950). Die Ergebnisse einer Metaanalyse von Beal, Cohen, Burke und McLendon (2003) ergeben stärkere Zusammenhänge zwischen Kohäsion und Leistung, wenn Leistung als Verhalten definiert wird (und nicht als Outcome). In einer weiteren Metaanalyse von Mathieu, Kukenberger, D’Innocenzo und Reilly (2015) zur Beziehung zwischen Kohäsion und Leistungskriterien zeigt sich, dass diese im Zeitverlauf wechselseitig zueinander in positiver Beziehung stehen. Was war also zuerst da – das Huhn oder das Ei? Auch Teamlernen ist Teil der Teaminteraktion und kann ebenfalls als Outcome betrachtet werden, zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn Teammitglieder ihr Wissen teilen und in einen gegenseitigen Lernprozess eintreten, erzeugen sie Wissen (West, 2012). Wissen kann wiederum als Outcome gesehen werden, der gleichzeitig Einfluss auf zukünftige Leistungsepisoden nimmt.
Die erwähnten Konstrukte können demnach sowohl als Beschreibungen der Teaminteraktion als auch als Outcomes dieser Interaktion betrachtet werden. Es gibt einen wachsenden Konsens darüber, dass Team-Viabilität ein Outcome von Teamarbeit ist. Team-Viabilität wird definiert als die Fähigkeit eines Teams zu Nachhaltigkeit und Wachstum, das für den Erfolg in zukünftigen Leistungsepisoden erforderlich ist (Bell & Marentette, 2011). Manche kennen vielleicht das Gefühl der Erleichterung nach Abschluss eines Projekts in einem nicht gut funktionierenden Team. Team-Viabilität bezeichnet das genaue Gegenteil – sie befördert Ideen darüber, welche anspruchsvolleren Aufträge als nächstes gemeinsam als Team bearbeitet werden können. Team-Viabilität wird auf Teamebene durch Teamprozesse wie Kohäsion, Koordination, gute Kommunikationsmöglichkeiten und Problemlösung befördert (z. B. Druskat & Wolff, 1999; Kozlowski & Bell, 2013). Die Proaktivität eines Teams hängt mit seiner Viabilität zusammen und ist ein wichtiger Outcome der Teaminteraktion, der mit organisationalem Change und Organisationsentwicklung korreliert (Barker, 1993; Lantz Friedrich, Sjöberg & Friedrich, 2016). Teamproaktivität ist definiert als freiwillige und konstruktive Bemühungen eines Teams, funktionale Veränderungen der Arbeitsausführung im Kontext des Arbeitsauftrags, der Arbeitseinheit oder der Organisation zu bewirken (Lantz, 2011). Eine aktuelle Literaturstudie zeigt, dass Proaktivität sowohl von Individuen als auch von Teams durch gute Führung, Unterstützung des Teams, positives Organisationsklima und effektive Teamprozesse gefördert wird (Cai, Parker, Chen & Lam, 2019). Insbesondere Teamlernen beeinflusst die Neigung, über vorgegebene Aufgaben hinauszugehen und sich proaktiv an Entwicklungs- und Veränderungsaktivitäten zu beteiligen (Lantz Friedrich et al., 2016).