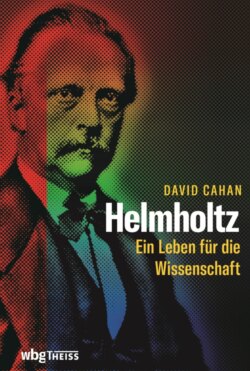Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung
ОглавлениеEs ist höchste Zeit für eine neue, moderne Biographie des deutschen Wissenschaftlers Hermann von Helmholtz (1821 – 1894). Immerhin erschien das Standardwerk, eine der ältesten Helmholtz-Biographien überhaupt, bereits vor gut einem Jahrhundert: Leo Koenigsbergers Hermann von Helmholtz (1902/03).1 Obwohl das Werk im wissenschaftlichen Gebrauch lange als Referenz diente, handelt es sich doch um eine unkritische Darstellung, die beschönigt, wenn nicht sogar heroisiert. Sie trug dazu bei, dass Helmholtz eine Art mythologische Größe zuwuchs, dass er zu einer Ikone und einem Idol wurde.
Die vorliegende Biographie hingegen soll eine umfassende, ausgewogene und thematisch ausgerichtete Betrachtung von Helmholtz’ Leben und wissenschaftlichem Wirken bieten und beides im historischen Kontext von Zeit und Ort verankern, wobei die Einflüsse seiner Zeit auf Helmholtz ebenso in den Blick genommen werden wie umgekehrt. Um ein möglichst vollständiges Bild von Helmholtz zu zeichnen, werden die vielen verschiedenen Kontexte, in denen er lebte und arbeitete, kritisch beleuchtet. Dazu werden all seine veröffentlichten und bekannten unveröffentlichten Schriften herangezogen: wissenschaftliche, philosophische und für die breite Öffentlichkeit verfasste Artikel und Bücher, ferner die erhaltene Korrespondenz (veröffentlicht und unveröffentlicht), alle bekannten einschlägigen offiziellen Dokumente zu seiner akademischen Laufbahn, die Korrespondenz Dritter und schließlich auch die umfangreiche Sekundärliteratur zu Helmholtz. Um eine neue Perspektive auf Helmholtz’ Leben, Wirken und Karriere zu gewinnen, wird für diese Biographie auf viele vormals unbekannte oder kaum bekannte Quellen zurückgegriffen, jedoch auch auf ältere, bekanntere. Dabei soll Helmholtz weder überhöht noch abgewertet werden. Es handelt sich vielmehr um den Versuch einer fundierten, kritischen Darstellung seines Lebens und Wirkens vor dem historischen Hintergrund einer im Entstehen begriffenen Wissenschaftsgemeinschaft.
***
Drei intellektuelle Leitmotive oder Triebkräfte lagen Helmholtz’ so schöpferischem wissenschaftlichem, philosophischem und ästhetischem Lebenswerk zugrunde. Erstens der leidenschaftliche Drang, die Wissenschaften sowohl auf Ebene der einzelnen Disziplinen wie in einem größeren Kontext zusammenzuführen. Zweitens ein wacher erkenntnistheoretischer Blick auf Herkunft und Methodik des Wissens sowie drittens ein starkes Bewusstsein dafür, wie Kunst und Wissenschaft sich gegenseitig ergänzen und beleben. Diese Leitmotive und Leidenschaften – die sich als roter Faden auch durch die vorliegende Biographie ziehen – begegnen immer wieder unterschiedlich ausgeprägt in Helmholtz’ Leben und Wirken. Sie standen hinter seinem Bestreben, die verschiedenen Bereiche der Physik zu vereinen (erst mithilfe des Energieerhaltungssatzes, zu einem späteren Zeitpunkt seiner Karriere dann mit dem Prinzip der kleinsten Wirkung), hinter dem Drang, ein gemeinsames Fundament für Physik und Physiologie zu finden, und hinter seinem Wunsch, den Naturwissenschaften insgesamt eine gewisse Einheit zu verleihen. Stets suchte Helmholtz nach den Gesetzen in der Wissenschaft.
Helmholtz schätzte und analysierte auch die Methoden der Geisteswissenschaften, die ebenfalls ihren – wenngleich untergeordneten – Platz fanden in seiner Vision von der Gesamtheit und Einheit des Wissens. Da sie ihrer inneren Natur nach immer auch die menschliche Psychologie umfassten, glaubte er jedoch nicht, dass sich für dieses Gebiet Gesetzmäßigkeiten ableiten ließen – was, wie wir sehen werden, für ihn einen überaus hohen Stellenwert hatte. Auch seine Vorliebe für Musik und Malerei und deren wissenschaftliche Analyse gehörte zu den intellektuellen und psychischen Triebkräften seiner Karriere. Er setzte sich mit der Beschaffenheit von Klängen und Farben auseinander und konnte zeigen, wie eine Kombination aus Akustik und Optik samt der damit eng verbundenen physiologischen Akustik und Optik zum Verständnis von Kunst beizutragen vermochte. Für Helmholtz waren die Künste – nicht nur Musik und Malerei, sondern auch Literatur und Theater – gleichermaßen Erholung von seiner anspruchsvollen wissenschaftlichen Arbeit wie Inspirationsquell dafür. Er glaubte, dass die Künstler auf ihre ganz eigene Art ebenfalls die Gesetze der Natur auszudrücken suchten, wie dies die Wissenschaftler taten. Hermann Helmholtz war ein Universalgelehrter.
Wie diese Biographie aufzeigen möchte, war es Helmholtz ein starkes inneres Verlangen, Gesetze in der Wissenschaft zu finden oder aufzustellen. Dieser Drang entwickelte sich schon in seiner Kindheit, als er versuchte, dem entgegenzuwirken, was er später als mangelhaftes Gedächtnis beschreiben würde. Im Erwachsenenalter wurde dieses Verlangen schließlich zum Kern seiner Wissenschaftsphilosophie. Helmholtz war der Ansicht, dass sich mithilfe von Gesetzen die Natur begreifen und beherrschen ließ. Wie Schiller glaubte auch er, dass der Weise »das vertraute Gesetz« sucht. Damit ist auf poetische Weise auf den Punkt gebracht, was Helmholtz in seinen wissenschaftlichen Texten und seiner erkenntnistheoretischen Reflexion darüber in Prosa zu fassen trachtete.2
Helmholtz ging bei seiner Suche nach Gesetzen intellektuelle Risiken ein, von wissenschaftlicher Erforschung versprach er sich weit mehr als neue Sachdaten. Als junger Wissenschaftler strebte er nach den »Ursachen« – manchmal nannte er sie auch »Kräfte« –, die er hinter den Gesetzen vermutete. Er hoffte dadurch letztendlich, ein »objektives« Bild der natürlichen Welt zu zeichnen, das die verschiedenen Gebiete der Naturwissenschaften miteinander verbinden würde. Letzten Endes musste er diese Zielsetzung jedoch überdenken. Im Jahre 1891 schrieb er: »[D]en ursächlichen Zusammenhang der Erscheinungen zu entdecken, hat mich durch mein Leben geführt.«3 Wie sich in diesem Buch zeigen wird, gab es tatsächlich eine enge Verbindung zwischen Helmholtz’ Physiologie und Bereichen seiner Physik, ebenso zwischen seiner Physiologie und seinem Konzept einer nichteuklidischen Geometrie, zwischen seiner Physik und seiner Geometrie, zwischen seiner Physik und seiner chemischen Thermodynamik und auch zwischen seiner Physik und seiner Meteorologie. Die von Helmholtz herausgearbeiteten Gesetze und Forschungsergebnisse beeinflussten aber natürlich auch andere Bereiche maßgeblich (Medizin, experimentelle Psychologie, Philosophie, Musik und Malerei). Um das Sehvermögen des Menschen zu verstehen, oder auch seine Tonempfindung oder die Körperwärme, muss man die physikalischen und physiologischen Gesetzmäßigkeiten, denen sie unterliegen, berücksichtigen. In Helmholtz’ Streben lässt sich eine ganz besondere und vielleicht sonst nie erreichte Befähigung dazu erkennen, Ideen, Begriffe, Theorien und Ergebnisse aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen in einer Synthese zusammenzuführen.
In den 1860er-Jahren wurde Helmholtz’ Suche nach wissenschaftlichen Gesetzen und Theorien weniger anspruchsvoll und vielleicht auch weniger philosophisch. Damit gestand er ein, dass das Höchste, worauf ein Wissenschaftler wohl realistischerweise hoffen durfte, die Formulierung beschränkter Gesetze (und Theorien) auf Basis bekannter Phänomene war. Zu einem vollständigen »Weltbild« gelangte er letzten Endes nicht, doch lernte er, sich damit – wie mit allem anderen in seinem Leben – zu arrangieren. Er war ein wissenschaftliches Genie, aber nie vergaß er, dass Theorien stets in einer empirischen Realität bestehen müssen. Dennoch glaubte er bis zum Ende seines Lebens, dass die Einheit der Wissenschaften die Einheit allen Wissens beinhaltete, und damit auch die Einheit der Wissenschaffenden der gesamten Wissenschaftsgemeinde. Das wiederum bedeutete für ihn einen zivilisatorischen Fortschritt für die gesamte Menschheit. Wissenschaft war in seiner Vision eine zivilisatorische Kraft, die alle Menschen vorwärtsbrachte.4
***
Dieses Buch schildert auch Helmholtz’ Privatleben. Dies geschieht nicht nur, weil es an sich schon interessant ist, sondern auch, weil es die schlüssige Verbindung herstellt in dem weit gespannten Bogen seines wissenschaftlichen und sozialen Einflusses. Ich möchte nicht nur seine Persönlichkeit und seine Ziele verdeutlichen, sondern ebenso den familiären und Bildungshintergrund, den sozialen und politischen Kontext, in dem Helmholtz aufwuchs und lebte; desgleichen seine familiären Bindungen, Freundschaften und Ehen; all seine Hoffnungen, Anspannungen und Entscheidungen mit Blick auf seine Karriere; seine Liebe zu Musik, Malerei, Theater, Literatur und anderen Künsten; seine Reisen und auch seinen Gesundheitszustand. Diese Aspekte sollen nicht als isolierte biographische Details betrachtet werden, sondern als das tragende Fundament seines komplexen wissenschaftlichen Denkens und Tuns, als Manifestationen der psychischen, emotionalen und intellektuellen Aspekte seiner Persönlichkeit und als Ausdruck dessen, was ihn sein Leben lang antrieb und stützte. Auf diese Weise lässt sich besser nachvollziehen, was sein wissenschaftliches Denken motivierte und welchen höheren Zielen es dienen sollte. Diese Biographie will die Leidenschaftlichkeit seines Antriebs und den Ehrgeiz nachzeichnen, die sich in seiner Entscheidung für den Weg der Wissenschaft, seinem generellen Streben nach Spitzenleistungen sowie seinem Wetteifern und der Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern offenbarten. All diese Aspekte helfen, die Konturen eines Wissenschaftlerlebens zu schärfen, das ein halbes Jahrhundert umfasste. Kurzum, diese Biographie möchte die dynamische Beziehung zwischen Helmholtz’ leidenschaftlichem Selbst und der Welt der Vernunft herausarbeiten, die sein Markenzeichen und Vermächtnis werden sollte.
Natürlich wird von Helmholtz’ wissenschaftlicher Arbeit, ihrer grundsätzlichen Ausrichtung, Struktur und Entwicklung die Rede sein, und ebenso von seinen größten wissenschaftlichen Errungenschaften und seiner Rolle als einer öffentlichen Figur der Wissenschaft. Da ich ein breit angelegtes Bild von Helmholtz zeichnen möchte, werde ich nicht tiefer einsteigen in die Analyse all seiner wissenschaftlichen Theorien, Beobachtungen, Experimente oder philosophischen Schriften. Dies ist eine Biographie im weitesten Sinne – keine streng wissenschaftliche, sondern eine kulturelle. Dabei konnte ich mich auf viele hervorragende Analysen zu speziellen Aspekten seiner wissenschaftlichen Arbeit und seiner philosophischen Ansichten stützen, die auf den Feldern der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte mittlerweile vorliegen.
Helmholtz’ eigenes Werk macht insgesamt sieben dicke Bände mit wissenschaftlichen Beiträgen und philosophischen Reflexionen über Wissenschaft aus: drei mit seinen gesammelten wissenschaftlichen Abhandlungen (175 Originalveröffentlichungen sowie einige Dutzend Nachdrucke und Übersetzungen), ein dreiteiliger Wälzer zur physiologischen Optik, ein Band zur physiologischen Akustik und Musik, seine populärwissenschaftlichen Vorträge in zwei Heften sowie eine Vortragsreihe zur theoretischen Physik, die einige seiner letzten Studenten posthum zusammenstellten (und erheblich überarbeiteten). Wie seine Publikationsliste zeigt, war Helmholtz ein Arbeitstier, manchmal ein regelrechter Workaholic.
In jedem Fall war er eine intellektuelle Ausnahmeerscheinung, ein wissenschaftliches Genie – um jenen Begriff zu verwenden, der ursprünglich Künstlern vorbehalten war, im 19. Jahrhundert aber auch auf Wissenschaftler gemünzt werden konnte. Menschen wie er waren es, die letztlich der ganzen Wissenschaftsgemeinde Richtung gaben und die Messlatte dafür bildeten, wer als Wissenschaftler »nur« dem Normalmaß entsprach (was sich ebenso auf die heutige Zeit übertragen lässt). Gleichzeitig unterschied sich Helmholtz’ Geistesgabe jedoch von der beispielsweise eines Darwin oder Einstein, die sich fast ausschließlich darauf konzentrierten, grundlegende Theorien für ein einziges Fachgebiet, also etwa die Biologie oder die Physik, zu entwickeln. Seine Forschungsergebnisse bestrichen ein weites Feld innerhalb der exakten Wissenschaften und der Lebenswissenschaften (inklusive der Medizin), und seine transformative Kraft ging noch weit darüber hinaus. Zudem war er am Aufbau dreier wissenschaftlicher Institute beteiligt (eines für Physiologie in Heidelberg und zwei für Physik in Berlin), die er auch selbst leitete, und trug zur Popularisierung der Wissenschaft bei.
Es mag an der unglaublichen Bandbreite von Helmholtz’ wissenschaftlicher Arbeit liegen, dass sein Name bei Wissenschaftshistorikern – ganz zu schweigen von der breiten Öffentlichkeit – nicht denselben Klang hat wie beispielsweise der Darwins oder Einsteins. Hatte er zu Anfang seiner Karriere gehofft, übergeordnete und grundlegende Prinzipien entwickeln zu können, die alle Disziplinen in die eine Wissenschaft integrieren würden, so leisteten seine Forschungstätigkeit und die Institutsgründungen faktisch einen weiteren Beitrag zur Spezialisierung der Wissenschaften, die im 19. Jahrhundert so deutlich hervortrat. Dieses Buch zeigt, dass Helmholtz entgegen seinen eigenen Wünschen und Bemühungen und trotz des interdisziplinären Charakters, der seiner Arbeit in weiten Teilen zukommt, nie die erhoffte Einheit der Wissenschaften erreichte. Es zeigt aber auch, dass er diese Hoffnung trotzdem nie aufgab, selbst wenn sie sich später anders ausdrückte. Oft wurde (und wird) er ein Naturphilosoph genannt, womit hier eine Person mit einer weiten intellektuellen Perspektive bezeichnet sein soll, die sich mit der Natur in ihrer Gesamtheit befasst und ihre Ursprünge und Gesetze zu erfassen sucht. Tatsächlich verkörperte er aber sehr viel besser das neuartige Konzept vom Wissenschaftler als Spezialist, der sich wissenschaftliche Probleme in abgegrenzten und handhabbaren, möglichst sogar definitiv lösbaren Häppchen vornimmt. Mindestens eine philosophische Frage, nämlich die nach dem Raum, verwandelte er in eine naturwissenschaftlich-mathematische Angelegenheit. Gleichzeitig war er daran beteiligt, für verschiedene Disziplinen den konkreten Forschungsrahmen und die Agenda (inklusive offener Fragen) abzustecken, führte ältere Forschungsergebnisse aus verschiedenen Feldern der Naturwissenschaften und der Medizin synthetisierend zusammen und entwickelte wichtige neue Instrumente. Auch wenn die Gesamtheit seiner Anstrengungen sich nicht zu einer einheitlichen Naturphilosophie zusammenfügte, waren sie doch wegweisend für zahlreiche Wissenschaftsfelder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auch noch im 20. und 21. Jahrhundert war Helmholtz für viele Wissenschaftler eine Quelle der Inspiration und Instruktion, darunter Physiker wie Einstein und Kognitionswissenschaftler wie V. S. Ramachandran.
Er war ebenso selbst geprägt vom deutschen Bildungssystem und von der Wissenschaftsgemeinschaft seiner Zeit, wie er sie auch seinerseits prägte. Sein Werdegang vom Gymnasialschüler zum Medizinstudenten und Militärarzt, vom außerordentlichen zum ordentlichen Professor erst für Physiologie und schließlich für Physik ist geeignet, die Veränderungen in Charakter und Funktionsweise dieses Systems und dieser Gemeinschaft und damit zugleich die institutionelle Entwicklung der Wissenschaften im Deutschland des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus konkret zu veranschaulichen. Seine Karriere nachzuzeichnen, bedeutet, so etwas wie den Aufbau der Wissenschafts-Infrastruktur im 19. Jahrhundert zu verfolgen: ihre Institute, Laboratorien, Zeitschriften, Fächerorganisation, nationale und internationale Kongresse und so weiter. Wie schon erwähnt, beeinflusste Helmholtz’ Arbeit zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen, und im Zuge seiner beruflichen Entwicklung lernte er ein ähnlich weites Spektrum von zuweilen konkurrierenden, zuweilen kooperierenden Kollegen kennen – nicht ausschließlich Naturwissenschaftler, Mathematiker und Mediziner (seien sie in der Wissenschaft oder an der Klinik tätig), sondern auch Geistes- und Sozialwissenschaftler, dazu unzählige Studenten, gewöhnliche ebenso wie außergewöhnliche, Deutsche ebenso wie Nichtdeutsche. Wenn wir den Spuren von Helmholtz’ Leben und Karriere folgen – von Potsdam und Berlin über Königsberg, Bonn und Heidelberg schließlich wieder zurück nach Berlin, und vom Assistenten über den außerordentlichen zum ordentlichen Professor der Physiologie und Physik, zum Dekan und Rektor der Universität –, lernen wir auch etwas über Wissenschaft im 19. Jahrhundert insgesamt: Wir schauen Wissenschaftlern dabei über die Schulter, wie sie miteinander kommunizieren und einander besuchen, wir treffen auf Instrumentenmacher und Hörerschaften, erleben Helmholtz’ geistige und institutionelle Führerschaft in der Wissenschaftsgemeinschaft und lernen die wenigen ihm gleichrangigen Forscher ebenso wie viele weitere Kollegen kennen.
Konkurrenzdenken war bei Helmholtz sehr ausgeprägt. Wie ließe sich ohne diesen inneren Antrieb erklären, dass seine Forschungsperformance so gleichmäßig und lang andauernd war, angefangen mit seiner ersten Publikation 1843 im Alter von 22 Jahren bis hin zu seiner letzten im Jahre 1894, mit fast 73 Jahren? Auch nachdem er den Zenit seines äußeren beruflichen Erfolges (zwischen den 1850er- und den 1870er-Jahren) erreicht hatte, betrieb er noch lange richtungsweisende Forschung und publizierte seine Ergebnisse. Das tief empfundene Bedürfnis, die wissenschaftlichen Gesetze zu ergründen, sein ebenso ausgeprägtes Pflichtbewusstsein als bezahlter deutscher Universitätsprofessor sowie die Führungspositionen, die er als Direktor verschiedener wissenschaftlicher Institute innehatte, trieben ihn an, unermüdlich weiterzuforschen und anderen darüber zu berichten (Fachpublikum ebenso wie Laien). Ungefähr ab 1847 erlebte er etwas, was andere Kreative – beispielsweise begabte Autoren oder Spitzenathleten – manchmal als »Flow« bezeichnen. Seine Leidenschaft für die Wissenschaft ebbte nie ab. Sein mehrstufiger Arbeitsprozess, der mit der gedanklichen Durchdringung und Auswahl eines Problems begann, mit Beobachtungen und Experimenten zu einem bestimmten Phänomen voranschritt und hinführte zur Entwicklung theoretischer (und mathematischer) Erklärungsansätze und Schlussfolgerungen, zur Verschriftlichung der Ergebnisse und schließlich zu ihrer Drucklegung, trug möglicherweise zu seinem psychischen Wohlbefinden bei, stärkte sein Selbstbewusstsein und verlieh ihm ein Gefühl von Wichtigkeit und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Der ständige berufliche Erfolg stellte ihn zufrieden und wurde ihm zur Gewohnheit und zum Bedürfnis.
Schließlich soll in dieser Biographie auch aufgezeigt werden, wie Helmholtz zu einem Popularisator wurde, der Wissenschaft einem breiten Publikum verständlich machte, und damit gleichsam zu einem Staatsmann der Wissenschaft. Bezüglich seiner Funktion als Sprecher und Förderer der Wissenschaft und seines Einflusses innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft gab es wohl niemanden, der sich mit ihm vergleichen konnte. Damit lässt sich auch sein beträchtlicher Einfluss in akademischen, Regierungs- und oberen Gesellschaftskreisen erklären. Seine einzige Schwäche zeigte sich, wenn er im Hörsaal stand und dort auf Anfänger- oder mittlerem Niveau unterrichten sollte. Dann konnte es geschehen, dass seine Zuhörer ihn unorganisiert, uninspiriert und sogar langweilig fanden. Er investierte wohl wenig Mühe in derlei Lehre, sondern sparte sich seine Zeit und Energie für die Forschung auf. Fortgeschrittene Studenten konnte er, besonders nachdem er 1871 als Professor für Physik nach Berlin gegangen war, hingegen sehr wohl inspirieren.
Mit einer Vielzahl an populärwissenschaftlichen Vorträgen und anderen öffentlichen Reden gelang es ihm, Wissenschaft der breiten Öffentlichkeit ebenso wie der gebildeten Elite in Regierung, Kultur, Handel und Industrie zu erklären und ihre Daseinsberechtigung zu untermauern. Helmholtz vermittelte die wichtigsten empirischen Ergebnisse der Wissenschaft, ihre Gesetze, Ziele, Methoden und Werte, er stellte den Zusammenhang zwischen den Disziplinen her, er argumentierte für die finanzielle Förderung der Wissenschaft. Kurzum, er wurde eine Art öffentlicher Wissenschaftler. Bei diesen Bemühungen bewies er stets soziales Verantwortungsgefühl, sie brachten ihm aber auch persönliche Erfüllung. Helmholtz trat in die Fußstapfen Alexander von Humboldts, der ersten öffentlichen Figur der deutschen Wissenschaft. In späteren Generationen folgten Max Planck und Werner Heisenberg. Helmholtz’ Persönlichkeit und sein Ruf prägten das Bild des Wissenschaftlers, wie es sich eine gebildete Öffentlichkeit in Deutschland und darüber hinaus machte. Eine Betrachtung seiner Bemühungen um die Popularisierung von Wissenschaft gibt Aufschluss über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Helmholtz mischte sich über die Grenzen der Wissenschaft hinaus ein in deutsche Kultur in einem weiten Sinne, und entsprechend wurden seine Schriften inner- wie außerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft gelesen. Seine Leser interessierten sich für die Zusammenhänge unter den einzelnen Wissenschaften, für die Freiheit der Wissenschaft, die wissenschaftlichen Grundlagen von Musik und Malerei, für Philosophie, die neuen Gesetze der Thermodynamik und den »Wärmetod« des Universums sowie für die neue, nichteuklidische Geometrie. Zahlreiche große Geister und Künstler des 19. Jahrhunderts lasen seine Werke: George Bancroft, George Eliot, George Henry Lewes, Herbert Spencer, Karl Marx, Friedrich Engels, Friedrich Max Müller, Friedrich Nietzsche, Charles Sanders Peirce, Wilhelm Dilthey, William James, Sigmund Freud, Franz Boas und Max Weber, ganz zu schweigen von all den Musikern und Malern. Weit bis ins 20. Jahrhundert fanden Helmholtz’ populäre und semipopuläre Schriften ihre Leser unter Intellektuellen und Akademikern – und tun es auch heute noch.
Zwar war Helmholtz’ Forschungsinteresse rein wissenschaftlicher Natur, doch konnte es durchaus positive praktische Ergebnisse zeitigen. Mit der Erfindung des Augenspiegels 1850/51 machte er sich schnell einen Namen nicht nur unter Medizinern. Helmholtz hielt Wissenschaft für die grundlegende Quelle von neuer Technologie. Indem er zu Medizin und Akustik beitrug, beeinflusste er zugleich die Bauweise und Stimmtechnik von Klavieren und vertiefte das wissenschaftliche Verständnis des gerade erfundenen Telefons. Ihm sind zudem neue Einblicke in die Meteorologie und die Funktionsweise des Mikroskops zu verdanken; auch der Instrumentenbau profitierte. Durch seine Führungsrolle auf den internationalen Elektrizitätsausstellungen (besonders auf der ersten im Jahre 1881) und seine Funktion als Mitbegründer und Direktor der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt samt der damit verbundenen Betätigung in der Messtechnik hatte er Anteil an der Etablierung internationaler und nationaler messtechnischer Einheiten und Standards für die gerade aufkommende Elektroindustrie sowie für ältere Industriezweige.
Helmholtz gehörte dem deutschen Bildungsbürgertum an, also jenem Teil der Mittelklasse, der seinen Status vornehmlich seinen Bildungsbemühungen verdankte. Wie viele andere in dieser sozialen Gruppe setzte er seine Hoffnungen auf die nationale Einheit Deutschlands. Zumindest bis die staatliche Vereinigung der Deutschen 1871 Wirklichkeit wurde, ging der deutsche Nationalismus mit Liberalismus einher und fand seinen Ausdruck vor allem in der Idee des Kulturstaats. Wissenschaft ganz allgemein wurde (besonders) von den gebildeten Schichten als zentrales Element dieser politisch-kulturellen Bemühungen angesehen, und die zunehmende Bedeutung der Institutionalisierung von Wissenschaft für die Industrie wurde erkannt. Für viele war Wissenschaft gleichbedeutend mit Rationalität und Fortschritt, und das Streben nach Wissenschaft half, den modernen Nationalstaat zu legitimieren.
Helmholtz’ generelle politische Haltung ließe sich, vor dem Hintergrund von Zeit und Ort, als konservativer Liberalismus charakterisieren. Nur bei seltenen Gelegenheiten zeigte er sich chauvinistisch, und er war nie ein politischer Professor. So stolz er auf deutsche Errungenschaften in der Wissenschaft und in anderen Bereichen war, zögerte er doch nie, den wissenschaftlichen Beiträgen anderer Nationen Anerkennung zu zollen. Wie auch viele seiner Kollegen, ob daheim oder im Ausland, konnte er Wissenschaft in einem Atemzug national und international zugleich nennen. Er tat stolz seinen Dienst als Professor (ein Staatsbeamter) und Leiter eines nationalen Instituts (der Reichsanstalt), nahm gerne unzählige staatliche Auszeichnungen und Orden entgegen, deutsche ebenso wie ausländische, und besonders in der letzten Phase seiner Karriere, in Berlin, verkehrte er oft mit Monarchen, Aristokraten sowie höheren Staatsbeamten. Dennoch dürfte er sich selbst kaum je als politischer Mensch verstanden haben, und er nutzte seine Kontakte nicht zu politischen Zwecken oder für seine Karriere aus. Er zählte sich zur geistigen, kulturellen und sozialen Elite Deutschlands, nicht zum politischen Establishment. Er sah sich selbst als Kulturträger. Niemand sonst verkörperte damals so perfekt wie Helmholtz das deutsche Ideal des Gelehrten. Damit stand er symbolisch für einen weiten und kritischen Geist, der über jeder Einzelwissenschaft und sogar über der Wissenschaft an sich rangiert und an der Vision von der Vereinigung aller Wissenschaften und ihrem Gebrauch zum Wohle der Menschheit festhält. Es war dies ein liberaler, aufklärerischer Geist, der neben den politisch konservativen, reaktionären und militaristischen Tendenzen der modernen deutschen Geschichte weiterexistierte, wenn auch in einem unzureichenden Maß. Freilich war – worauf im Epilog zurückzukommen sein wird – die Erinnerung an Helmholtz von seinem Tod im Jahre 1894 bis zum heutigen Tage stets eine selektive und wurde dazu gebraucht und zuweilen missbraucht, um eine mythologische Figur zu erschaffen, die quasi außerhalb der Geschichte steht. Diese Biographie will Helmholtz dagegen in der realen Welt seiner Zeit verorten, würde doch eine holzschnittartige Darstellung seines Lebens und Wirkens weder ihm gerecht werden noch uns zu einem angemessenen historischen Verständnis verhelfen. Sie will vor Augen führen, wie das kreative Leben eines Wissenschaftlers aussehen kann, und wie dessen persönliches Leben das Verständnis von Kunst und Kultur im weitesten Sinne zugleich wie Luft zum Atmen brauchte und bereicherte. Sie will zeigen, wie stark Natur- und Geisteswissenschaften im Leben dieses hochmotivierten, energiegeladenen und begnadeten Menschen miteinander verflochten waren.