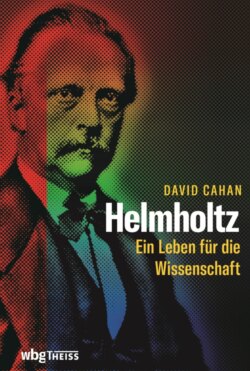Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Auf dem Gymnasium: Vater und Sohn Das Potsdamer Gymnasium
ОглавлениеDas Bildungsbedürfnis eines wachsenden Bildungsbürgertums spiegelte sich im Potsdamer Gymnasium wider. Alle neun Klassenstufen waren dort vertreten: die drei unteren (Sexta, Quinta und Quarta) und die sechs oberen (Tertia, Secunda und Prima, je noch einmal unterteilt in Unter- und Ober-). 1831, ein Jahr nachdem Helmholtz aufs Gymnasium gekommen war, gab es insgesamt 299 Schüler – ausschließlich Jungen; als Hermann 1838 seinen Abschluss machte, waren es 306. Neun Lehrer zählte das Potsdamer Gymnasium, dazu kamen noch zwei oder drei weitere, welche die Ausbildung in Schönschreiben, Zeichnen und Singen übernahmen. Das Schulgebäude beherbergte einen Vortrags- und einen Zeichenraum, einen Physiksaal, eine Bücherei für Lehrer, eine für Schüler sowie ein Besprechungszimmer und die Wohnung des Direktors. Die Schülerbücherei zählte über 700 Bände. Im Physiklabor mit mehr als 100 physikalischen und mathematischen Gerätschaften konnten die Schüler zu den Inhalten aus dem Unterricht praktisch experimentieren. Außerdem gab es noch eine Sammlung naturwissenschaftlicher Literatur sowie eine Mineraliensammlung.1 Diese moderne Ausstattung gehörte wohl zu den besten Deutschlands und zeugte von Preußens großem Engagement für Bildung in der nachnapoleonischen Zeit. Für seine Lehrer und Schüler gleichermaßen war das Gymnasium ein Nährboden der deutschen Kultur.
Wie an allen klassischen Gymnasien wollte man auch in Potsdam bei den Schülern das Fundament zu Bildung (im Sinne eines Sich-selbst-Formens und -Kultivierens) legen. Es handelte sich um eine neuhumanistische Institution, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Elite der Nation heranzubilden, also ihre Schutzbefohlenen für ihr Land auszubilden, indem man in ihnen ein Nationalbewusstsein weckte. Das Lehrpersonal bestand aus Staatsbeamten, die bar jeden Interesses an der republikanischen Staatsform, an Industrie, Technologie oder allgemein an Praktischem waren. Man wollte die Schüler in ihrer moralischen, spirituellen, geistigen und körperlichen Entwicklung unterstützen und sie zu ethisch handelnden Menschen erziehen, die fähig wären, sich Wissen anzueignen und es so einzusetzen, dass sie sich optimal entfalten würden. Diese hehren Ideale gedachte man, durch das Studium von Sprachen und Literatur (Griechisch, Latein, Deutsch und Französisch) sowie der Wissenschaften (Mathematik, Physik, Naturkunde und Geographie, aber auch Geschichte und Philosophie) zu erreichen; dazu kam Unterricht im Zeichnen, Singen und Turnen sowie in der Religion (also in der Lehre und Geschichte des Christentums). Denn zum Konzept des Potsdamer Gymnasiums gehörte – wie auch an allen anderen Gymnasien – genauso die Vermittlung einer christlichen Grundhaltung wie die klassische und humanistische Bildung. Helmholtz und seine Mitschüler sangen daher beispielsweise das »Vater unser« und »Der Auferstandene« ebenso wie das christliche Gebetslied der Schule. Solcherart ergänzte die Schule die religiöse Unterweisung, die Helmholtz von seinen Eltern und anderen schon erfahren hatte. Zudem wurde am Gymnasium ein Verhaltenskodex vermittelt, der den Sinn für die bürgerliche Ordnung sowie moralische Redlichkeit wecken sollte. Wie es einer der Rektoren formulierte, versuchte man, den Schülern ein Gefühl für Pünktlichkeit, äußere Ordnung und ein starkes Rechtsempfinden einzupflanzen, ihre Demut und ihren Fleiß zu fördern und diese moralischen Tugenden zusammen mit einem christlichen Sinn für Edelmut zu verankern, was ihnen zu moralischer Unabhängigkeit verhelfen sollte.2 Die Schule förderte wie schon sein Zuhause Helmholtz’ ausgeprägten Sinn für christliche Frömmigkeit und bürgerlichen Anstand.
Ferdinand Helmholtz als Pädagoge und Philosoph
Vater Helmholtz gehörte im Potsdamer Gymnasium zum Inventar. Nach einer anfänglichen Probezeit von einem Jahr unterrichtete er fünf Jahre lang die drei oberen Klassen. Es war seiner Gelehrsamkeit und Loyalität zu verdanken, dass er 1827 zum stellvertretenden Direktor befördert wurde. Im darauffolgenden Jahr erhielt er auch noch den Titel Professor und stand von nun an der Secunda vor.3 Diese Position behielt er für über drei Jahrzehnte. Wie das Gros der zahlreichen neuen Schullehrer damals wurde er zum moralischen Vorbild und pädagogischen Vermittler für Schüler und Familien aus der Unter- und Mittelschicht, die ihren sozialen Aufstieg anstrebten.
In seinen ersten Berufsjahren unterrichtete Ferdinand eine große Bandbreite an Fächern. 1830 jedoch hörte er auf, Mathematik und Physik zu lehren. Fichte gegenüber begründete er das damit, dass seine Ausbildung eher philologisch als mathematisch orientiert gewesen sei und zudem der philologische Unterricht aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten, intellektuelle Fähigkeiten zu wecken, interessanter sei als der mathematische. Ferdinand konzentrierte sich daher auf den Sprachunterricht, Literatur, Philosophie und Religion sowie seine Verwaltungstätigkeiten. Seinen Schülern ist vor allem im Gedächtnis geblieben, wie schön er Gedichte, Theaterstücke und dergleichen vortrug.4
Seine Vorgesetzten waren stets voll des Lobes für Ferdinand. Sie wussten von seiner ästhetischen Erziehung, seine umfassenden literarischen Kenntnisse, seinen motivierenden Unterrichtsstil, seine Loyalität gegenüber der Schule, sein Pflichtbewusstsein und ganz allgemein um seine Bildung. In den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit wurde er angeblich zunehmend nachsichtiger mit seinen Schülern, zum Ende hin ließ Gerüchten zufolge die Qualität seines Unterrichts nach. Es gibt nur einen einzigen Makel (wenn überhaupt) in Ferdinands Akten: Anfang 1848, am Vorabend der preußischen Märzrevolution, ließ er auf Bitten seiner Schüler hin drei Stunden Deutschunterricht ausfallen, um stattdessen über seine Erlebnisse in den Befreiungskriegen zu sprechen, darüber, wie Friedrich Wilhelm III. eher in den Krieg gefolgt war, als ihn anzuführen, und über die Restauration. Damit wagte er sich an einen der wundesten Punkte in der neueren politischen Geschichte Preußens. Inwieweit waren die Kriege patriotischer, inwieweit nationalistischer Natur? Wer ging voran, der Staat oder die Nation, die Dynastie der Hohenzollern oder das preußische Volk? Handelte es sich um Befreiungs- oder Freiheitskriege? Der Direktor des Gymnasiums wies Ferdinand wegen seiner Insubordination und seiner Unbesonnenheit streng zurecht und drohte, ihn bei einem weiteren ähnlichen Vorfall sofort zu entlassen. Es sollte nie dazu kommen, wenngleich Ferdinand weiter an seinem glühenden Patriotismus festhielt, der oftmals auf seine Schüler übersprang. Helmholtz beschreibt seinen Vater als einen Lehrer, »der ein zwar pflichtstrenger aber enthusiastischer Mann war, begeistert für Dichtkunst, besonders für die grosse Zeit der deutschen Literatur«. Bis Ferdinand sich 1857 aus gesundheitlichen Gründen zur Ruhe setzten musste, versah er seinen Dienst nach Ausweis der Laudatio im Schulprogramm desselben Jahres jedenfalls mit echter Hingabe.5 Hier klingt an, dass die Kultur in Deutschland der Politik untergeordnet war.
Im Laufe seiner langen Karriere hielt Ferdinand vier Vorträge bei den Plenarsitzungen des Gymnasiums, welche zugleich seine gesamten Veröffentlichungen ausmachen. Mit Blick auf seinen Sohn war der Vortrag von 1837 am wichtigsten, bei dem Ferdinand über ästhetische Erziehung sprach. Schon das Thema legt nahe, dass Ferdinand die späteren intellektuellen Interessen Hermanns nachhaltig prägte und dass seine Einschätzung des zeitgenössischen Kulturlebens und seine Bildungsempfehlungen seinen Sohn stark beeinflussten. Helmholtz sagte später: »Glücklich ein Kind, welches unter Eltern aufwächst, die Künste pflegen.«6 1837, das Jahr, in dem Ferdinand seinen Vortrag hielt, war Hermanns letztes Jahr am Gymnasium, und höchstwahrscheinlich saß er im Publikum oder las zumindest das Vortragsmanuskript.
Ferdinand glaubte, das materielle und spirituelle Leben der »zivilisierten europäischen Völker« schreite voran, was eine Ausbreitung der »Zivilisation« nach sich ziehe. Aber er hielt auch dafür, dass Fortschritt und Zivilisation zu einer etwas einseitigen Betrachtungsweise geführt hätten: Die spirituelle Dimension des Menschen sei außer Acht gelassen worden, das noch Unbekannte betrachte man lediglich als ein ungelöstes konzeptionelles Problem. Für Ferdinand war die menschliche Existenz eine Verbindung von äußerer und innerer Welt, von Zeitlichem und Ewigem, von Wissenschaft und spirituellem Leben. Das Leben bilde die »Einheit« dieser binären Paarungen, wobei die Griechen den Weg für deren jeweils ersteren Aspekt gewiesen hätten und das Christentum den für den letzteren. Der Wert von Wissenschaft lag in seinen Augen nur darin, dem Menschen ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Er glaubte nicht an eine Wissenschaft um ihrer selbst willen, die losgelöst vom praktischen Leben existieren könnte. Wissenschaft, Technologie und menschliche Werte hatten einander vielmehr gegenseitig zu dienen. Seiner Ansicht nach war die moderne Wissenschaft unchristlich. Er schreibt von einer »höheren Einheit« und von einer »Gesetzlichkeit alles Lebens und aller Erscheinung« sowie von »dieser Lücke unsrer Bildung, als den Ursprung des Unheils der Zeit«.7
Weiter legt er in seinem Vortrag dar, dass die moderne Welt von Freiheit und westlicher Kultur geprägt sei. Sie habe sich aus dem »Kampf mit der Natur und mit sich selbst« entwickelt, aus welchem der Mensch frei hervorgegangen sei. »Die Entwicklung des Geistes als Freiheit bildet das eigentümliche Wesen des occidentalischen Lebens«, angefangen bei den Griechen, die abstrakte Begriffe und Naturgesetze erarbeiteten. Der Mensch habe sich daraufhin mehr und mehr von der Natur entfernt und glaube doch dabei, die reale Welt zu beobachten und Gesetze zu entdecken. Diese analytische Phase habe die wahre Einheit des Lebens zerstört und sie durch eine abstrakte ersetzt. Der Mensch sei schließlich zu der Überzeugung gekommen, dass er einen freien Willen besitze; es herrschten der Glaube an die Vernunft und das Individuum. Für Ferdinand handelte es sich hierbei jedoch nur um eine eingeschränkte Form von Fortschritt: Die wahre Freiheit war nicht Freiheit um ihrer selbst willen, sondern »damit die Offenbarung Gottes werde«. Der Verstand war nichts wert, wenn er nicht dieser Offenbarung diente. Auf die Entwicklung des Verstandes musste vielmehr die Entwicklung von Gefühl und Intuition folgen. Wie Ferdinand weiter schreibt: »Jetzt aber endlich, wo die geistige Freiheit vollkommen errungen und gesichert ist«, werde es Zeit, dem abstrakten, »leeren Verstandesleben zu entsagen« und stattdessen »die christliche Aufgabe, Gott in der Freiheit zu lieben und zu leben, zur Ausführung zu bringen«. Dafür seien »Entwicklung und Bildung des Gefühls« notwendig, worin die »nächste und wichtigste Aufgabe unserer Pädagogik« bestehe.8
Die Kunst, so Ferdinand weiter, bilde das Gefühl »nach den Gesetzen der Schönheit«, und die Entwicklung dieser Gesetze sei aus individuellen, familiären und gesellschaftlichen Gründen erforderlich. Die große Herausforderung seiner Zeit liege darin, Gefühl und Freiheit zu einen sowie das Gefühl um der Freiheit willen zu verfeinern. Wie die Wahrheit sei die Schönheit etwas Absolutes und müsse daher gefunden werden, nicht erfunden. Die Aufgabe der Kunst bestehe dabei darin, im »Ist« das »Soll« darzustellen und das Gefühl zu »erziehen«. Schönheit sei wesentlich in einem »wahrhaft göttlichen Leben«, also in einem christlichen. Mithilfe der ästhetischen Erziehung ließen sich nämlich Moral und Mitgefühl begründen. Es seien die Dichter, Musiker und Tänzer, welche die Moral grundlegten, indem sie Harmonie, Klang und Form hervorhoben. Kunst führte in Ferdinands Augen zu Spiritualität, Freiheit und der vornehmsten (der inneren) Weise der Existenz. Kunst in ihrer Reinform konnte »ein ernstes religiöses Bedürfnis« befriedigen.9
In seinem Vortrag führte Ferdinand weiter aus, dass der Verstand eigenständig entstehe, wohingegen Gefühle eine unmittelbare Antwort auf äußere Reize seien. Jedes Volk, so Ferdinand, habe seine eigene Kunst, und je weiter entwickelt ein Volk sei, umso weiter entwickelt sei auch dessen Kunst. Das Wesen eines Volkes und seine Kunst seien eng miteinander verflochten. Ferdinand glaubte auch, dass die Bildung sich an der Kunst messen lasse. Die ästhetische Erziehung an deutschen Gymnasien hielt er für armselig und forderte hier eine Verbesserung. Sein Urteil über seine Zeit insgesamt fiel nicht besser aus: Er konstatierte Geschmacklosigkeit in Kleidungsstil und Mode und Unzulänglichkeiten in Architektur, Sprache und Theater.10
Höchste Schönheit erwuchs für Ferdinand aus vollendeter Einheit. Aus der Aufhebung des Widerspruchs in der Anschauung stamme »der Friede, die Harmonie und Beruhigung, welche der Anblick der Schönheit über die Seele verbreitet«. Die Kunst könne den Menschen über eine einseitige Rationalität hinausführen, indem sie genau das tue, was die Wissenschaft nicht vermochte: grundverschiedene Elemente in einem vereinten Ganzen aufgehen zu lassen, das Innerlichkeit und Äußerlichkeit ebenso in sich begreife wie Freiheit und Gesetz, Absolutes und Relatives, Sein und Sollen, Zeitliches und Ewiges, Endliches und Unendliches, Individuelles und Ganzes. Alles, so Ferdinand, könne die Kunst vereinen. Sie führe zu »immer höherem Frieden und immer höherer Beruhigung und Seligkeit«. Die Schönheit habe daher auch so großen Einfluss auf die »Zivilisation der Völker« gehabt, weshalb sie »als Form des göttlichen Lebens zu denken« sei. Das Paradies, das goldene Zeitalter sei gleichbedeutend mit einem »Leben in der Einheit des Geistes und der Natur«, in der Vereinigung von Ich und Nicht-Ich, von Körper und Geist, Werden und Sein, Leben und Tod.11
Nach Ferdinands romantischer, religiöser Sichtweise des Lebens hatte sich der Schönheitssinn des Menschen über eine Reihe historischer Stufen entwickelt, deren letzte seine höchsten Ideale in der Kunst verkörperte. Dazu zählte er die Werke von Aischylos, Aristophanes, Sophokles, Shakespeare, Molière, Calderón, Schiller und Goethe sowie die Musik von Beethoven, Händel, Gluck und Mozart.12 Mit Ausnahme des Franzosen Molière nannte übrigens auch sein Sohn später genau diese Namen als Prüfsteine großer Literatur und Musik, und ihre Werke bescherten ihm einige der schönsten Momente literarischen und musikalischen Genusses.
Ferdinands langer, schwülstiger und weitschweifiger Aufsatz von 1837, der ihm zu einer Art Lebensphilosophie geraten war, formuliert indes auch praktische Regeln für die Gefühlsbildung junger Menschen. Kinder müssen demnach, wie Erwachsene, lernen, ihre animalischen Leidenschaften zu zügeln, um so bis zu einem gewissen Maße gottähnlich zu werden. Sie sollen gute Manieren erlernen und generell soziales Verhalten entwickeln. Kontrolle über den Willen zu erlangen, war für Ferdinand hier wesentlich. Kinder sollten lernen, anmutig und ohne Gier zu essen und zu trinken, und einen natürlichen Gang entwickeln. Daher sei auch die Teilnahme an Orchester und Gymnastik so wichtig, und ebenfalls die mit Bedacht ausgewählte Kleidung. Weiter sollten sie die Befähigung erwerben, das gesellige Leben durch »Liebenswürdigkeit, Grazie und Würde« zu verschönern und »Anmaßung, Herrschsucht, Stolz, plumpe Gleichgültigkeit« zu vermeiden. Sie sollten stets danach streben, Artefakte zu erschaffen oder zu finden, die Einheit und Natürlichkeit vollumfänglich widerspiegelten. Ferner sollten sie eine schöne Sprache als Ausdruck der Schönheit der Seele und der Zivilisiertheit pflegen. Jede einzelne ihrer Handlungen sollte ein »Akt der Freiheit« sein, und zugleich in Übereinstimmung mit der Vernunft im Allgemeinen. Schließlich sollten sie danach streben, »Wirklichkeit und Idealität, Zeitlichkeit und Ewigkeit, kurz Lösung sämtlicher Gegensätze des geistigen und sinnlichen Menschen« zu vereinen. Ferdinand führte weiter aus: »[D]as Bedürfnis der Schönheit ist ebenso tief in der menschlichen Seele gegründet, wie das der Wahrheit«, die Erziehung zum Schönen sei jedoch »nur durch Anschauung, nicht durch den Begriff«13 möglich.
Obwohl Ferdinand nicht daran glaubte, selbst derlei Ideale erreichen zu können, wollte er sie doch seinen eigenen Kindern und seinen Gymnasialschülern anerziehen. Helmholtz erinnerte sich, wie sie beide einmal »vor der Bildsäule der Athene am großen Brunnen in Sanssouci« standen. Als er eben im Begriff war, Details an der hasserfüllten Göttin zu kritisieren, wies der Vater ihn an, er solle zunächst versuchen, den Sinn des Ganzen in sich aufzunehmen und auf sich wirken zu lassen. Erst wenn ihm das gelinge, dürfe er es in Teile zerlegen. Auf diese Weise verhindere man, sich von ungeliebten Einzelheiten die Freude am Ganzen verderben zu lassen. Auch der jüngere Bruder Otto behielt in Erinnerung, wie sein Vater die Söhne immer durch Kunst und Natur inspirieren wollte. Alles in allem war das Leben mit Vater Helmholtz wohl nicht immer einfach. Anna von Mohl, Helmholtz’ zweite Frau, deutete das zumindest an und fügte hinzu, ihr Schwiegervater wirke wie ein echter Pedant, der sich für den Klügsten unter den Sterblichen halte.14 Ferdinand, der mit seinen Kindern möglicherweise überfürsorglich war, sehnte sich nach einer integrierten, ganzheitlichen Welt. Sein ältester Sohn strebte nach ähnlichen Zielen, jedoch mit den Mitteln und Wegen der Naturwissenschaften und aus einer realistischen Warte, nicht mit Religion und Romantizismus. Die Spannungen zwischen Vater und Sohn waren auch die zwischen einer Ära und einer anderen. Dass Ferdinand den Stellenwert der ästhetischen Erziehung bei Kindern so sehr betonte, beeinflusste jedoch zweifellos die allgemeine Entwicklung seines Sohnes und insbesondere die seiner Vorstellungskraft.
Ein Musterschüler
Es erwies sich als vorteilhaft, dass das Potsdamer Gymnasium auf Helmholtz’ Selbststudium, der Unterrichtung durch seinen Vater und dem Grundschulwissen aufbauen konnte. Von Beginn seiner Gymnasialzeit (Frühling 1830) bis zum Ende (Herbst 1838) war Helmholtz ein sehr guter, wenn nicht sogar hervorragender Schüler. Bereits im ersten Semester galt sein Betragen als »recht gut«, seine Aufmerksamkeit und Teilhabe während des Unterrichts als »selbstthätig u. gut« und sein Fleiß und Fortschritt als allgemein lobenswert. Die einzigen kleineren Kritikpunkte betrafen das Rechnen, seine Handschrift und seine Ordnungsliebe. Ferdinands Kollegen wussten natürlich, wen sie da vor sich sitzen hatten, was ihre Einschätzungen beeinflusst haben mag. Ferdinand bewertete Hermanns Verhalten und Fähigkeiten ganz ähnlich. Als sein Sohn zwölf Jahre alt war, schrieb Ferdinand an Fichte, dass Hermann sehr talentiert sei und vorankomme, ohne sich anstrengen zu müssen, räumte aber ein, dass er ihm aufgrund seiner schwachen Gesundheit nicht zu viel abverlange. Hermann wurde oft als allzu ernst und ruhig eingeschätzt, war nach Auskunft seines Vaters aber im Umgang mit anderen Kindern sehr kommunikativ und fröhlich. Der junge Helmholtz verfügte jedenfalls über Talent und Selbstdisziplin – beides sollte für seine wissenschaftliche Karriere von größter Bedeutung sein.15
Zum Ende seiner Gymnasialzeit hatte sich das Urteil der Lehrer über Helmholtz im Grunde kaum verändert. Sein Betragen und seine Aufmerksamkeit galten als »gut, stäts ernst u. verständig und dabei von reger Theilname für alle Gegenstände des Unterrichts zeugend«. Er hatte nie gefehlt, sein »Fleiss und Ordnung in den schriftl. Arbeiten« wurden als »löblich« bezeichnet. Der Turnlehrer bewertet ihn als eifrigen und »zurückhaltenden, gesetzten, aber gegen die jüngeren Mitschüler sehr wohlwollenden Schüler«.16 Schon als Jugendlicher hatte Helmholtz sich Gewohnheiten und Tugenden wie Disziplin, hartes Arbeiten und Durchhaltevermögen angeeignet. Er kam mit seinen Aufgaben zurecht und erledigte sie pünktlich.
Wie alle anderen Gymnasiasten hatte er Unterricht in Latein, Griechisch, Französisch und Deutsch; auch gehörte er zu den wenigen, die zusätzlich Hebräisch lernten. Ferdinand hatte ihm schon zu Hause etwas Latein beigebracht, am Gymnasium wurden seine Kenntnisse als »löblich« bezeichnet, nur schriftlich bestehe noch Verbesserungsbedarf. Auch seine Fortschritte im Übersetzen seien »recht gut«. In Griechisch galt er als »sehr gut«, sein Fortschritt als »erfreulich«. Für Französisch attestierten ihm die Lehrer ein »recht gut« und nannten seinen Fortschritt »gut«, im Deutschunterricht erhielt er ein »eifrig«, sein Fortschritt wurde wiederum als »recht gut« bezeichnet. Mit Blick auf das Hebräische würdigte das Zeugnis den Umstand, dass Helmholtz die Abschlussprüfungen abgelegt hatte, obwohl er Medizin studieren wollte; alles in allem habe er »löbliche Anstrengungen« an den Tag gelegt. Doch damit nicht genug des Sprachenlernens. Helmholtz nahm zusätzlich noch private Englisch- und Italienischstunden und lernte sogar etwas Arabisch. Was die Wissenschaften anging, so galten Helmholtz’ Fleiß und Fortschritt in Religionslehre als »gut«, in Geschichte und Geographie als »sehr gut«, und in Mathematik und Physik war sein Fleiß »lobenswerth«, sein Fortschritt »ausgezeichnet«.17 Er war also auf vielerlei Gebieten talentiert und ehrgeizig. Sein Sprachtalent und seine soliden Kenntnisse in den anderen Fächern erwiesen sich später als wesentlich für seinen Erfolg im Medizinstudium sowie als Wissenschaftler. Seine Ausbildung am Gymnasium war breit gefächert, seine Leistung insgesamt kaum zu toppen.
Drei Punkte verdienen indes, an Helmholtz’ schulischen Leistungen besonders hervorgehoben zu werden: Erstens die Tatsache, dass er – obwohl Sohn eines frommen Vaters, der stets den Stellenwert der Religion im Allgemeinen und des Christentums im Besonderen betonte – seine schlechtesten Noten im Religionsunterricht erhielt. Dabei wurde dem jungen Mann eine recht intensive religiöse Erziehung zuteil, darunter acht Jahre christlicher Religionsunterricht am Gymnasium. Nach Helmholtz’ eigenen Angaben hatte ihn der Potsdamer Bischof persönlich die Gebote der göttlichen Religion gelehrt und ihn in die christliche Gemeinschaft aufgenommen; er versicherte, dessen Andenken für immer in seiner dankbaren Seele bewahren zu wollen.18 Im Alter von 17 verfügte Helmholtz jedenfalls über ein umfassendes Verständnis der lutherischen Lehre und Glaubenspraxis und scheint auch durchaus gläubig gewesen zu sein.
Zweitens fällt auf, wie leicht sich Helmholtz anscheinend mit alten Sprachen, Literatur und Geschichte tat. Das will nicht recht zu seinen späteren Angaben passen, er habe Probleme mit Fremdsprachen gehabt, die Geschichte sei ihm besonders schwergefallen, und Prosatexte auswendig zu lernen, sei gar eine »Marter« gewesen. Er eignete sich in der Schule allerdings »kleine mnemotechnische Hülfsmittel« an, um Gedichte leichter auswendig zu lernen. Er kannte einige Gesänge der Odyssee, viele Oden des Horaz und zahlreiche deutsche Gedichte und wurde schließlich ein »grosser Bewunderer der Poesie«. Seinen Vater bezeichnete er, wie bereits erwähnt, als einen enthusiastischen Mann, der »begeistert für die Dichtkunst, besonders für die grosse Zeit der deutschen Literatur« gewesen sei und Herrmanns Bemühungen um Sprache und Literatur gefördert habe. Mit Ferdinands Hilfe lernten Hermann und seine Mitschüler also, sich auszudrücken. Diesem Deutschunterricht hatte Helmholtz viel zu verdanken, was er später in seinen populärwissenschaftlichen und philosophischen Vorträgen einsetzen konnte. Der Lateinunterricht war in seinen Augen nützlich gewesen »für die Ausbildung des syntaktischen Gefühls«, Griechisch hingegen empfand er als »für die eigentliche Ausbildung des Geschmacks, nicht blos für sprachliche, sondern auch für sittliche und ästhetische Dinge« unabdingbar. Helmholtz und seine Mitschüler verbrachten sehr viel Zeit damit, klassische Autoren zu lesen – oft noch nach der Schule. Helmholtz selbst lobte seine Lehrer in den geisteswissenschaftlichen Fächern in den höchsten Tönen, wenn auch zweifelsohne teils aus Höflichkeit.19 Dennoch sensibilisierten sie ihn ebenso wie sein Vater für andere Zivilisationen und Kulturen und ihre Eigenheiten. Sie alle flößten ihm Bildung ein.
Die dritte Auffälligkeit, die zur Sprache kommen sollte, liegt darin, dass Helmholtz’ wahre Interessen und Begabung der Physik galten. Schon als Kind hatte er angeblich das starke Bedürfnis verspürt, sich auf die »Wirklichkeit« zu konzentrieren (anstatt auf philosophische Theorien wie die von Fichte oder Hegel) sowie auf Gesetze, welche die Dinge miteinander verbanden. Die Physik mit ihren gesetzmäßigen Strukturen kam dieser Neigung am besten entgegen. Sie half ihm, die »Wirklichkeit« zu verstehen, und hielt zugleich die Anforderungen an sein Gedächtnis relativ gering. Denn »[d]as vollkommenste mnemotechnische Hülfsmittel«, so schrieb er später, »ist aber die Kenntnis des Gesetzes der Erscheinungen«. An zweiter Stelle stand für ihn die Mathematik, auch deshalb, weil er ihr eine der physikalischen Wirklichkeit untergeordnete Rolle beimaß. Die »volle Wirklichkeit« der Physik war ihm lieber als die bloße Abstraktion der Mathematik. Seine mathematischen Fähigkeiten schätzte er als jenen seiner Mitschüler auf dem Gymnasium und später seiner Kommilitonen im Medizinstudium vergleichbar ein.20 Damit stellte er sein Licht wohl gehörig unter den Scheffel.
»Meine Neigung und mein Interesse waren«, würde er später schreiben, »von früher Jugend an der Physik zugewendet«. Es war sein Traum, die physikalischen Gesetze der Natur zu verstehen. Sein Interesse an der Physik und den Naturwissenschaften allgemein hätte sich aber ohne die indirekte Unterstützung der Eltern kaum voll entfalten können. »Ich stürzte mich mit Freude und grossem Eifer auf das Studium aller physikalischen Lehrbücher, die ich in der Bibliothek meines Vaters vorfand«, schreibt Helmholtz und merkt an: »Es waren sehr altmodische« (die sich beispielsweise noch mit dem Phlogiston befassten). Zur Lektüre gesellten sich erste Experimente daheim: Mit einem Freund zusammen probierte er, was Säure mit den Laken ihrer Mütter anstellen würde. Am Ende waren die Leintücher befleckt und die Gewissen der Jungs ebenfalls. Der junge Helmholtz baute auch optische Instrumente aus alten Augengläsern des örtlichen Optikers und nahm die Botanikerlupe seines Vaters in Beschlag. Vielleicht lag es daran, dass er als Junge nur begrenzte Ressourcen für seine Experimente zur Verfügung gehabt hatte, wenn er später als professioneller Wissenschaftler stets das Maximum aus begrenzten Mitteln herauszuholen trachtete.21 Nie hatte er mit einer »Identitätskrise« zu kämpfen, schon als Jugendlicher wusste er einfach, dass er nichts anderes werden wollte als ein Wissenschaftler – will meinen: ein Physiker. Aus finanziellen Gründen war der Weg dorthin zwar lang und steinig, aber dennoch erreichte er irgendwann sein Ziel.
Dass aus Helmholtz ein Wissenschaftler wurde, verdankte sich ein Stück weit auch dem Umstand, dass seine Eltern sich für Potsdam entschieden hatten. Dort aufzuwachsen, brachte manche Vorteile mit sich: In seiner Jugend durchstreifte er gerne die Potsdamer Hügel, Wälder, Felder und Gärten. Er liebte die Havel und die zahlreichen Seen der Stadt und genoss es, sich im und am Wasser aufzuhalten. Später, als Erwachsener, sollte er sich mit Strömung beschäftigen. Seit seiner Teenagerzeit unternahm er Wanderungen, die auch der Erholung von Körper und Geist dienen sollten. Der erste Ausflug dieser Art fand im Juli 1837 statt, als er mit ein paar Freunden eine Wanderung in den Harz unternahm. Unterwegs besuchten sie verschiedene Städte und sonstige Sehenswürdigkeiten. Helmholtz bewunderte die Flora, die Landschaft, die ganze ländliche Gegend. Aus seinen Spaziergängen in Potsdam entwickelte sich eine Liebe zur Natur und der Wunsch, sie zu verstehen. Die körperliche Erfahrung schärfte und festigte, was er in den Büchern gelesen hatte. »Auch war in der That das Erste, was mich fesselte, vorzugsweise die geistige Bewältigung der uns anfangs fremd gegenüberstehenden Natur durch die logische Form des Gesetzes. Aber natürlich schloss sich bald die Erkenntnis an, dass die Kenntnis der Gesetze der Naturvorgänge auch der Zauberschlüssel sei, der seinem Inhaber Macht über Natur in die Hände gebe.« Die Gesetze der Natur zu verstehen, verlieh ihm ein Gefühl der Macht und säte in ihm den Wunsch, Wissenschaftler zu werden: »Dieser Trieb, die Wirklichkeit durch den Begriff zu beherrschen, oder was, wie ich meine, nur ein anderer Ausdruck derselben Sache ist, den ursächlichen Zusammenhang der Erscheinungen zu entdecken, hat mich durch mein Leben geführt, und seine Intensität war wohl auch Schuld daran, dass ich keine Ruhe bei scheinbaren Auflösungen eines Problems fand, solange ich noch dunkle Punkte darin fühlte.«22
Den ersten Kontakt mit der Philosophie verdankte Helmholtz ebenfalls seinem Vater: »Das Interesse für die erkenntnistheoretischen Fragen ward mir schon in der Jugend eingeprägt, dadurch dass ich meinen Vater, der einen tiefen Eindruck von Fichte’s Idealismus behalten hatte, mit Collegen, die Hegel und Kant verehrten, oft habe streiten hören.« Später liebte er derlei Dispute freilich nicht.23
Sein Mathematik- und Physiklehrer Karl Ferdinand Meyer war auf naturwissenschaftlichem Feld wohl sein größtes Vorbild. Über Meyer bestand auch eine Verbindung zu zwei wegweisenden Persönlichkeiten der deutschen Wissenschafts- und Mathematikszene: dem Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel und dem Mathematiker Carl Gustav Jacob Jacobi, einem Alumnus des Potsdamer Gymnasiums. Unter ihrer Anleitung wurde Meyer zu dem ausgezeichneten Sekundarschullehrer, für den seine Vorgesetzten – darunter auch Ferdinand Helmholtz – ihn hielten. 1838 veröffentlichte er einen Aufsatz zur Optik. Dieses Thema und seine Ausbildung in Berlin und Königsberg beeinflussten auch Helmholtz’ Interessensfelder und Karriere. Für den Physikunterricht verwendete Meyer Ernst Gottfried Fischers Lehrbuch der mechanischen Naturlehre, das sich intensiver als andere Lehrbücher mit Mechanik, mathematischen Ansätzen für physikalische Problemstellungen, der Verknüpfung von Experimenten und Theorie sowie der Durchführung von Messungen befasste. Noch in der Tertia schrieb Helmholtz einen Aufsatz über die Experimente von Benjamin Thompson (Graf von Rumford) und Humphrey Davy zur Reibungswärme. Mehrfach ging es in seiner Schulzeit auch um die Unmöglichkeit, ein Perpetuum mobile zu konstruieren. Nimmt man all das zusammen – den vorzüglichen Lehrer, das gut ausgestattete Physiklabor und die Arbeit mit einem hervorragenden Physiklehrbuch –, so lassen diese geballten pädagogischen Ressourcen vermuten, dass das Potsdamer Gymnasium zu den fortschrittlichsten und intellektuell anspruchsvollsten Schulen seiner Zeit gehörte. In jedem Falle erlernte Helmholtz dort ausgezeichnete physikalische Grundlagen. »Ich muss gestehen, dass ich manchmal, wenn die Klasse Cicero oder Virgil las, welche beide mich höchlichst langweilten, unter dem Tische den Gang der Strahlenbündel durch Teleskope berechnete und dabei schon einige optische Sätze fand, von denen in den Lehrbüchern nichts zu stehen pflegte, die mir aber nachher bei der Construction des Augenspiegels nützlich wurden.«24
Schulabschluss
Als Teenager nahm sich Helmholtz jeden Sommer für mehrere Wochen frei, um wandern zu gehen – ein Rhythmus, den er sein Leben lang beibehalten sollte. Als er im Juli 1838 seine Kursarbeiten für das Gymnasium abgeschlossen hatte, noch nicht aber die Abschlussprüfungen, machte er Urlaub bei Verwandten in und um Berlin. Im August kehrte er nach Potsdam zurück, bereit für seinen Schlussakt am Gymnasium, dreieinhalb Tage voll anspruchsvoller Prüfungen. Sein Vater wollte ihn anfangs davon abhalten, die Prüfungen abzulegen, schließlich sah er ihn nicht am Schreibtisch sitzen und lernen, sondern stattdessen durch den Wald wandern. Ferdinand fürchtete, sein Sohn habe sich nicht ordentlich vorbereitet (tatsächlich war Helmholtz sein ganzes Leben lang das Sitzen am Schreibtisch zuwider). Irgendwann gab Ferdinand dann nach, und Hermann absolvierte die Prüfungen.25
Dafür musste er vier mathematische Probleme lösen und eines in Physik, einen Aufsatz zu einem Stück deutscher Literatur schreiben sowie griechische, lateinische, französische und hebräische Texte übersetzen. Das Matheexamen umfasste Aufgaben aus Geometrie und Algebra, in Physik sollte Helmholtz das Gesetz des freien Falls diskutieren. Meyer schreibt, Helmholtz’ Bearbeitung der Matheaufgaben zeuge von »grosser Klarheit und Festigkeit des Verfassers«, alles in allem sei die Arbeit »ausgezeichnet«. (Anscheinend äußerte er später Ferdinand gegenüber, Herrmann sei einer der besten Schüler, die er je gehabt hatte.) Helmholtz selbst urteilte im Nachhinein, von den Sprachprüfungen sei ihm der Lateinaufsatz am schlechtesten gelungen. In der Hebräischprüfung musste er ausgewählte hebräische Begriffe aus dem Deuteronomium erklären, und zwar in lateinischer Sprache. Die Abschlussklausur in Griechisch war eine Übersetzung eines Euripides-Textes, das Ergebnis war mehr als zufriedenstellend. Seine Französischübersetzung bewertete der Lehrer als nahezu frei von Grammatikfehlern, idiomatisch angemessen und allgemein sehr gut.26
Am aufschlussreichsten war jedoch seine Deutschprüfung, denn sie gibt einen ersten deutlichen Hinweis auf seine generelle Lebenseinstellung. Das Thema des Deutschaufsatzes lautete: »Die Idee und Kunst in Lessings Nathan der Weise«. Helmholtz schreibt, er »bewunderte« Lessing, dieser sei »ausgezeichnet sowohl durch klare (verständige) und scharfsichtige Forschung in der Wissenschaft, wie durch lebendige und kunstvolle Darstellung in der Poesie«. Zudem sei er davon beeindruckt, wie Lessing stets »die Charaktere meisterhaft wahr und tief« zeichnete, und befand, dass Lessing sich mit seinem Nathan selbst übertroffen habe. Den Juden, der in Lessings Drama im Zentrum steht, beschrieb Helmholtz als den Vornehmsten und Weisesten seines Volkes, der die große Wahrheit erkannt habe, dass alle Menschen Brüder seien. Trotz aller religiösen Unterschiede existiere in ihnen allen, ohne jeden Unterschied, die Liebe dieses Juden, der durch sein hohes geistiges Ideal das Herz des Christen und des Muslims gewinne und sie zu einer liebenden Familie zusammenführe. Darin bestand für Helmholtz das Herz der Dichtung. Er hielt nichts von den Figuren, die religiöse Vorurteile an den Tag legten. Die Kernidee des Stücks sah er vielmehr darin, dass es unter den Völkern aller Glaubensrichtungen gute Menschen geben könne, die danach strebten, den einzigen Weg zum Himmel zu finden – nicht mittels enger Befolgung religiöser Vorschriften, sondern eher davon befreit. Sie schlössen alle Menschen in das gleiche Band der Liebe ein und gelangten so zu wahrer Tugend. Lessing offenbare, so Helmholtz weiter, in seinem Nathan die tiefste, gottgefälligste Lektion unserer heiligen Religion, die leider allzu oft vergessen werde. Lessings Nathan sei kein Jude mehr, Saladin kein Muslim – nach ihren inneren Überzeugungen seien sie vielmehr wahre Christen. Dem Dichter werde daher zu Unrecht vorgeworfen, er lehne alle Religionen ab und wolle an ihrer statt allein die Vernunft setzen.
In Helmholtz’ Lesart blieb seine eigene Religion heilig. Nathan und Saladin hatten sich vom Juden und Muslim zu Christen entwickelt – und Lessings Deismus vollkommen aufgelöst. Helmholtz bewunderte vor allem Nathans Tugenden: sein klares Verständnis und sein tiefes, inneres Empfinden. Ferdinand kritisierte den Aufsatz streng, er zeige »mehr Ausbildung des Vermögens der Auffassung als der Reflexion«. Die konzeptionelle Analyse der Hauptgedanken des Stücks befand er als schwach, jedoch attestierte er seinem Sohn eine gute Auffassung der poetischen Wirkung. Er fasste die Arbeit insgesamt als ganz genügend zusammen.27 In jedem Falle aber werden an Helmholtz’ Aufsatz sein Toleranzverständnis und seine Verwurzelung in der Aufklärung deutlich.
Im September bewertete auch die königliche Prüfungskommission Helmholtz. Sie führte sein »höchst anständiges und bescheidenes Betragen« an sowie »sein äußerlich ruhiges und still gehaltenes Wesen«, welches »mit großer Beweglichkeit des Geistes verbunden« sei. Die Kommission war voll des Lobes für seine Verständigkeit und schrieb von »tiefer Gemütlichkeit«. Die Sitten des Prüflings zeugten »von einer treubewahrten seltenen Reinheit und wahrhaft kindlicher Unverdorbenheit«. Generell bescheinigte die Kommission Helmholtz geistige Reife, ihre Mitglieder setzten große Hoffnungen in seine Zukunft und vermerkten den Ehrgeiz, mit dem er seine Fähigkeiten entwickele. Der Absolvent sei sehr fleißig und ordentlich, habe regelmäßig am Unterricht teilgenommen und seine schriftlichen Arbeiten eingereicht.28
So viel zum Abiturienten Helmholtz im Allgemeinen. Was die einzelnen Fächer angeht, so befand die Kommission, er sei in der Lage, lateinische Autoren problemlos zu lesen und zu übersetzen. Seine Griechischkenntnisse zeichneten sich »durch Gründlichkeit und einen beträchtlichen Umfang« aus. Seinen Fleiß im Hebräischen lobte die Kommission, und auch im Fach Deutsch erhielt Helmholtz eine wohlwollende Beurteilung. Beim Leseverständnis der französischen Autoren habe er eine »rühmliche Fertigkeit« an den Tag gelegt. Die englische Lektüre fiel ihm leicht, und das betraf nicht nur die modernen Autoren, sondern auch Shakespeare und andere Dichter. Dasselbe gelte für italienische Autoren. Die Kommission beurteilte weiterhin sein geschichtliches und geographisches Wissen als gut und hielt ihn für firm in der christlichen Lehre und Ethik. Die Grundlagen der Logik und Rhetorik seien ihm ebenso bekannt wie etwas Psychologie. Helmholtz’ mathematisches Wissen überschritt laut dem Bericht den im Gymnasium vermittelten Stoff, und sein fleißiges Eigenstudium auf diesem Feld wurde vermerkt. Auch Helmholtz’ fundierte physikalische Kenntnisse fanden Erwähnung. Seine Fähigkeiten im Zeichnen kamen hingegen nur als elementar weg. Im Singunterricht habe der Schüler sich sehr bemüht und auch einiges erreicht. Will man abschließend einen vergleichenden Blick wagen, so kann man das intellektuelle Niveau und den Schwierigkeitsgrad von Helmholtz’ gymnasialen Kursarbeiten im Abschlussjahr und die finalen Prüfungen getrost als höher und strenger bewertet ansiedeln als Charles Darwins Examen an der Cambridge University um 1830. Im Herbst 1838, nach achteinhalb Jahren Gymnasialzeit, schloss der 17 Jahre alte Helmholtz (frühzeitig) die Schule ab und erhielt ein Abschlusszeugnis, das ihm grundsätzlich erlaubte, an einer deutschen Universität zu studieren.29 Dass er in allen Fächern so gut abgeschnitten hatte, ließ spätere akademische Erfolge fast schon erwarten.
Ein Medizinstudium als Ersatz
Seine Eltern und das Gymnasium hatten Helmholtz eine kulturelle Grundhaltung vermittelt, in der die Werte Arbeit, Disziplin und Fleiß viel galten und vorgelebt wurden. Das half ihm, einen Sinn und Zweck im Leben zu finden, und stattete ihn mit dem nötigen intellektuellen Handwerkszeug und der moralischen Basis aus, um seine wissenschaftlichen und anderen Ziele zu erreichen. Ferdinand verfügte jedoch nicht über die notwendigen finanziellen Mittel, um seinem Sohn eine universitäre Ausbildung zu finanzieren; zudem glaubte er, Hermann würde als Physiker kaum Chancen auf eine Stelle haben. Daher schlug er seinem Sohn vor, Medizin zu studieren, und zwar am Medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut in Berlin, der medizinischen Hochschule der preußischen Armee, wo er weitgehend »gratis« studieren konnte. Später erklärte Helmholtz: »Mein Vater, ein in recht knappen Verhältnissen lebender Gymnasiallehrer, aber ein Mann, der die hochfliegende, wissenschaftliche Begeisterung der Fichte’schen Philosophie und Freiheitskriege sich lebendig bewahrt hatte, erklärte mir, so leid es ihm selber thun mochte, Physik sei keine Wissenschaft, die einen Lebensunterhalt gewähren könne, – damals war sie das in der That nicht – aber wenn ich Medizin studiren wolle, so würde ich auch Naturwissenschaften treiben können.« Diese Erklärung brachte Helmholtz später immer wieder gerne an. Aus finanziellen Gründen also entschied er sich für die medizinische Laufbahn, ein besonderes intellektuelles oder moralisches Interesse an der Medizin besaß er nicht. Das Medizinstudium würde ihm aber zumindest erlauben, mit den Naturwissenschaften in Kontakt zu sein, und er könnte vielleicht später seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Also akzeptierte er die Situation bereitwillig.30 Dass Helmholtz der Einschätzung seines Vaters folgte, zeigt seinen starken Sinn für Gehorsam. Er machte seinem Vater auch nie einen offenen Vorwurf in der Sache, noch zweifelte er seine eigene Wahl im Nachhinein an. Hieran lässt sich exemplarisch erkennen, wie er später auch an wissenschaftliche Fragestellungen heranging: Er wählte das Konkrete und Machbare aus, entschied sich für Probleme, die lösbar waren. Seine Entscheidung war die eines pflichtbewussten Sohnes, eines verarmten Realisten und die eines selbstbewussten Schülers. Dass sein Vater ihm davon abriet, Physiker zu werden, befeuerte möglicherweise (und ironischerweise) noch seinen Wunsch danach. Das würde zumindest erklären, weshalb er weiter im Bereich der Physik forschte und sein Leben lang seine Ergebnisse veröffentlichte.