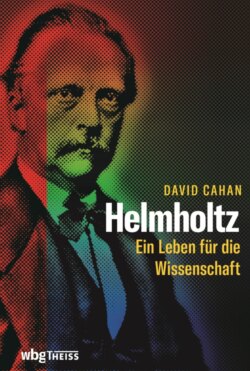Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Wissenschaftliches Networking Königsberg am Meer
ОглавлениеKönigsberg, die größte Stadt in Preußens wildem Osten und Hauptstadt der Provinz Preußen, war ein Ort, an dem sich Regierungsvertreter, Militärs und Geschäftsleute tummelten. Früher einmal die Heimat der Deutschordensritter blickte Königsberg auf eine lange Tradition als regionales Machtzentrum zurück. Hier wurden mehrere Monarchen aus dem Hause Hohenzollern gekrönt. Dank seiner Lage an der Pregelmündung im Samland, über das Frische Haff mit der Ostsee verbunden, diente Königsberg als Umschlaghafen, der sich seiner Handelskontakte zum preußischen, russischen und litauischen Hinterland wie zu weiter entfernten Regionen rühmen konnte. Das Umland wurde von den Junkern regiert, die auf weitläufigen Landsitzen lebten. Wirtschaftlich setzte Ostpreußen vor allem auf die Getreideproduktion.
Als in den 1830er- und 1840er-Jahren ein Eisenbahnnetz die deutschen Staaten zu verbinden begann, rückte auch das ferne Königsberg näher an die deutschen und slawischen Nachbarn heran, sein Zugang zum Meer blieb jedoch essenziell. Helmholtz glaubte, das Meer sei für die Ostpreußen, was anderen die Alpen seien. In den sechs Jahren, die er in dieser Stadt verbrachte, sinnierte er viele Stunden über die »steilen, waldreichen Küsten des Samlandes«. Oftmals verlor er sich im Anblick der Meereswellen und ihres Wechselspiels. Diese Vielfalt, so befand er, »fesselt und erhebt den Geist, da das Auge Ordnung und Gesetz leicht in ihr erkennt«.1 Helmholtz verbrachte gerne Zeit an Gewässern, sie entspannten und inspirierten ihn. Die Kraft, die Schönheit und der Frieden, die von der Königsberger Küste und dem Meer ausgingen, waren ein Ausgleich dafür, die Potsdamer Gärten, Wälder und Seen verloren zu haben.
Königsberg war auch die Heimat von Kant, der dort sein gesamtes Leben verbracht hatte, und in der Kulturszene war sein Name untrennbar mit der Stadt verbunden. Kants Philosophie machte Königsberg zu einem Zentrum der Aufklärung. Seine idealistischen Theorien zur reinen und praktischen Vernunft sowie zur Urteilskraft machten Königsberg ebenso wie seine Analysen der Natur von Wissenschaft, Moral und Religion, des Menschen und des Friedens zu einer intellektuellen und liberalen Hochburg. Dennoch waren es noch immer hauptsächlich Studenten aus dem Umland, die es an die Königsberger Universität zog. Helmholtz und andere sahen die Stadt als »abgelegene[n]« Ort, der Kant teilweise »beschränkt« hatte.2 Gewiss, die Universität und ihr Lehrkörper waren weitaus weniger wichtig für Königsberg als ihre Pendants in kleinen deutschen Universitätsstädten wie Göttingen, sie konnten nicht mit den Politikern und Geschäftsmännern mithalten. Auch die Kunst gedieh nicht in gleichem Maße wie in manch anderer, zentral oder im Westen gelegenen deutschen Metropole. In der Mitte des Jahrhunderts war Königsberg noch immer ein entfernter, isolierter und (vielen) unbekannter Ort – kalt, klamm, lutherisch.
Dennoch war wohl die Universität – liebevoll Albertina genannt – das Zentrum des städtischen kulturellen Lebens. Sie gehörte zu den ältesten ihrer Art in Deutschland, war stark evangelisch geprägt und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den vorgeblich barbarischen Osten zu zivilisieren. Sie galt als liberal und reformorientiert; was die Studentenzahlen anging, lag sie in Deutschland im Mittelfeld. Als Helmholtz für sein erstes Semester (1849/50) dorthin kam, waren ungefähr 300 Studenten eingeschrieben, bei seinem Fortgang nach dem Sommersemester 1855 waren es circa 350. Da ein Großteil von ihnen jedoch arm war, brachten sie wenig Seminargebühren ein, die dem Einkommen eines Fakultätsangestellten hätten zugutekommen können. Die Albertina verfügte nur über begrenzte Möglichkeiten und veraltetes Inventar.3 (Siehe Abb. 5.1.)
Abb. 5.1:Die Albertus-Universität zu Königsberg: Eine Denkschrift zur Jubelfeier ihrer 300-jährigen Dauer in den Tagen vom 27sten bis 31sten August 1844 (Königsberg: H. L. Voigt, 1844), Frontispiz. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen.
Dennoch war Königsberg etwa seit 1830 bis in die Mitte der 1850er-Jahre eine der besten deutschen Universitäten für Mathematik und die Naturwissenschaften. Diesen Ruf hatte die Albertina vor allem der innovativen Lehr- und Forschungstätigkeit der Mathematiker Carl Gustav Jacob Jacobi und Friedrich Julius Richelot, des Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel, der Physiker Franz Ernst Neumann und Ludwig Moser sowie der Anatomen und Physiologen Karl Friedrich Burdach und Karl Ernst Baer zu verdanken. Zu Helmholtz’ Zeiten waren nur noch Richelot, Neumann und Moser dort oder am Leben. Neumann, mit seinem innovativen mathematisch-phsyikalischen Seminar, und Bessel, mit seiner konsequenten Fehleranalyse, taten sich mit ihrer Forderung nach präziser, gründlicher und empirischer Forschung hervor und waren dahingehend richtungsweisend.4
Das kulturelle Leben der Stadt war geprägt von diversen wissenschaftlichen, literarischen und kulturellen Vereinigungen. Mit dreien davon hatte Helmholtz näher zu tun. Bei der ersten, der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft, handelte es sich um eine von Bürger- und Akademikerkreisen getragene Vereinigung aus dem Jahr 1789, eine von Hunderten patriotisch und wirtschaftlich orientierten Gesellschaften, die während der Aufklärung in Mitteleuropa entstanden. Ursprünglich sollte damit die Landwirtschaft gefördert werden, weshalb sich die Gesellschaft für die lokalen (und konservativen) Interessen der ländlichen Elite stark machte. Zu Helmholtz’ Zeiten hatte sich die Vereinigung jedoch zu einer vor allem wissenschaftlich orientierten Gesellschaft gewandelt, deren Ziel es war, Wissenschaft populärer zu machen. Kurz nach seinem Umzug nach Königsberg trat er ein und wurde auch sogleich aktives Mitglied, indem er auf Anfrage einen Vortrag über Brückes Dissertation zu den physikalisch-chemischen Grundlagen von Diffusionsvorgängen hielt. 1852 wurde Helmholtz zum Direktor der Gesellschaft gewählt und war 1853 – 1854 ihr Präsident. Die zweite Vereinigung, in der er Mitglied war, nannte sich Deutsche Gesellschaft zu Königsberg und beschäftigte sich mit Literatur. Auch sie entstand während der Aufklärung (1741), war jedoch stark patriotisch-monarchistisch ausgerichtet und trat für die Wertschätzung der deutschen Geschichte, Sprache, Literatur und Kunst ein – vor allem, wenn sie mit Deutschland und Preußen zu tun hatten. Die Deutsche Gesellschaft war vor allem ein Ort für tiefgründige Diskussionen. Helmholtz war noch Mitglied bei einer dritten Vereinigung, dem Verein für wissenschaftliche Heilkunde, der Ende Oktober 1851 von ein paar Königsberger Ärzten ins Leben gerufen wurde. Auch hierbei taten sich Bürger und Universitätsangehörige zusammen mit dem Ziel, die Medizin als Wissenschaft und Kunst zu fördern und praktizierende Königsberger Mediziner zusammenzubringen. Das Ganze ging von Helmholtz aus, er war Gründungsmitglied und wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt (und blieb es, bis er die Stadt verließ).5 Diese drei Vereine trugen zu Königsbergs liberaler Atmosphäre und Ruf bei und ermöglichten es Helmholtz, Beziehungen mit der nichtakademischen kulturellen und geschäftlichen Elite der Stadt aufzubauen. So halfen sie ihm, seine persönliche Karriere zu befördern, nicht ohne dabei das Gemeinwohl aus den Augen zu verlieren. Helmholtz’ Engagement lässt an die Mitgliedschaft seines Vaters in ähnlichen Vereinen in Potsdam denken.
Im August 1849 zogen Hermann und Olga in ihre erste Wohnung in Königsberg, später würden zwei weitere Umzüge innerhalb der Stadt folgen. Kurz nach ihrem Einzug kam auch Olgas Mutter nach Königsberg, um näher bei ihnen zu sein. Das Ehepaar füllte sein Zuhause mit Musik. Hermann war sehr gerne verheiratet und gab du Bois-Reymond unaufgefordert folgenden Ratschlag:
Nachdem wir übrigens nun mit dem Einrichten unserer Häuslichkeit fertig geworden sind, ist dieselbe sehr nett und behaglich geworden, und wir können unbeschränkt und ungestört die glücklichste Zeit des Lebens durchgenießen. Ich kann dir mit bestem Gewissen empfehlen, Dir bei erster Gelegenheit eine ebenso liebenswürdige Frau anzuschaffen, wie ich sie mir erworben habe. Denn abgesehen von der für einen Junggesellen gar nicht zu beschaffenden Bequemlichkeit der Existenz und der Beseitigung einer Menge von Dingen, um die man sich sonst notwendig bekümmern muß, gibt es dem Geiste eine so vollständige Befriedigung in der Gegenwart, eine so ruhige Sicherheit des Besitzes, daß auch meine Arbeitsfähigkeit beträchtlich wieder zugenommen hat.
Am 22. Juni 1850 wurde ihr erstes Kind geboren, Katharina Caroline Julie Betty Helmholtz, genannt Käthe. Helmholtz war nun Vater von einem »wohlgebildeten und gesunden Mägdlein«; Tochter und Mutter waren erst wohlauf, doch kurz nach Käthes Geburt bekam Olga schlimmen Husten.6 Der Husten, der sowohl von Königsbergs rauem Klima als auch den Strapazen der Geburt herrühren mochte, wurde chronisch und sollte ihr, Käthe und Helmholtz zum Verhängnis werden.
Das Paar lernte schnell neue Freunde kennen, darunter der Anatom Martin Heinrich Rathke und der Physiologe Wilhelm Heinrich von Wittich. Im Jahre 1826 waren in Königsberg aus ihren Fachgebieten eigenständige Disziplinen geworden. Der Entwicklungsbiologe Rathke war ein ehemaliger Student von Müller und von Baers Nachfolger. Wittich, ein Histologe, arbeitete mit Helmholtz und wurde 1850 Privatdozent, 1854 löste er Helmholtz als außerordentlichen Professor der Physiologie ab. Von keinem der beiden war Helmholtz anfangs sonderlich beeindruckt. Sein Urteil zu Wittich überdachte er jedoch später und äußerte, er sei ein »talentvoller und geschickter Mikroskopierer«. Mehr als jeder andere in Königsberg hatte Wittich es Helmholtz vor allem angetan, weil er »besonders nützlich« war: Er unterrichtete freiwillig Histologie – worauf Helmholtz keine Lust hatte.7
Anfänglich vermutete Helmholtz, er würde engere kollegiale Beziehungen zu den »Mathematikern« (sprich exakten Naturwissenschaftlern) pflegen als zum medizinischen Lehrkörper. Er lernte zwar den Astronomen August Ludwig Busch flüchtig kennen, kam aber nie wirklich an Neumann, den »wichtigsten« Mann vor Ort, heran. Neumann, so Helmholtz, sei »etwas schwierig zu nahen«. Obwohl Helmholtz dessen Aufzeichnungen zum Elektromagnetismus sorgfältig las und Neumann ihn teils bei seiner Forschung unterstützte, ignorierte der »schwierige« Physiker Helmholtz’ Arbeit, öffnete sein Seminar nicht für die neuere Wissenschaftlergeneration und bezog Helmholtz’ Arbeit auch nicht ein.8
Ganz anders war das Verhältnis der Hemholtzens mit Wilhelm Friedrich Schiefferdecker und Richelot (und ihren Frauen). Schiefferdecker, ein Mediziner und Hygieniker, war Mitbegründer des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde und nahm auch in der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft eine wichtige Funktion ein. Friedrich Julius Richelot, einen »hiesigen tapferen Mathematiker, der aber etwas konfus in bezug auf nichtmathematische Logik ist und der hierselbst die Mechanik vorträgt, habe ich nach schwerem Kampf endlich zur Erhaltung der Kraft bekehrt […] so daß dieselbe an hiesiger Universität wohl offiziell werden wird«, schreibt Helmholtz. Das war jedoch ein einsamer Kampf: Helmholtz beklagte, dass sein Aufsatz noch nicht in Fortschritte der Physik besprochen war, und hoffte, er könne seine Kollegen von der Krafterhaltung gleich ebenso überzeugen wie Richelot (letztendlich rezensierte er selbst seinen Text in Fortschritte, vor 1851 fühlte sich niemand sonst dazu berufen).9
Noch ein paar weitere neue Freunde Helmholtz’ gilt es zu erwähnen: den Chemieprofessor August Werther, mit dem er täglich zur Universität lief, den Kulturhistoriker Ludwig Friedländer und die Familie von Friedrich Carl Ulrich, einem Königsberger Richter und Verwandten. Zusammen mit Wittich waren dies seine (und auch Olgas) engste Freunde in Königsberg. Während seines ersten Frühlings dort schrieb Helmholtz über die Stadt: »[Ü]brigens ein prächtiger Ort zu Arbeiten, weil er eben nicht viele Verlockungen zu etwas anderem darbietet und doch das geistige Interesse hinreichend rege erhält.« Weitere Freunde oder Bekannte waren etwa der russische Generalkonsul Moritz von Adelson und Eduard von Simson, ein Rechtsprofessor und Liberaler, der 1849 für Königsberg in den preußischen Landtag einzog. Dann war da noch Theodor von Schön, früher ein führender Reformer und preußischer Liberaler, der sich in seinem Anwesen bei Königsberg zur Ruhe gesetzt hatte. Schön war in der Stadt und Provinz noch immer ein durchaus bekannter und einflussreicher Mann. Er hatte unter Kant studiert, war einer seiner Schüler gewesen und war mit Johann Gottlieb Fichte befreundet. Der anglophile Schön war ein Verfechter der Smith’schen Ökonomie und der Industrialisierung Ostpreußens, ehemaliger liberaler Staatsminister, Oberpräsident der Provinz Preußen und Berater von Friedrich Wilhelm IV. Er setzte sich allgemein stark für die Universität ein und war gut mit vielen ihrer Wissenschaftler befreundet. Außerdem war er der Schirmherr der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft und Präsident des Vereins für Wissenschaft und Kunst. Zu Schöns Kreis zu gehören, bedeutete, Teil einer liberalen, progressiven Welt zu sein, in der die Werte und Methoden der Aufklärung gelebt wurden. Helmholtz besuchte ihn auf seinem Landsitz.10
Er stellte fest, wie wichtig Politik in Königsberg war. »Gegenwärtig ist [Johann] Jacoby der Vergötterte der Demokraten«, ließ er seinen Vater wissen, »während die Andern den bodenlosesten Abscheu gegen ihn kund thun.« Jacoby war ein Königsberger Mediziner und radikaler Demokrat, der zeitweise im Berliner Parlament saß. 1849 wurde er (zum zweiten Mal) des Hochverrats angeklagt, aber später freigesprochen. Solch eine Person konnte Helmholtz unmöglich gutheißen. »Die Demokraten berichten von ihm in den pompösesten Ausdrücken«, spöttelte er, »wie er geniest und wer zuerst prosit gesagt, als ob sich der Kaiser Napoleon in Krähwinkel aufhielte.«11 Helmholtz selbst vermied alles offen Politische.
Als homo academicus klagte er des Öfteren über seine Situation, beispielsweise bei Carl Ludwig über seine Kollegen an der medizinischen Fakultät. Ludwig, dem es 1849 gelungen war, das Handicap hinter sich zu lassen, das seine liberale politische Einstellung in Preußen bildete, indem er als Professor für Anatomie und Physiologie an die Universität Zürich ging, versicherte Helmholtz, dass es derlei Schwierigkeiten an allen medizinischen Fakultäten gab. Helmholtz’ Position fand er insofern beneidenswert, als sie es ihm erlaube, in die höheren Kreise der Physiker und Mathematiker aufzusteigen. Ludwig versäumte auch nicht, Helmholtz, den er für einen unerschütterlichen Liberalen hielt, seine liberalen politischen Ansichten mitzuteilen. Er war bekümmert über den aus seiner Sicht verabscheuungswürdigen Egoismus und Nationalismus Preußens. In der Schweiz sei Preußens Ruf so schlecht wie zuletzt 1806 bei seiner deutlichen Niederlage gegen die französischen Truppen. Ludwig sagte voraus, dass Preußen irgendwann dafür werde bezahlen müssen, wenn es nur mit Gewalt auf jegliche Forderungen nach politischer Veränderung reagiere. Er prangerte zudem das politisch reaktionäre Regime an, das Preußen seit 1849 im Griff habe – immer in dem Glauben, bei Helmholtz seien derlei Ansichten gut aufgehoben. Er hoffte, dieser werde ihn bald einmal besuchen, und lud ihn herzlich dazu ein: Es wäre ihm eine Ehre, einen Gast wie Helmholtz zu haben.12 Diese Ehre erwies Helmholtz ihm tatsächlich schon bald. In der Zwischenzeit beschäftigte er sich mit zwei wissenschaftlichen Problemen, die für sie beide von großer Bedeutung waren.
Nervenprobe
Es gehörte (und gehört noch immer) zu den festen Glaubenssätzen des deutschen Universitätssystems, dass Lehre und Forschung sich gegenseitig befruchten. Unabhängig vom grundsätzlichen Wahrheitsgehalt dieses Anspruchs war er jedenfalls die Realität für Helmholtz’ zweites akademisches Jahr in Königsberg. Das Kultusministerium hatte ihn dorthin berufen, damit er Physiologie und Allgemeine Pathologie unterrichtete. Diese Lehrverpflichtungen trugen ihm vor allem »zwei werthvolle Früchte ein«, womit er auf seine Entdeckung der Nervenleitgeschwindigkeit und die Erfindung des Augenspiegels anspielte.13 Diese beiden Erkenntnisse überschnitten sich zeitlich und müssen vor dem Hintergrund ihres Lehrumfelds vor Ort und des europäischen Forschungskontexts betrachtet werden. Die Anstellung Helmholtz’ an der Königsberger medizinischen Fakultät war, wie schon diejenige Brückes im Jahr zuvor, ein Ausdruck großen Interesses von universitärer Seite, den Studenten die physiologischen (sprich naturwissenschaftlichen) Grundlagen der Medizin nahezubringen. Die Ausbildung der Medizinstudenten sollte nicht länger derjenigen nachstehen, welche die Studenten der Naturwissenschaften bei Neumann und Kollegen erhielten.
Als Helmholtz für sein erstes Semester an die Universität kam, waren dort nur 43 Medizinstudenten eingeschrieben, wovon sich lediglich sieben für seine Kurse anmeldeten, von denen wiederum nur drei bis fünf auch tatsächlich auftauchten – »je nach dem Wetter«. Seine Aufgaben in der Lehre waren nicht allzu umfangreich (wenngleich Helmholtz die Vorbereitung des Unterrichts anstrengend fand), seine materiellen Ressourcen eingeschränkt (es gab nur einen Raum, um Instrumente aufzubewahren und Experimente durchzuführen, und ein kleines jährliches Budget für beides). Dennoch war es im Vergleich zu Berlin ein Aufstieg. Physiologie unterrichtete Helmholtz das gesamte Jahr, Allgemeine Pathologie nur in den Wintersemestern. Seinen Kollegen galt Letztere als »die feinste Blüthe medicinischer Wissenschaftlichkeit«.14
Helmholtz’ pädagogische Fähigkeiten scheinen kaum mehr als zufriedenstellend gewesen zu sein. Brücke zweifelte an seinem Lehrtalent, aber er glaubte, dass Helmholtz mit seinen »gedigenen Kenntnissen« und der geringen Anzahl an Studenten in Königsberg gut zurechtkommen würde. Ludwig hielt ihn für einen passablen Lehrer, dem aber du Bois-Reymonds Talent fürs Unterrichten fehle. Immerhin könne, wie er schreibt, ein Mann mit einem so wachen Verstand niemals einen schlechten Vortrag halten, obwohl es vielleicht gerade diese Klarheit sei, die seine Rede manchmal trocken erscheinen lasse. Nachdem Helmholtz über zwei Jahre gelehrt hatte, befanden seine Kollegen an der medizinischen Fakultät jedenfalls, er habe sich als leidenschaftlicher und kompetenter Lehrer erwiesen, der mit großem Erfolg unterrichte.15
Seine Effektivität als Forscher ist in jedem Fall viel leichter zu beurteilen als sein Erfolg als Lehrer. In jener Zeit arbeitete Helmholtz an einer bahnbrechenden Analyse zur Messung der endlichen Geschwindigkeit der Nervenimpulse. Ihr Ausgangspunkt lag in seinen Studien zur Muskelkontraktion der Jahre 1848 – 1850, aber es spiegelten sich darin auch breiter angelegte Forschungsansätze und Methoden wider. Es handelte sich um eine Variation zu Webers kürzlich veröffentlichter Studie zur Muskelkontraktion, die sich anders als Webers Untersuchung jedoch auf die mechanische Muskelarbeit konzentrierte und so vermutlich die Anwendung seines Krafterhaltungsgesetzes auf die Physiologie zeigen wollte. Er nutzte dafür ein abgewandeltes Messinstrument, das Ludwig kurz zuvor entwickelt hatte, um das Verhältnis von Muskelarbeit zu Energie graphisch darstellen zu können. Zudem adaptierte er ein galvanometrisches Verfahren, das von Claude Servais Mathias Pouillet für andere Zwecke konzipiert worden war, um die Zeitintervalle noch genauer zu messen, als es die graphische Methode erlaubte. (Der Bau und Besitz von Instrumenten war Helmholtz immer sehr wichtig. Als er feststellte, wie wenig der Königsberger Instrumentenbauer zu bieten hatte, wusste er Halske in Berlin noch mehr zu schätzen.) Bei seiner Forschung war er auch auf Olga angewiesen, denn »sie steht mir treulichst bei bei meinen Versuchen als Protokollführerin der beobachteten Skalenteile, was sehr nötig ist, weil ich allein vollständig konfus werde, wenn ich auf so viele Dinge gleichzeitig achtgeben soll«.16 Die sorgfältigen Messungen brachten den Zeitunterschied zutage zwischen jenem Moment, in dem der Muskel eines Frosches stimuliert wurde, und der nachfolgenden Reaktion darauf.
Die meisten Messungen zur Geschwindigkeit von Nervenimpulsen bei Fröschen führte Helmholtz in den Winterferien von 1849/50 durch. Anhand der ersten Ergebnisse ließ sich vermuten, dass die Geschwindigkeit variierte in einem Bereich von etwa 24 bis 38 Metern pro Sekunde. Die genaue Geschwindigkeit – circa 24 bis 27 Meter pro Sekunde – war weitaus weniger wichtig (und sollte noch lange in der Diskussion stehen) als der Beweis dafür, dass es sich um einen begrenzten, messbaren Zeitraum handelte. Überraschenderweise ging das Ganze recht langsam vonstatten, viel zu langsam, um mit elektrischem Strom in Verbindung gebracht zu werden. Helmholtz bat du Bois-Reymond, der Physikalischen Gesellschaft seine Ergebnisse »als Prioritätswahrung« vorzulegen, was dieser am 1. Februar 1850 tat. Daraufhin verfasste Helmholtz zügig fünf Artikel, darunter einen auf Französisch für die Pariser Akademie der Wissenschaften und einen für Poggendorffs Annalen. Müller stellte derweil am 21. Januar 1850 der Preußischen Akademie der Wissenschaft einen Bericht über Helmholtz’ Arbeit vor.17
Müller zeigte sich hellauf begeistert über Helmholtz’ Manuskript und glaubte, Helmholtz habe damit die Nervenmessung weit vorangebracht. Müller kündigte es nicht nur umgehend vor der Akademie an, sondern sorgte auch dafür, dass der Artikel in der nächsten Ausgabe der Monatsberichte erschien, und bot Helmholtz an, etwaige weitere Arbeiten zu dem Thema unverzüglich in seinem Archiv zu veröffentlichen. Ludwig war ähnlich begeistert. Du Bois-Reymond hingegen bremste Müller aus. Er behauptete, »mit Stolz und Trauer«, dass Helmholtz seinen Artikel über die Nervenimpulse »so maßlos dunkel dargestellt« habe, dass er in Berlin nur von ihm allein »verstanden und gewürdigt worden« sei. Er habe den Inhalt Dove, Magnus, Poggendorff, Mitscherlich, Müller, Peter Theophil Rieß und anderen Akademiemitgliedern erklären müssen und an den Text nochmal selbst Hand angelegt, um Humboldt überhaupt dazu zu bringen, die französische Version nach Paris zu senden. Auch Humboldt benötigte Erklärungen zu Helmholtz’ Arbeit, sorgte jedoch dafür, dass die Ergebnisse auf Französisch in den Comptes Rendus erschienen. Aus Müllers Briefen an Helmholtz geht hervor, dass zumindest er dessen Arbeit hinreichend verstand. Diejenigen, die anscheinend erst mithilfe du Bois-Reymonds zu einem Verständnis gelangten, gehörten einer älteren Generation von Physikern und Chemikern an. Die meisten von ihnen hatten drei Jahre zuvor auch schon Helmholtz’ Artikel zur Krafterhaltung nicht zu schätzen gewusst. Dennoch war Helmholtz dankbar für du Bois-Reymonds redaktionelle Unterstützung, die Verbreitung seiner Arbeit und weitere Hilfestellung.18
Du Bois-Reymond fuhr im Frühling nach Paris, um über seine eigene Forschung auf dem Gebiet der Elektrophysiologie zu sprechen, und fand die französischen Kollegen zunächst skeptisch, wenn nicht sogar feindselig eingestellt. Vergeblich versuchte er trotzdem, Helmholtz’ Forschung zur Nervenleitgeschwindigkeit vorzustellen, doch hatte die Pariser Akademie dafür nur Spott übrig. In der Société Philomatique, wo du Bois-Reymond ebenfalls darüber sprach, fiel die Reaktion kaum positiver aus, und »obschon niemand etwas öffentlich einzuwenden wagte, wurde ich doch im Stillen mit den dümmsten Zweifeln und Einwürfen geplagt«. Er berichtete Ludwig, dass die Franzosen Helmholtz wegen seiner Arbeit über die Nervenimpulse für »einen Verrückten« hielten. Eine solche Auffassung mag teils der organizistischen (als Gegensatz zum Reduktionismus) Orientierung der französischen Physiologie geschuldet gewesen sein. Es war äußerst unwahrscheinlich, dass Wissenschaftler dieses Schlages den neuen physiologischen Instrumenten, die du Bois-Reymond, Ludwig und andere junge deutsche Physiologen entwickelten, allzu große Bedeutung zumessen würden. Führende französische Physiologen wie Claude Bernard verfolgten einen ganz anderen Ansatz in der Biologie: Sie stellten die Bedeutung der Umgebung heraus und lehnten Bestrebungen in Richtung eines physikalistischen Reduktionismus ab. Ihre Ansichten mögen auch etwas mit dem um die Jahrhundertmitte zu beobachtenden französischen Unvermögen zu tun gehabt haben, auf deutsche Herausforderungen in der wissenschaftlichen Forschung mit der Bereitstellung angemessener eigener Forschungsressourcen zu reagieren – einem Unvermögen, das mit einem gewissen Maß an Gleichgültigkeit gegenüber Neuerungen in der Wissenschaft gepaart war (lieber betete man weiter Altbekanntes herunter). Letztendlich, so glaubte du Bois-Reymond, habe er die Pariser von seiner eigenen Arbeit überzeugen können, nicht aber von der seines Freundes. Ihre Einstellung war ihm zuwider: »Überhaupt hat man von diesem Gemisch von Dummheit, Anmaßung, Unwissenheit und Niederträchtigkeit bei uns gar keinen Begriff.« Helmholtz gewährte seinem Freund und Agenten natürlich volle moralische Unterstützung: »Daß sie die angenehmen Epitheta, welche du ihnen gibst, reichlich verdienen, davon war ich teilweise schon früher überzeugt.«19
Im Frühling 1850, in der Pause zwischen den Semestern, begann Helmholtz zur Nervenleitgeschwindigkeit beim Menschen zu forschen. Er berichtete einem Onkel, dass seine Versuche eine Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reize von etwa 50 bis 60 Metern pro Sekunde beim Menschen ergeben hatten. Wie er ausgerechnet hatte, brauchten die Informationen vom großen Zeh bis zum Gehirn also ungefähr eine Dreißigstel Sekunde. Aus dem Nähkästchen fügte er dann noch hinzu, dass Olga und er sehr glücklich in Königsberg seien, wofür allerdings nicht in erster Linie die Stadt selbst ursächlich sei. Auch dem Vater berichtete er von seinen jüngsten Forschungsergebnissen: Je weiter vom Gehirn entfernt der Punkt liege, an dem man einen Nerv stimuliere, umso größer werde auch das Zeitintervall dazwischen. Diese Erkenntnisse, da war sich Helmholtz sicher, würden ein großer Erfolg sein und Aufmerksamkeit erregen. Helmholtz gestand seinen Eltern jedoch auch, dass seine Ergebnisse bei der Académie française erwartungsgemäß wenig Anklang gefunden hatten. Sie sollten sich darüber aber nicht weiter grämen, denn es sei den Franzosen einfach unmöglich, auf wissenschaftliche Entdeckungen von Deutschen mit Wohlwollen zu reagieren. Das ursprüngliche Ziel, nämlich Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren, sei ja immerhin erreicht worden.
Ferdinand dachte sofort an die philosophischen Implikationen – als ein wichtiger Beitrag zum uralten Körper-Geist-Problem – der Forschungsergebnisse seines Sohnes. Er war erstaunt zu hören, dass Gedanken und körperliche Handlungen aufeinander folgten und nicht gleichzeitig abliefen, wie er es immer angenommen hatte. Und er hoffte, Hermann werde die Bedeutung seiner Forschungsergebnisse noch besser erklären – in Begriffen, die auch ein Laie verstehen könne. Helmholtz versuchte dem mithilfe physikalischer Analogien zu entsprechen und indem er die inhärenten, unvermeidbaren Ungenauigkeiten im Messprozess erklärte (also die sogenannte Persönliche Gleichung, die Bessel zuerst für die Astronomie beschrieben hatte). Im Zuge dessen wurde er sich darüber bewusst, dass unterschiedliche Zuhörerschaften, also Laien oder Fachleute (inklusive seiner Medizinerkollegen), verschiedene Arten von Erklärungen brauchten (z. B. unter Heranziehung einfacher Graphen oder auch komplizierter Präzisionsmessungen), und wurde auch empfänglicher für erkenntnistheoretische Probleme während des Forschungsprozesses und bei der Interpretation der Ergebnisse. Im Großen und Ganzen zeigt Helmholtz’ Bemühen zwischen 1849 und 1851, dass wissenschaftliche Entdeckung und Überzeugungskraft nicht unabhängig voneinander funktionierten, sondern ein kontinuierlicher, eng zusammenhängender Prozess waren.20 Es veranschaulichte das Programm der organischen Naturwissenschaftler am Beispiel und markierte einen wichtigen Schritt in den Anfängen der Neurophysiologie.
1850 sandte Helmholtz Müller die Endversion seines Manuskriptes zur Nervenleitgeschwindigkeit bei Tieren. Im August ließ er verlauten: »Arbeit und Hitze hatten mich etwas heruntergebracht.« Er habe »öfter als sonst Kopfschmerzen und habe mich deshalb entschlossen, meine Leber einige Tage am Strand spazieren zu führen und mein Gehirn mit Seewasser blank zu scheuern.« Er verbrachte seine Zeit »mit sehr gutem Erfolg« mit dem aus Königsberg stammenden Kirchhoff, der mit Richelot Mathematik und mit Neumann Physik studiert hatte und in Breslau lehrte. Von seiner Abneigung gegen die Franzosen kam er dennoch nicht los. Er schrieb du Bois-Reymond, der Bericht der Académie française zu dessen elektrophysiologischen Arbeiten sei voller Feindseligkeit, und nannte es perfide, dass sie darüber schrieben, ohne überhaupt vollständige Kenntnis dessen zu besitzen, was er geleistet habe. Stattdessen ließen sich die Franzosen auf der Suche nach Widersprüchen auf die aussichtslosesten theoretischen Debatten ein, wo sie doch die ganze Zeit nicht fähig gewesen seien, die Experimente selbst durchzuführen. Du Bois-Reymonds Erkenntnisse zu den Muskelströmen bei Fröschen diskutierten sie nicht einmal. Jetzt ließ Helmholtz seinem Zorn auf die Franzosen vollen Lauf:
Die Zweifel an dem Zusammenhang des Versuchs an Menschen mit denen an Fröschen können nur von einem, der nicht sehen will, in dieser Weise ausgesprochen werden, wie es geschehen ist. Am impertinentesten zeigen sie sich aber schließlich in ihren Äußerungen über Deine Theorie der Erscheinungen, die sie nicht kennen, und in ihren gütigen Ratschlägen, Dich an immer strengere Methoden zu heften. Ich habe mich schändlich geärgert über diese Art und Weise. Die Kerls kräftig zu blamieren, würde schon gut sein der unwissenden Köpfe in Deutschland wegen, die aus ihren Urteilen Nahrung zur eigenen Beschönigung finden. Wenn man dabei bedenkt, daß neben dem verblühten [François] Magendie kein einziger nennenswerter Physiologe in Frankreich existiert und die Redensarten bei Gelegenheit der Preisverteilung liest, mit der sie solche Lumpen wie Bernard wegen seiner liederlichen Arbeit über pankreatischen Saft bekränzen: »eine Arbeit, wie sie in jedem Jahrhundert nur selten vorkommen kann« etc., so möchte man fast zu dem Entschluß kommen, diese Bande in ihrer Nichtigkeit vorläufig zu ignorieren, bis sie einsehen gelernt haben, wie schwach es mit ihnen steht. Wir wollen einmal abwarten, ob sie der Ehre sein werden [!], Dir den nächsten physiologischen Preis zuzuerkennen, daß kein Rival da ist, der ihn Dir der Gerechtigkeit nach streitig machen könnte.21
Gehässigkeiten dieser Art hielt er für die Kollegen jenseits des Rheins allzeit bereit.
Die Geschwindigkeit der Nervenübertragung bei Tier und Mensch zu untersuchen, war ein historisch zu nennender Schritt für die Wissenschaft, vergleichbar den ersten Messungen der Lichtgeschwindigkeit im Jahre 1676 durch den dänischen Astronomen Ole Christensen Rømer. Helmholtz’ Ergebnisse und Technik waren jedoch nicht nur für die Franzosen zu revolutionär, auch die ältere Generation Berliner Wissenschaftler war damit überfordert. Lediglich junge Freunde und Kollegen wie Ludwig, die Helmholtz kannten und seine Einstellung zur Physiologie teilten, mussten nicht erst überzeugt werden, um den Wert seiner Ergebnisse zu erkennen. Ludwig schrieb ihm, seine Untersuchungen zu den sogenannten Nervenkräften hätten ihn mit großem Stolz erfüllt. Helmholtz glaubte, dass auch andere mit der Zeit seine Arbeit verstehen würden. Was die Überzeugungsversuche anging, war er lange noch nicht fertig. Am 13. Dezember 1850 hielt er vor der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft einen Vortrag über methodologische Aspekte bei der Messung von Nervenimpulsen und seine Messungen an Menschen. Eine Woche später ließ er du Bois-Reymond mehr oder weniger denselben Vortrag bei der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin halten. Diese Vereinigung war jetzt wie auch früher schon eine wichtige Plattform zur Darlegung seiner Forschungsergebnisse. Obwohl seine Untersuchungen zur Nervenleitgeschwindigkeit nicht nur für die spätere Neurophysiologie maßgeblich werden sollten, sondern sehr viel später auch für den neu aufkommenden Bereich der Neurowissenschaften, fand sie anfänglich kaum jemand außerhalb seines engsten Kreises glaubwürdig. Wie John Tyndall es später so anschaulich formulierte: Die Idee eines endlichen und messbaren Zeitunterschieds »zwischen dem Zufügen einer Wunde und der gefühlten Verletzung« wurde als geradezu absurd abgetan. Kein Wunder also, dass Helmholtz sich bald selbst auf eine Art Werbetour für seine Ergebnisse begab.22
Ein Blick auf die Netzhaut im lebenden Auge (oder: Die Erfindung des Augenspiegels)
Neben seiner Forschung zur Geschwindigkeit der Nervenimpulse musste Helmholtz auch seinen Lehrpflichten nachkommen. Aus seiner Vorlesung zur Sinnesphysiologie im Wintersemester 1850 heraus entstand die Idee, seinen Studenten eine Theorie zum Lichteinfall ins Auge näherzubringen und am lebenden Auge zu demonstrieren. Seit dem späten 18. Jahrhundert war vielen Forschern eine Art Leuchten der Pupille aufgefallen. Bénédict Prevost beispielsweise vertrat 1818 die Theorie, diese Leuchtkraft sei Licht, das aufs Auge gerichtet worden sei und nun reflektiert werde. William Cumming zeigte jedoch 1846, wie auch Brücke 1847 davon unabhängig, dass man ein gesundes menschliches Auge erleuchten konnte. Helmholtz zufolge war Brücke »hierbei eigentlich nur noch um eines Haares Breite von der Erfindung des Augenspiegels entfernt«. Nur der Umstand, dass dieser den Rückweg nicht untersucht hatte, den das Licht aus dem beobachteten Auge nahm, und wie daraus ein optisches Bild im Auge des Beobachters entstand, hatte ihn daran gehindert, zum Erfinder des Ophthalmoskops zu werden. Tatsächlich, so Helmholtz, gab es fünf oder zehn andere deutsche Forscher, »die zweifellos, wenn sie unter gleichen Bedingungen vor dieselben Aufgaben gestellt worden wären, in ganz folgerichtiger Weise genau dasselbe geleistet haben würden, wie ich«.23
Helmholtz, der stets ein Physiologe mit dem Blick eines Physikers war, baute auf Brückes Erkenntnis auf, dass das Auge reflektiertes Licht ausstrahlen konnte. Dabei stellte er fest, dass ins Auge einfallende Lichtstrahlen genau auf demselben Weg reflektiert wurden. Neu an Helmholtz’ Beitrag war, dass er die physikalische Optik, die für die Leuchtkraft des Auges verantwortlich war, erklären konnte und ein Instrument konzipierte, womit sich das zurückgeworfene Licht einfangen und sichtbar machen ließ. Acht Tage lang werkelte er an seinem ersten provisorischen Augenspiegel. Es handelte sich um eine instabile Konstruktion aus dünnem Karton, Brillengläsern und einem Mikroskop-Deckglas. Mit diesen einfachen Hilfsmitteln gelang es ihm erstmals, einen Blick auf die menschliche Netzhaut zu werfen. Er bezeichnete sich selbst als einen »Dilettanten« in praktischer Mechanik – der es sich freilich auf der Suche nach einem neuen Forschungsansatz nicht nehmen ließ, die Rohversion eines neuen Instruments selbst zu bauen. Vermutlich, so Helmholtz, hätte er seine Konstruktionsversuche aufgegeben, wäre er nicht von der Theorie her überzeugt gewesen, dass das Gerät einfach funktionieren müsse.24 Auch die Handhabung war schwierig, und doch dürfte Helmholtz’ Freude darüber, als Erster die Netzhaut eines lebenden Menschen gesehen zu haben, der Galileis ähnlich gewesen sein, als er 1609 erstmals den Mond und andere Himmelskörper systematisch durch sein eigenes, verbessertes Gerät beobachten konnte. Ganz wie Galilei erkannte Helmholtz sofort, welches Potenzial und berufliches Vorankommen seine Erfindung versprach.
In einem Brief erklärte er seinem Vater die Erfindung. Er wollte ihm auch eine Kopie des Artikels zu Nerven und deren Reaktionszeiten schicken, sandte aber zuerst das Skript eines populären Vortrags zu diesem Thema, den er vor Kurzem vor der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft gehalten hatte. Sein Manuskript erbat er sich allerdings zurück, denn mehrere Königsberger wollten es gerne lesen, darunter auch Seine Exzellenz von Schön. Helmholtz feilte derzeit auch an einem neuen Apparat für seine Zeitintervallmessungen, in dem Brief an Ferdinand hatte er dazu aber nichts Neues zu berichten. Er näherte sich dem wichtigsten Thema:
Außerdem habe ich aber […] eine Erfindung gemacht, welche möglicher Weise für die Augenheilkunde von dem aller bedeutendsten Nutzen sein kann. Sie lag eigentlich so auf der Hand, erforderte weiter keine Kenntnisse, als was ich auf dem Gymnasium von Optik gelernt hatte, dass es mir jetzt lächerlich vorkommt, wie andere Leute und ich selbst so vernagelt sein konnten, sie nicht zu finden. Es ist nämlich eine Combination von Gläsern, wodurch es möglich wird, den dunklen Hintergrund des Auges durch die Pupille hindurch zu beleuchten, und zwar ohne ein blendendes Licht anzuwenden, und gleichzeitig alle Einzelheiten der Netzhaut genau zu sehen, sogar genauer, als man die äusseren Theile des Auges ohne Vergrösserung sieht […]. Man sieht die Blutgefässe auf das zierlichste, Arterien und Venen verzweigt, den Eintritt des Sehnervs in das Auge u.s.w. Bis jetzt war eine Reihe der wichtigsten Augenkrankheiten, zusammengefasst unter dem Namen »schwarzer Star«, eine Terra Incognita, weil man über die Veränderung im Auge weder im Leben noch selbst meist im Tode etwas erfuhr. Durch meine Erfindung wird die speciellste Untersuchung der inneren Gebilde des Auges möglich. Ich habe dieselbe als ein sehr vorsichtig zu behandelndes Ei des Columbus sogleich in der physikalischen Gesellschaft in Berlin als mein Eigenthum proclamieren lassen, lasse gegenwärtig ein solches Instrument arbeiten, welches besser und bequemer ist, als meine bisherigen Pappklebereien, werde dann wo möglich mit unserem hiesigen Augenarzt Untersuchungen an Kranken anstellen, und dann die Sache veröffentlichen.
Helmholtz’ anschauliche Beschreibung seiner Erfindung zeigt einerseits, wie viel er seiner Gymnasialzeit verdankte, andererseits, dass er von Anfang an den Augenspiegel als sein geistiges Eigentum betrachtete – ein Anspruch, den er sogleich auch öffentlich machte. Er beschrieb seine Methode und Erfindung in einem kurzen Text, den du Bois-Reymond vor der Physikalischen Gesellschaft vortrug. Sogar Ferdinand, der mit seinen romantischen Vorstellungen oft wie von einer anderen Welt wirkte, verstand die auf Besitzsicherung zielenden Absichten seines Sohns. Er schrieb an Hermann, dass es, soweit er gehört habe, nicht möglich sei, eine Beschreibung des Geräts in Müllers Zeitschrift zu veröffentlichen, »desto besser aber, dass Du jetzt Deine Abhandlung selbständig unter Deinem Namen herausgeben willst«. Er war begierig darauf, sie zu lesen, und plante, Puhlmann zu überreden, sie in der dortigen Literarischen Gesellschaft vorzustellen. Er sah voraus: »Die Entdeckung über die Beobachtung des Auges wird Dir, wenn auch nicht so viel Kenntnisse voraussetzend, wahrscheinlich rascher einen Namen schaffen, weil sie unmittelbar praktisch erscheint, und es fragt sich, ob Du für das Instrument der Beobachtung Dir nicht ein Privilegium geben liessest.«25
Der Aufsatz erschien im Herbst 1851, umfasste 43 Seiten und beschrieb detailliert alle relevanten Gesetze der physikalischen Optik und die Funktionsweise des Augenspiegels. Wie Helmholtz darin erklärte, konnte ein Beobachter normalerweise kein Licht aus dem beobachteten Auge zurückkommen sehen, da der Beobachter ja zwangsläufig dem einfallenden Licht im Wege stand. Um dies zu vermeiden, lenkte er das Licht einer Lampe (oder Sonnenlicht) indirekt via Reflexion über eine kleine, halb versilberte plane Glasplatte ins Auge. Das untersuchte Auge sieht so nur das Spiegelbild des Lichts, was dem Beobachter die Sicht auf das Auge ermöglicht. Das reflektierte Licht trifft auf die Netzhaut (die Rückseite des Auges) und erzeugt dort ein umgekehrtes optisches Bild. Das Licht wird dann von der Netzhaut zurückgeworfen und das Bild wieder umgekehrt, sodass der Beobachter es aufrecht sieht. In einem abgedunkelten Raum mit nur einer direkten Lichtquelle ließ sich die Retina eines lebenden Menschen so sehr detailliert betrachten. Das Ophthalmoskop, dessen deutsche Bezeichnung als »Augen-Spiegel« für sich spricht (siehe Abb. 5.2), war im Kern ein Instrument, das reflektierte Strahlen in ein klares Bild im Auge des Beobachters wandelte. Helmholtz’ Aufsatz erschien, wie schon der zur Krafterhaltung, als eigenständige Publikation, nicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, und brachte ihm bescheidene 80 Taler ein.26
Abb. 5.2:Helmholtz’ Ophthalmoskop auf seinem Band Beschreibung eines Augen-Spiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge (Berlin: A. Förstner, 1851). Deutsches Museum, München, Archiv, CD 64736.
Es folgten weder ein Patent noch Tantiemen. Helmholtz gestand später, dass »in der ersten Hälfte meines Lebens, als ich noch für meine äussere Stellung zu arbeiten hatte, nicht höhere ethische Beweggründe mitgewirkt hätten neben der Wissbegier und meinem Pflichtgefühl als Beamter des Staates [sprich Universitätsprofessor]«, sondern auch »egoistische Motive«. Andere Forscher standen seiner Einschätzung nach unter ähnlichem Druck, zumindest bis sie – sofern sie die Wissenschaft nicht ganz an den Nagel hängten – im weiteren Verlauf ihrer Karrieren »eine höhere Auffassung ihres Verhältnisses zur Menschheit« entwickelten. Mit seiner Erfindung habe er jedoch auch einfach Glück gehabt.27 Zwar gehörte es zu seinem Lehrauftrag, seinen Medizinstudenten die Beleuchtung des Auges zu erklären, doch war es auch eine Verkettung günstiger Umstände, die ihn zum Erfinder des Augenspiegels werden ließ.
Diese Mischung aus Glück, seinen breit gefächerten Kenntnissen (in Physik, Physiologie und Medizin) und den Anforderungen der Lehre ließ Helmholtz später verkünden: »Der Augenspiegel war mehr eine Entdeckung, als eine Erfindung.« Seine glückliche Entdeckung (Erfindung) machte ihn regelrecht verlegen: Er sei ein »gut geschulter Arbeiter, welcher, sagen wir ›gut‹, gethan hat, was er zu thun gelernt hatte, und was zu thun eben gelernt werden kann.« Seine Errungenschaft betrachtete er als einen Akt angewandter Wissenschaft. Später sollte er seine Entdeckung oft als Beispiel dafür anführen, wie Wissenschaft, die um ihrer selbst willen betrieben wird, irgendwann einen großen praktischen Nutzen für die Gesellschaft haben kann. Die Erfindung des Augenspiegels brachte ihm jedenfalls mehr Ansehen ein als alles andere, was er davor oder danach tat.28
Auf Tour
Genau wie Mais oder Sojabohnen sind wissenschaftliche Ergebnisse eine Ware, die innerhalb eines Marktes existiert. Forscher entdecken, erfinden, handeln, (ver) kaufen und bewerben ihre wissenschaftlichen Güter und Dienstleistungen – also Fakten, Theorien, Instrumente und dergleichen mehr – und sie tun das sowohl untereinander als auch im Verhältnis zu Nichtwissenschaftlern. Helmholtz ging konform mit dieser Sichtweise von Wissenschaft als ein Marktplatz und wusste auch, dass man, um herauszustechen, seine Güter manchmal schon anpreisen musste, bevor sie ganz reif waren.29
Im Sommer 1851 suchte Helmholtz jedenfalls aus seinen neuesten Arbeitsergebnissen Kapital zu schlagen, indem er durch verschiedene deutschsprachige Universitäten »tourte«. Vordergründig geschah dies, um physiologische Institute zu besuchen, jedoch war der eigentliche Zweck dieser Reise, seinen Kollegen zu zeigen, was er zu bieten hatte. Er machte Werbung für seine Untersuchungen zur Nervenleitgeschwindigkeit, für seinen Augenspiegel – und für sich selbst. Es stellte sich heraus, dass er ein außergewöhnlich guter Verkäufer war.
Fast zwei Monate lang (Anfang August bis Ende September) war er unterwegs, meist allein und hauptsächlich in Deutschland. Ab und an jedoch reiste er auch mit anderen, so in der Schweiz, in Italien, kurz in Frankreich und Österreich. Das preußische Kultusministerium sponserte die Tour mit 200 Talern Reisegeld. Olga und die einjährige Käthe blieben derweil in Dahlem zurück. Es war Helmholtz’ erste derartige Trennung von Frau und Familie – später sollte eine solche Trennung alljährlich für mehrere Wochen im Sommer üblich werden. (Die Reisen wären für seine Familie viel zu strapaziös gewesen.) Zu Beginn der Reise fühlte Helmholtz sich noch recht erschöpft, denn er hatte im Frühjahr an einem gastrischen Fieber gelitten. Er hoffte, die Reise werde ihm wieder Auftrieb geben, »das verlorene Material« seiner »Lebensmaschine« wieder anfahren. Den Sommer in Königsberg zu verbringen, wie Kirchhoff es vorhatte, zeugte in seinen Augen hingegen von »Geschmacklosigkeit«.30
Zuerst ging es nach Halle, wo Helmholtz wärmstens von seinem alten Freund, dem Chemiker Wilhelm Heintz, und dessen Familie empfangen wurde und mit ihnen zwei schöne Tage verbrachte. Dann machte er sich auf nach Göttingen. Die Zugfahrt durch die Landschaft Thüringens beeindruckte ihn sehr, ebenso »eine Reihe meist romantisch gelegener Städte«. Er erreichte Göttingen um drei Uhr morgens und schrieb an Olga: » [Z]uerst hunderttausend treuste Herzensgrüße aus der Ferne, und die Meldung, daß ich immer nur noch Eine liebe, welche sich Dötchen von Velten ehemals genannt hat.« Er scherzte, dass er auf seiner Reise (bisher) noch niemand besseren gefunden habe, »und wenn alle Leute so viel Grund hätten zufrieden zu sein, wie ich, so sähe es besser in der Welt aus«.31 Er liebte sie aus der Ferne noch mehr.
Die Universität Göttingen hielt er für sehr reich. Es gab dort über 600 Studenten, doppelt so viele wie in Königsberg, und diese seien meist wohlhabend. Die Professorenschaft bilde die »Aristocratie der Stadt« und fühle sich den (anderen) Bürgern überlegen. Leider fiel Helmholtz’ Besuch mit dem des Kronprinzen Ernst August II. von Hannover zusammen, der mehrere Tage in der Stadt weilte, um ein neues Krankenhaus einzuweihen, die Universität und andere Stätten zu besuchen sowie die Fakultätsangehörigen und auch Studenten zu empfangen. Das machte es für Helmholtz schwierig, Göttingens Professoren kennenzulernen. Zwar hatte der König von Hannover im Jahre 1837 verfassungswidrige Maßnahmen eingeleitet, die zu der berüchtigten Entlassung von sieben Professoren geführt hatten – die »Göttinger Sieben«, darunter auch der Physiker Wilhelm Weber –, und sich zudem 1848 gegen das Frankfurter Parlament gestellt, seine Untertanen während der Revolution jedoch großzügig behandelt. »Die Hannoveraner«, schrieb Helmholtz an Olga, »sind übrigens mit ihren politischen Zuständen im Ganzen zufrieden; sie sind fast die einzigen Deutschen, bei denen seit 1848 keine politischen Rechtsbrüche vorgekommen sind, und in Anerkennung dessen scheinen sie sehr an ihrem Könige zu hängen, trotz dessen widerhaariger Gemüthsart.«32
In Göttingen besuchte er den Philosophieprofessor August Ritter und seine Frau. Sie empfingen ihn »sehr herzlich«, Ritter war schließlich ein alter und guter Freund von Ferdinand, und Helmholtz kannte Ritter und seine Familie noch aus Berlin. Die Ritters richteten ein Fest für ihren Gast aus, wozu sie alle Professoren einluden, mit denen er gerne sprechen wollte. »Es ist äußerst angenehm, in der Welt herumzureisen, und die Feste abzunehmen, welche uns zu Ehren arrangirt werden«, schreibt Helmholtz an seine Frau. Auf dem Fest lernte er unter anderem den Physiologen Rudolph Wagner kennen, »ein älterer Mann, dem man etwas das Bewußtsein seiner Wichtigkeit anmerkt«. Helmholtz befand, dass Wagner wie Alfred W. Volkmann, der Hallenser Physiologieprofessor, »nicht ganz im Niveau der jetzt nöthigen physikalischen Kenntnisse« sei. Dessen sei sich Wagner bewusst, weshalb er versuche, sich nicht in Helmholtz’ wissenschaftlichen Erklärungen zu »verlaufen«. Dabei war Wagner der Physik noch eher zugewandt als andere Physiologen jener älteren Generation, zu der auch Müller, Jan Evangelista Purkinje und Magendie zählten.33
Außerdem traf Helmholtz noch Weber, »nach Neumann wohl der erste mathemat[ische] Physiker Deutschlands«. Er gehörte zu Europas führenden Theoretikern auf dem Gebiet des Elektromagnetismus, und Helmholtz kannte seine Arbeit schon: Er hatte Webers Elektrodynamische Maassbestimmungen (1846) gelesen, als er gerade an seinem Aufsatz zur Krafterhaltung saß. Weber zeigte ihm »mit etwas weniger lächelnder Freundlichkeit als sein Bruder in Leipzig« – Ernst Heinrich und Eduard waren beide physikalisch orientierte Physiologen – »viel interessante physikalische Apparate von großer Vollendung«. Des Weiteren lernte Helmholtz auch Carl Georg Bergmann kennen, außerordentlicher Professor für Anatomie und Physiologie, der sich wie Helmholtz sehr für den Wärmehaushalt von Tieren interessierte, Helmholtz jedoch nicht besonders beeindrucken konnte. Außerdem traf er noch Christian Georg Theodor Ruete, Professor für Augenheilkunde, der »werthvolle Arbeiten für die Physiologie des Auges geliefert hat«. Dann waren da noch Wilhelm Baum, ein klinisch orientierter Chirurgieprofessor und Ophthalmologe, sowie Johann Benedict Listing, Physikprofessor und mathematischer Optiker, von dem Helmholtz vorher noch nicht gehört hatte, »der es aber offenbar in hohem Grade verdient«. Ihnen allen führte er seinen Augenspiegel vor. Ruete, der im Jahr darauf Helmholtz’ Entdeckung weiterentwickelte (indem er die plane Glasplatte durch einen konkaven Spiegel ersetzte), schrieb über dessen Besuch: »[A]ls ich unter seiner Anleitung bei seiner Anwesenheit in Göttingen mit Hülfe jenes Instruments zuerst die Retina, den Nervus opticus mit der Arteria centralis retinae erblickte, wurde es mir folglich klar, daß auf diesem Wege viel für die Diagnose der Krankheiten des Auges […] zu gewinnen sei.« Helmholtz zweifelte nicht daran, dass seine Demonstrationen dort (und überall sonst) von großer Wirkung waren. Er schreibt: »Vortrefflich für meine Reise ist der Augenspiegel; ich demonstrirte ihn heute morgen, und er erregte auch hier eine Art von Sensation.« Die Zuschauer seien beeindruckt, und zwei Augenheilkundler hätten bei Egbart Rekoss, seinem Instrumentenmacher in Königsberg, bereits Bestellungen aufgegeben. »Meine Froschcurven demonstrire ich auch überall«, ließ Helmholtz seine Frau wissen und fügte hinzu: »[D]iese Leute nahmen mich alle mit großer Achtung und Freundlichkeit auf, gaben mir alle Zeit, die ihnen übrig war, und es war mir angenehm zu sehen, daß sie sich in meine etwas schwierigen Nervenarbeiten [die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit] hineingearbeitet haben, und damit übereinstimmen, oder doch wenigstens, wie es scheint durch die Urtheile der Webers, hinlängliches Vertrauen in meine physikalischen Kenntnisse haben, um an meine Resultate zu glauben.« Was Helmholtz’ Arbeit zur Krafterhaltung anging, hatten die Göttinger Wissenschaftler jedoch offenbar nichts zu sagen. Am Ende seines dortigen Aufenthalts lernte Helmholtz noch den Philosophen Rudolf Hermann Lotze kennen, der anscheinend zwar umfangreiche Forschung zu den Prinzipien der Pathologie und Physiologie betrieben hatte, aber »leider zu hypochondrisch und in sich gekehrt ist, als daß ein geistiger Verkehr wenigstens in so kurzer Zeit mit ihm möglich wäre«.34
Um halb zwei Uhr morgens fuhr Helmholtz’ Zug aus Göttingen ab. Er verbrachte einen Tag in Kassel, machte einen kurzen Zwischenstopp in Marburg und blieb einen Tag in Gießen. Der straffe Reiserhythmus hinterließ bereits Spuren, außerdem grübelte er ständig über die Gesundheit seiner Familie (die von Olga und Käthe) und wälzte Geldsorgen. Von der Universitätsstadt Marburg aber, »wundervoll schön zwischen hohen und steilen Waldbergen« gelegen, war Helmholtz ganz begeistert. Er traf sich dort mit Karl Hermann Knoblauch, einem außerordentlichen Professor der Physik, und dem Physiologieprofessor Hermann Nasse. Knoblauch, den Helmholtz aus Berlin kannte, hatte in Magnus’ Labor gearbeitet und sich in Berlin habilitiert, war zudem Mitbegründer der Physikalischen Gesellschaft. Der gut betuchte Knoblauch lud Helmholtz zu sich zum Kaffee ein und präsentierte ihm »seine kostbare Instrumentensammlung, ganz sein Eigenthum« sowie »einige interessante Versuche, deren Erfindung zwar nicht ihm angehörte, die aber in Deutschland noch wenig nachgemacht waren«. Helmholtz urteilte, Knoblauch sei »ohne alle eigenen Ideen, seine Arbeiten sind nur immer der Prüfung und speciellen Durchführung fremder Ideen gewidmet«. Von Nasse hielt Helmholtz kaum mehr (wenn nicht sogar weniger): Er sei ein Anhänger jener Schule, »welche das Leben auf möglichst viel Mystisches zurückführt, steht also im geraden Gegensatz« zu ihm und seinem Kreis. Nasses Projekte seien nicht von großer Bedeutung, er habe jedoch »manche fleißige und schätzenswerthe« Arbeit geliefert. »Er empfing mich deshalb anfangs nur höflich, vermied Wissenschaftliches, äußerte endlich Zweifel über meine Nervenleitungssachen.« Als Helmholtz ihm jedoch seine Froschmuskel-Kurven erläuterte, änderte sich Nasses Verhalten. »Nun wurde er ganz anders, er bat mich, doch in Marburg zu bleiben.« Helmholtz lehnte ab, die beiden gingen jedoch als »die besten Freunde« auseinander.35
Seine Reise führte ihn weiter nach Gießen, wo er – wie so viele andere – Liebig zu treffen hoffte, den »König der Chemiker, wofür er sich selbst und seine Schüler ihn halten«. Liebig war jedoch nach London zur Weltausstellung 1851 gereist, »sich von den Engländern fetiren zu lassen. Ich hätte ihn gern kennen gelernt«. Stattdessen musste er mit Liebigs Sohn Georg vorliebnehmen, einem Arzt, der in Magnus’ Labor gearbeitet hatte. Von ihm hatte Helmholtz sich »des Vaters leeres Laboratorium zeigen lassen, zu welchem die Schüler aus ganz Europa und Amerika zusammenströmen, um sich practisch einzuüben«. Er nahm eine wichtige Erkenntnis von diesem Laborbesuch mit: »Ich war erstaunt, gar keine besonders bedeutende Einrichtungen, dagegen Alles von Dreck starrend zu finden; Laboranten waren wenige da. Es machte einen seltsamen Gegensatz zu den mindest ebenso zweckmäßigen, viel besser versehen[en], wohl geordneten und gereinigten Laboratorium [sic] von Heintz u. a. Aber man sieht, die äußeren Dinge machen es nicht. Denn trotz aller Eitelkeit und Arroganz ist Liebig doch der bedeutendste der lebenden Chemiker und als Lehrer von ungeheurer ausgebreitetem Einfluß.«36 Ein Labor könne noch so gut ausgestattet sein – wenn der Laborleiter keine Ideen habe, nutze dies wenig.
Helmholtz wollte in Gießen auch Theodor Bischoff treffen, einen Anatomie- und Physiologieprofessor, der früher bei Müller studiert hatte, sowie Bischoffs Prosektor, Konrad Eckhard, vor Kurzem noch Ludwigs Assistent in Marburg, wo er zu Nerven und Muskeln experimentiert hatte. Helmholtz sah ihn als vielversprechenden Verbündeten der Biophysiker an. Eckhard richtete eine Abendgesellschaft aus, um Helmholtz den jungen Wissenschaftlern Gießens vorzustellen, und Helmholtz schätzte es sehr, seine Bekanntschaft zu machen. Bischoff hingegen beschrieb er wenig schmeichelhaft als fetten Mann mit seltsamer Frisur und »einer Nase, deren Rücken mehr vorsteht, als die Spitze«. Bischoffs Untersuchungen auf dem Gebiet der Anatomie fand er ähnlich unbeeindruckend wie seine Statur und Frisur. Das Positivste, was er über ihn zu sagen hatte, war, er sei »aber von Liebig gehörig aus seiner früheren mystischen Richtung herausgetrieben worden, so daß er ganz geneigt ist für unsere Untersuchungen, sie aber schwer versteht und beurtheilt«. Helmholtz instruierte ihn bezüglich der Nervenleitgeschwindigkeit und schaffte es anscheinend auch, ihn zu überzeugen. »Für den Augenspiegel war er sehr ungeschickt, und sah nur nothdürftig; seine Frau leichter als er.« Helmholtz schreibt auch über Bischoffs Frau – die Tochter von Friedrich Tiedemann, dem ehemaligen Heidelberger Physiologieprofessor –, die er für »eine bedeutendere Natur« als ihren Mann hielt. Die beiden unterhielten sich über Politik. Die Menschen in den kleineren Ländern wie Baden oder Thüringen schienen Helmholtz noch immer tief erschüttert von den Geschehnissen 1848/49 zu sein. Die Thüringer, mit denen Helmholtz sich unterhalten hatte, begrüßten die Standhaftigkeit des preußischen Militärs in dieser Zeit der politischen Instabilität und bevorzugten es, trotz gewisser Bedenken, »preußische Unterthanen« zu sein.37
Nach seinem Aufenthalt in Gießen fuhr Helmholtz weiter gen Süden. Er war überrascht, Menschen anzutreffen, die lieber leichten Wein als Wasser tranken. »Ich habe von dem Zeuge täglich eine Flasche vertilgt, und bemerke nicht die geringsten Unbequemlichkeiten, während ich zu Hause nicht ein Glas regelmäßig täglich getrunken vertragen kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.« Des Weiteren bemerkte er das Geschick, mit dem die Frauen Lasten auf ihrem Kopf balancierten, und dass man überall Esel zum Warentransport einsetzte. Über die Frauen fällte er jedoch ein hartes und vorschnelles Urteil: Die Tracht der hessischen Bauersfrauen fand er »scheußlich entstellend, umso mehr da die Frauen selbst fast allgemein häßlich sind«.38
Im »prächtigen« Frankfurt bestaunte er die in Verfall begriffenen alten Bauwerke wie den berühmten Dom und das Rathaus, und ebenso die neuen Gebäude, die Modernität suggerierten. »Jetzt ist Frankfurt die Stadt der Geldbrotzen, und ihrer Paläste; Berlins beste Theile müssen sich dagegen verstecken.« Er wohnte »sybaritisch« in einem ordentlichen Gasthof und schrieb an Olga: »Ein Frankfurter Hotel ist aber wirklich eine Sehenswürdigkeit.« Eigentlich legte er nie Wert auf feines Essen, aber Frankfurts kulinarisches Angebot hatte es ihm angetan. Er ging schwimmen und besichtigte danach die Paulskirche, was ihn »ganz melancholisch« zurückließ. Bei seinem Besuch des städtischen Museums »schwärmte« er wieder von Carl Friedrich Lessings Johann Hus zu Konstanz, Ezzelino da Romano »und zwei kleine[n] Landschaften von demselben«. Lessings Bilder, die weithin als antikatholisch angesehen wurden, mochte er sehr. Helmholtz schreibt weiter von »einigen anderen schönen Landschaften«, die er im Museum sah, ebenso wie »viele unbedeutende ältere und neuere Sachen«, darunter »einige die sehr gepriesen werden«. Die allegorischen Bilder Friedrich Overbecks und Friedrich Wilhelm Schadows, welche die Frankfurter Katholiken wohl als »Gegengewicht gegen den Huß« ausgehängt hatten, »mißfielen« ihm gänzlich. Dafür mochte 122er »sehr schöne Gypsabgüsse der Antike« sowie den Schild des Herakles nach einer Hesidon zugeschriebenen Vorlage von Ludwig Michael Schwanthaler. »Den Laokoon sah ich hier zum ersten Mal in ganzer Gruppe, er verhält sich aber zu den übrigen Antiken wie Victor Hugo zu Sophokles.«39 Kurzum, er wusste genau, was ihm gefiel und was nicht. Am Nachmittag brach er dann nach Heidelberg auf.
Heidelbergs Landschaft und die Stadt selbst sagten ihm zu. Das berühmte Schloss, wo er den Sonnenuntergang genoss und sich »die Dot herbeiwünschte«, übertreffe alles. Er war überrascht, so viele englische, französische und deutsche Familien zu Gesicht zu bekommen, »die sich mit einander an der wunderbaren Romantik dieses Ortes freuten«.40
Einen Tag nahm Helmholtz sich Zeit, das physiologische Institut kennenzulernen, und damit auch Jacob Henle, Professor für Anatomie und Physiologie und guter Freund sowie ehemaliger Schüler Müllers. Er wirkte auf Helmholtz »etwas jüdisch«. Du Bois-Reymond hatte ihn zu Unrecht gegen Henle aufgebracht, Helmholtz hatte allen Grund, Henle zu mögen. Wie er Olga begeistert mitteilte, hatte dieser nämlich »eine für unsere Zukunft vielleicht erfolgreiche Angelegenheit« eröffnet. Das hieß: Henle und andere jüngere Professoren der medizinischen Fakultät wollten ihn nach Heidelberg holen. Die Situation gestaltete sich jedoch schwierig. Henle war ursprünglich nur für die Physiologie zuständig gewesen, Tiedemann für die Anatomie. Dann kam es zwischen den beiden zu »heftigen Reibungen«, infolge derer die Fakultät Tiedemann bat, sich zu entschuldigen. Er kündigte jedoch stattdessen, was Henle mit Anatomie und Physiologie zurückließ. Henle und seine gleichgesinnten Kollegen hofften nun, dass Helmholtz die Physiologie übernehmen würde. Die ehemaligen Unterstützer Tiedemanns wollten aber Bischoff – der, wie es der Zufall so wollte, auch noch Tiedemanns Schwiegersohn war. Genauer gesagt hatten sie es weniger auf Bischoff als auf seinen Förderer Liebig abgesehen, der andeutete, nach Heidelberg kommen zu wollen, wenn Bischoff und andere Kandidaten seiner Wahl dort wären. Viele an der Universität glaubten ohnehin, der Ruf der Heidelberger Universität sei aus politischen Gründen »ungeheuer gesunken«, und sehnten sich nach einer Rückkehr »zu ihrem früheren Glanz«. Daher bemühten sie sich um den König der Chemie. Nur leider stellte sich heraus, dass der König nicht kommen würde. Bischoff hineinzubringen – einen Mann, der (so Helmholtz) nur über begrenzte wissenschaftliche Fähigkeiten verfügte, unter Liebigs Einfluss stand und nur die Gebiete abdecken konnte, die Henle bereits innehatte – war somit ohne weiteren Nutzen. Henle offenbarte Helmholtz, dass er ihn für den Posten empfohlen habe, noch bevor er ihn in Heidelberg traf, »und da wir uns bei meiner Anwesenheit vortrefflich vertragen haben, ich auch in der Lage war, ihm vielerlei Schmeicheleien beizubringen, für welche er nicht unempfänglich ist, so wird er diese Empfehlung nicht zurücknehmen. Sehen wir also, was geschieht; der Wirkungskreis in Heidelberg wäre nicht übel, die Deutschen haben sich etwas fortgewöhnt, weil es gegenwärtig auch an Lehrern mangelt, aber es kommen noch die Schüler aus Nordamerika, Brasilien, England, Frankreich, Griechenland, Rußland. Das Leben ist lächerlich billig […]«41
Henle war anscheinend nicht alleine darauf gekommen, Helmholtz nach Heidelberg zu holen: Einen Monat vor Helmholtz’ Besuch schrieb ihr gemeinsamer Freund Ludwig an Henle, die Universität Heidelberg benötige nichts weiter als einen Chemiker – er empfahl wärmstens Adolf Strecker, seinen eigenen Lehrer, der Student im Nebenfach bei Liebig gewesen war, noch vor Liebig selbst – und einen Physiologen, um ihre Vorreiterstellung in Wissenschaft und Medizin wiederzuerlangen und es mit Wien, Prag, Berlin oder Würzburg aufnehmen zu können. Ludwig glaubte, Heidelberg brauche jemanden, der wissenschaftlich »virtuos« sei wie Henle. Im Grunde gebe es da drei Möglichkeiten: Brücke, der nicht verfügbar war, du Bois-Reymond, der Berlin nicht verlassen würde – und eben Helmholtz. Da er in Königsberg kein Gehör finde, müsse man nicht einmal allzu tief in die Tasche greifen, um ihn herzubekommen. Aber was für ein Gewinn wäre er! Ludwig erwies sich als guter Freund und Teil von Helmholtz’ kleinem, aber wachsendem Netzwerk und setzte sich bei Henle sehr für ihn ein. Vielleicht war er sogar ein noch besserer Freund als du Bois-Reymond, der Henle wissen ließ, er würde Ludwig für diese Stelle vorziehen. Nicht, weil er glaubte, dass Ludwig ein besserer (oder schlechterer) Physiologe sei als Helmholtz, aber Ludwig passte seiner Meinung nach besser in »das kleine, von Intriguen zerspaltete Heidelberg«.42
Henle zeigte Helmholtz das anatomische Institut (»ausgezeichnet«) sowie die Physiologie (»äußerst dürftig«). Sie zogen gemeinsam durch Heidelberg. Henle lud ihn am Abend zum Tee zu sich ein und stellte ihm Frau und Kinder vor. Helmholtz befand: »Es scheint ein sehr hübsches Verhältniß zwischen ihnen zu bestehen.« Heidelbergs Lage und Umgebung beschrieb Helmholtz in seinem Brief an Olga als »wundervoll, und sehr bequem zu genießen«.43 So wie er sich Henle zu verkaufen suchte, wollte er Olga Heidelberg schmackhaft machen.
Mit Ludwig in Zürich
Auf Henles Vorschlag hin besuchte Helmholtz auf der Weiterfahrt für einige Stunden das nahe gelegene Baden-Baden, dessen Lage im nördlichen Schwarzwald er reizend fand. Er dinierte in der Ruine des alten Schlosses Hohenbaden und »aß dann Eis im Garten der [sic] Conversationshauses, um die Badegesellschaft zu sehen«. Er konnte jedoch, wie er seiner Frau gestand, ohne sie nicht wirklich unbeschwert die wunderbare Landschaft genießen. Bald schon fuhr er nach Kehl weiter und überquerte den Rhein Richtung Straßburg. Es war sein erstes Mal in der »République française«, wie er sie spöttisch nannte. »Da hat man viel um sich zu amüsiren. Überall prangt die Liberté, Fraternité, Egalité, an jedem öffentlichen Gebäude Propriété de la nation, an vielen Privathäusern andere fürchterlich demokratische Wahlsprüche. Das Landvolk und die niederen Klassen der Stadt erscheinen ganz wie in Baden, nur scheinen sie stumpfsinniger zu sein, in den besseren Stadttheilen sieht es aber ganz französisch aus.« Er besichtigte das bekannte Straßburger Münster und stellte fest, wie baufällig es war, fand es teils aber auch »äußerst imposant und edel«. Voller Erstaunen sah er zu, wie sich Menschenmassen mittags vor dem Münster versammelten, »um den Hahn krähen zu hören, die 12 Apostel von Christus vorüberziehen zu sehen u. s. w. Das Landvolk scheint es als eine Art von täglich erneutem Wunder zu betrachten, zu dessen Anblick sie wallfahrten. Ich sah mir den Scherz natürlich auch an«. Sein Französisch kam ebenfalls zum Einsatz, beispielsweise im Gespräch mit zwei Verkäuferinnen. Die erste, eine »sehr feine Comptoir Dame«, ertrug sein Schulfranzösisch immerhin, »wir verständigten uns«. Die zweite war »so schmeichelhaft, sich darüber zu wundern, daß ich kein Franzose sei«. (Sie verstand ihr Handwerk, Helmholtz kaufte ihr etwas ab.) »Kurz ich würde nicht mehr verzweifeln, mich durch Frankreich durchzubeißen, worauf ich bisher eigentlich keine Hoffnung gehabt hätte.«44 Es sollte 15 Jahre dauern, bis er la grande nation erneut besuchte.
Am Morgen fuhr er erst nach Freiburg, dann durch die »höchst romantischen Thäler des Schwarzwalds«, bis er schließlich Schaffhausen in der Schweiz erreichte (die erste von vielen Schweizreisen). Er kam spät an und stieg in einem Hotel in Stadtnähe ab, von dessen Terrasse er eine gute Aussicht auf Schaffhausens Wasserfall hatte, dieses »Weltwunder«. An jenem Abend war er noch enttäuscht davon, am nächsten Morgen sah er ihn mit ganz anderen Augen. Seine »herrlichsten Effekte« könne man nur tagsüber richtig bewundern. Von einem Gerüst aus sah er sich das Schäumen und den Gischtnebel aus der Nähe an und war ganz beglückt und verzaubert von diesem Erlebnis. Wasser in Bewegung beeindruckte ihn immer. Danach nahm er ein »luxuriöses Mittagsmahl« ein, das billiger war, als er es in Berlin je hätte haben können.45
Nach dem Essen reiste er weiter nach Zürich, wo er bei Ludwig unterkam, der ihn »äußerst herzlich« empfing. Ludwig hatte ihn zu diesem Besuch beschwatzt, indem er ihm von Zürichs wunderschöner Natur vorschwärmte. Du Bois-Reymond, der schon früh von Helmholtz’ Besuchsabsichten wusste, schrieb Ludwig ungefähr zehn Tage vorher: »Du wirst auch nächstens Helmholtz bei Dir sehen, den Riegengeist. Man sollte nur Naturforscher werden, wenn man eine Begabung hat der seinigen, daß man so ruhig und gelassen das Größte mühelos ans Licht bringt.« Helmholtz berichtete Olga, Ludwig sei »eine wirklich edle und liebenswürdige Natur«, dessen Frau ihn vermutlich von seinem »burschikose[n] Wesen von ehemals« kuriert habe. Am nächsten Tag besichtigte er das Chemielabor der Züricher Universität und ging mit Ludwig und seinem Prosektor Georg Hermann Meyer auf den Ütliberg, »wo ich zuerst die Gletscher mit den Schneefeldern in großartiger Majestät hin und wieder durch einzelne Wolkenfenster erscheinen sah. Vor diesen Bergen sind alle anderen Maulwurfshügel«.46
Nachdem er schon drei Wochen unterwegs war, erhielt er den ersten von insgesamt nur zwei Briefen von Olga. »Lieber Engel«, so schrieb sie, »eine Frau ohne Mann und Wirthschaft ist wie ein Tippel ohne i.« Sie könne »vernünftig« sein und die verbleibenden fünf Wochen noch aushalten, länger jedoch nicht. Olga war zutiefst bewegt, dass ihr Mann sie so sehr vermisste, glaubte aber, die Schönheit des deutschen Südens und der Schweiz würden ihn schon ablenken. Sie wünschte sich nur das Beste für ihren Gatten: Er solle das Leben in vollen Zügen genießen, auf sich aufpassen und nicht an sie denken (nur, »wenn Du irgend ein Wagstück unternehmen möchtest«). Sein Vater habe sie besucht, sei gesprächig und guter Laune gewesen, jedoch auch »etwas piquiert daß Du nicht ausführlichere Instruktionen zu deiner Schweizerreise von ihm verlangt hattest«. Sie gab ihm (ein paar) Briefe von Helmholtz zu lesen und ihm gefiel durchaus, was er da las, wenn er auch »empört« über seines Sohnes »Beurtheilung des Laokon« war. Vater und Sohn würden einiges zu besprechen haben, kündigte Olga an. Sie berichtete auch davon, dass seine Schwester Julie nach Dahlem gekommen sei und »ein trauriges Bild ihres Familienlebens entworfen« habe, besonders da Marie, die älteste Schwester, im Haushalt bestimmte und seine Mutter »oft auf eine so höhnische, wegwerfende Art« behandle; sie sei offenbar »erzegozentrisch«. Olga ließ ihren Mann wissen, dass sie jederzeit bereit sei, mit ihm und Käthe überallhin zu gehen, »aber nach Heidelberg am Liebsten«. Königsberg mochte sie eigentlich nur, weil es ihr dort gut gegangen war. Nicht mit einer Silbe erwähnte sie seinen Eltern gegenüber die Möglichkeit eines Ortswechsels, denn Leute wie sie, »die so wenig Interesse nach Außen hin haben ist eine solche, wenn noch so schwache, Aussicht, so Hauptsache, daß sie wohl mehr und sichrer zu andern Leuten davon sprechen als gut ist«. Dann berichtete sie noch von ihrer Tochter und schloss mit »tausend Herzensküssen«.47
Helmholtz verbrachte acht Tage bei Ludwig in Zürich und verliebte sich regelrecht in die schöne Umgebung. Ludwig hielt er für einen warmherzigen Menschen, dessen überaus positives Bild von Helmholtz’ Fähigkeiten teils du Bois-Reymond zu verdanken war. »Wenn du alle Lobeserhebungen gehört hättest, die er in seinem ehrlichsten Wohlwollen mir sagte, Du wärest gewiß mit ihm zufrieden gewesen.« Ludwig wollte sich immerfort mit Helmholtz à deux unterhalten und ihn von seinen Züricher Kollegen möglichst fernhalten, damit er ihn »allein« sprechen konnte. Sie redeten über »alle möglichen physiologischen und physikalischen Gegenstände«.
Ludwig arbeitete unermüdlich »in der besten Richtung weiter« und wurde von seinen Studenten »schwärmerisch geliebt«. Helmholtz hielt Ludwig für einen Erfolgsmenschen, von dem »noch Größeres« zu erwarten sei, wenn er sich bisweilen auch von »matter Stimmung und hypochondrisch« ausnahm.48
Den Vormittag verbrachten die beiden immer in Ludwigs Institut, wo Helmholtz die Ausstattung, die Instrumente und Experimente in Augenschein nahm und junge Kollegen kennenlernte, von denen einer »übrigens wegen seiner Arroganz und Weltverachtung nicht zu brauchen war«. Nachmittags besuchten sie das Züricher Umland. Helmholtz liebte den Zürichsee und die umgebenden Berge und war beeindruckt von der Schweizer Verlässlichkeit in trivialen Angelegenheiten. »Überhaupt, was die niederen Tugenden des Menschengeschlechts betrifft, Fleiß, Tähtigkeit, Umsicht und eine nicht allzu strenge Ehrlichkeit, so sind die Schweizer das ausgezeichnetste Volk vielleicht was man sehen kann. Der ganze Canton Zürich ist ein Muster der Cultur, ohne Armuth, und unter gar nicht günstigen Naturbedingungen.« Andererseits gingen den Zürichern in seinen Augen »alle nobleren Züge so gänzlich ab, daß das Leben unter ihnen eine Plage zu sein scheint«. Das politische System der Schweiz, so Helmholtz weiter, beraube ihre Bewohner jeglichen Ehrgeizes, »und ihr Hauptstreben ist eine Art von Pfiffigkeit, vor der jeder anständige Mann in Deutschland oft genug sich schämen würde«. In Schweizer Familien spiele die Ehefrau »stets eine höchst untergeordnete Rolle«, sodass sie selbst in den wohlhabendsten und gebildetsten Haushalten »meist vertraulicher mit der Magd als mit dem Manne« sei. Optisch fand er die Schweizerinnen allesamt etwas »klobig, zum Theil knotig«. Er war jedoch überrascht, dass es den meisten »Stadtdamen« laut Ehevertrag zustand, drei bis vier Wochen im Sommer in den Bergen zu verbringen.49
Nach Helmholtz’ Abreise aus Zürich schrieb Ludwig an Henle, dass Helmholtz in allen Themen, über die sie gesprochen hatten, sich bewandert gezeigt habe (außer teilweise in der vergleichenden Anatomie). Er sei darin »zu Hause« und in der Lage, über Entwicklungsbiologie, allgemeine und pathologische Anatomie, Chemie und allgemeine Botanik mit absolut jedem zu diskutieren. Du Bois-Reymond mutmaßte, Helmholtz’ breit gefächertes Wissen sei teils seinem immensen Pflichtgefühl geschuldet; er könne einfach nichts auch nur ansatzweise unvollständig hinterlassen. Ludwig antwortete, die Tage mit Helmholtz bildeten einen »Abschnitt« in seiner eigenen wissenschaftlichen Entwicklung, »diese Tage seiner Anwesenheit werden aber noch lange vorhalten in der Erinnerung«.50