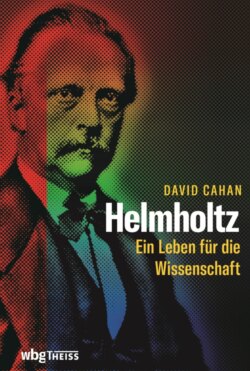Читать книгу Helmholtz - David Cahan - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDass die Atmosphäre umgeschlagen war, wurde auch auf dem Treffen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Göttingen Mitte September 1854 deutlich. Diese Naturforscherversammlung war seit 1822 der institutionelle Rahmen, in dem die deutschen Wissenschaftler und Mediziner alljährlich zusammenkamen, um ihre Arbeiten vorzustellen, den Stand der Forschung zu diskutieren und den potenziellen Nutzen von Wissenschaft für die Gesellschaft herauszustellen. Die Naturforscherversammlung hatte auch für die BAAS (1831) Pate gestanden. Die Versammlung von 1854 war von historischer Bedeutung, was mit der vor dem Plenum gehaltenen Rede von Rudolph Wagner zusammenhing, seines Zeichens Professor für Physiologie, Zoologie und vergleichende Anatomie in Göttingen, wo Helmholtz ihn vor drei Jahren getroffen hatte.18
Wie schon Liebig und Vogt vor ihm war Wagner darum bemüht, anatomisches und physiologisches Wissen populärer zu machen, indem er eine Reihe von Zeitungs-Briefen (1851 – 1852) in Buchform veröffentlichte. Er schrieb im Lichte der fehlgeschlagenen Revolutionen von 1848 und wollte als politischer Konservativer die gescheiterten Einigungsversuche mit dem Argument kompensieren, dass die Deutschen eine höhere Mission zu erfüllen hätten, nämlich einen intellektuellen und künstlerischen Beitrag zur Welt zu leisten. Wagner war mit seinem Kollegen Johannes Müller befreundet und wurde auf die Leistungen von Müllers physikalisch orientierten Studenten aufmerksam, darunter auch Helmholtz. Da Physiker allgemein kaum physiologische Kenntnisse besäßen, hielt er es für umso begrüßenswerter, dass Helmholtz, der in allen Bereichen der Physik beschlagen sei, sich ganz der Physiologie gewidmet habe. Besonders viel Lob hatte Wagner für Helmholtz’ Ausführungen zur Erhaltung der Kraft und seine Messungen der Nervenleitgeschwindigkeit übrig (was Helmholtz aus schmeichelhaften Briefen erfuhr). Mit Vogts Materialismus und politischer Radikalität konnte er aber so gar nichts anfangen und erklärte Wissenschaft und Religion zu zwei getrennten Welten. Daraufhin griff Vogt seinerseits Wagner an, und im weiteren Verlauf schreckten beide nicht vor unsachlichen Argumenten zurück.19
Diese Punkte führte Wagner bei dem Treffen in Göttingen weiter aus, wo er vor 500 registrierten Teilnehmern über »Menschenschöpfung und Seelensubstanz« sprach. Er erläuterte, dass es im Grunde keinen Konflikt zwischen Wissenschaft und biblischem Glauben gebe. Er lehnte es ab, die Naturwissenschaften zu benutzen, um die Religion zu unterminieren, wie es Strauß in seiner historischen Darstellung des Lebens Christi und des frühen Christentums getan hatte. Die moderne Wissenschaft habe sich nicht dazu zu äußern, ob die gesamte Menschheit von einem Menschenpaar abstamme (das sei eine reine Glaubensangelegenheit), wo doch schon der neue und unter Naturwissenschaftlern – insbesondere Physiologen (nicht zuletzt Vogt und Ludwig) – verbreitete materialistische Ansatz den Glauben an die Existenz der Seele, die Freiheit des Willens und mehr untergraben habe. Wagner appellierte an seine Kollegen, die Wissenschaft nicht für Attacken gegen die Schöpfungsgeschichte oder die Existenz der Seele zu missbrauchen und auch am moralischen Fundament der Gesellschaft nicht zu rütteln. Er schlug vor, diese Fragen am nächsten Konferenztag in der Sektion für Anatomie und Physiologie öffentlich zu diskutieren, und lud explizit Ludwig zur Teilnahme ein. Der kam auch tatsächlich, Wagner selbst jedoch nicht. Ein paar Wochen später waren 3000 Exemplare seines Vortrags im Umlauf. Anfang 1855 veröffentlichte Vogt, den Wagner für einen der größten Übeltäter hielt, eine Antwort. Der ursprüngliche Rahmen der Versammlung und einer akademischen Debatte war mittlerweile längst gesprengt, und es ging mindestens genauso um Politik wie um erkenntnistheoretische Fragen oder Wissenschaft. Es galt, den (christlichen) Glauben und den politischen Status quo zu verteidigen oder aber, ganz im Gegensatz, für einen rational geordneten, fortschrittlichen Staat und eine ebensolche Gesellschaft einzutreten.20 Büchner schrieb sein Kraft und Stoff mit Moleschotts aktuellem Pamphlet und der Konferenzdebatte im Hinterkopf. Er argumentierte darin, dass Wissen sich auf Beobachtungen und Experimente stützen müsse, was zum Grundsatz seiner materialistischen Weltsicht wurde, und hob den Stellenwert der Kraft für die Naturgesetze hervor. Wagner erschien dagegen als ein Anhänger des Spiritualismus.
Bald schon hörte Helmholtz vom sogenannten Göttinger Materialismusstreit und erfuhr von Ludwig auch, dass man ihn auf der Göttinger Versammlung in den höchsten Tönen gelobt hatte. Offenbar hatte er derzeit als einziger Physiologe einen Platz im Herzen der praktizierenden Ärzte gefunden, was vor allem seinem Augenspiegel zu verdanken war, der – wie alle sagten – eine neue Ära in der Augenheilkunde bedeutete. Helmholtz berichtete Ludwig davon, dass Ludwig und Wagner zuweilen mit Dr. Eck und Dr. Luther verglichen würden, wie sie einen öffentlichen Disput über die Natur der Seele führten – Wagner kam dabei natürlich der Part mit der Bibel in der Hand zu, während Ludwig die Sache des Teufels und des Atheismus vertrat. Helmholtz konnte nicht verstehen, warum Wagner nicht an der Diskussion teilgenommen hatte, zu der er selbst eingeladen hatte, vermutete jedoch zu Recht: »Wagners Denunziation auf der Naturforscherversammlung hat ihm [Ludwig] bei unserer Regierung Schaden getan.«21 Die Materialismusdebatte war jedenfalls alles andere als vorbei, weder in Deutschland noch in Großbritannien.
Zu Philosophie und menschlicher Wahrnehmung
Anfang der 1850er-Jahre besann sich die Stadt Königsberg auf ihren berühmten Sohn Kant. Im Jahre 1852 regte Karl Rosenkranz, ein liberal eingestellter Königsberger Patriot, Philosoph und Hegelschüler, die Errichtung eines Denkmals für Kant an. 1855 war die Bronzestatue des Königsberger Philosophen dann fertig (wurde jedoch erst 1862 aufgestellt). Helmholtz wurde gebeten, eine Gedenkrede auf Kant zu halten.22 Zweifelsohne fiel ihm diese Ehre zu, da er inzwischen zur bekanntesten Persönlichkeit Königsbergs nach Kant aufgestiegen war. Sein Vortrag »Ueber das Sehen des Menschen« skizzierte nicht nur die neueren Erkenntnisse zur menschlichen Wahrnehmung und ordnete Kants Beiträge zu diesem Thema ein, sondern befasste sich auch mit dem aktuellen philosophischen und kulturellen Wandel in Deutschland. Schließlich folgte der Vortrag (Februar 1855) der Göttinger Naturforscherversammlung und ihrer Materialismusdebatte hart auf den Fersen.
Diplomatisch wie immer merkte Helmholtz eingangs an, dass es die Erinnerung an Kant war, die an jenem Tag seine Zuhörerschaft zusammengebracht hatte, und dass dieser »vielleicht mehr, als irgend ein anderer, dazu beigetragen hat, den Namen unserer Stadt unauflöslich mit der Culturgeschichte der Menschheit zu verknüpfen«. Er betonte den Stellenwert von Tradition, »dass unsere Zeit und diese Stadt eine dankbare und ehrende Erinnerung für Männer hat, denen sie wissenschaftlichen Fortschritt und Belehrung verdankt«.23
Helmholtz ging es zuerst um die Klärung seines eigenen Verhältnisses zur jüngeren Philosophie. Manch einer möge sich ja fragen, ob ein Naturwissenschaftler überhaupt einen Philosophen (also Kant) ehren könne – womit er natürlich auf den aktuellen Streit zwischen Naturwissenschaftlern und Philosophen anspielte. »Weiss man nicht allgemein, dass Naturforscher und Philosophen gegenwärtig nicht gerade gute Freunde sind, wenigstens in ihren wissenschaftlichen Arbeiten? Weiss man nicht, dass zwischen beiden lange Zeit hindurch ein erbitterter Streit geführt worden ist, der neuerdings zwar aufgehört zu haben scheint, aber jedenfalls nicht deshalb, weil eine Partei die andere überzeugt hätte, sondern weil jeder daran verzweifelte, die andere zu überzeugen?« Die Naturforscher rühmten sich »gern und laut« der »grossen Fortschritte ihrer Wissenschaft in der neuesten Zeit« und »von dem Augenblicke, wo sie ihr Gebiet von den Einflüssen der Naturphilosophie ganz und vollständig gereinigt hätten«. Zu Kants Lebzeiten habe es keine solche Kluft zwischen der Philosophie und den Naturwissenschaften gegeben. Kant habe in Bezug auf die Grundlagen der Naturwissenschaften die Meinung der Naturwissenschaftler geteilt, war also Newtonianer. Diese Grundlagen, so fuhr Helmholtz fort, seien heute noch dieselben wie in Kants Tagen, aber die Einstellung der Philosophie ihnen gegenüber habe sich mittlerweile geändert. Kants Philosophie, so Helmholtz, ziele nicht darauf ab, Wissen durch reines Denken zu mehren – glaubte er doch, dass Erkenntnis der Wirklichkeit auf Erfahrung gründen müsse –, sondern »die Quelles unseres Wissens und den Grad seiner Berechtigung zu untersuchen«. Dies sei, so Helmholtz weiter, die ständige Aufgabe der Philosophie: Erkenntnistheorie, nicht Metaphysik. Neben Kant führte Helmholtz für die Naturwissenschaften auch Fichte, den Helden seines Vaters, ins Feld. Seiner Meinung nach war Fichte, der selbst kurz in Königsberg gelehrt hatte, ebenfalls ein Freund der Naturwissenschaften, wenn auch aus einer anderen Zeit.24
Zwei Philosophen gab es, von denen Helmholtz sich stark distanzierte, nämlich Schelling und Hegel. Es seien schließlich diese beiden, die nach Fichtes Tod den ganzen Streit mit den Naturwissenschaften angezettelt hätten. Sie fanden Kants Vorstellung von der Rolle der Philosophie gegenüber der Wissenschaft zu eng gefasst und gingen darüber hinaus. Reine Gedankenkraft, so glaubten sie, könne sehr wohl neue wissenschaftliche Erkenntnisse erbringen, ohne auf Experimente zurückzugreifen. Die Philosophie sei stets das geeignete Werkzeug. (Anders als Helmholtz glaubte, galt das so nicht für den frühen Schelling, der tatsächlich die Wichtigkeit und Notwendigkeit von Erfahrung und Experiment betont hatte und sich damit von Fichtes Denkweise abhob.)25 Helmholtz schreibt weiter von der »höchst unphilosophisch leidenschaftlichen Polemik« Hegels und seiner Schüler, vor allem »gegen Newton und dessen Theorien«. Seine philosophischen Gegner setzten zunächst die Natur mit dem menschlichen Geist gleich und versuchten dann, die Gesetze des Geistes mit den Gesetzen der äußeren Realität zu identifizieren (wie Kant, könnte man sagen). Sie zielten demnach darauf ab, so Helmholtz weiter, die »Identität« der menschlichen Sinneswahrnehmung mit den »wirklichen Eigenschaften der wahrgenommenen Körper nachzuweisen«, was sie zu »Vertheidigern von Goethe’s Farbenlehre« machte. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts steckten die Naturwissenschaften laut Helmholtz noch in den Kinderschuhen, weshalb die Philosophie die Oberhand behielt. Bis auf »wenige ehrenvolle Ausnahmen« wie Humboldt hätten sich die meisten deutschen Wissenschaftler der Naturphilosophie unterworfen, »bis endlich der grosse Aufschwung der Naturwissenschaften in den europäischen Nachbarländern auch Deutschland mit sich fortriss«. (Hier griff Helmholtz tief in die Rhetorikkiste.) Die imperialistischen Naturphilosophen hätten alles »in Anspruch nehmen wollen«, weswegen manche jetzt dächten, man solle die Philosophie meiden oder sie gleich ganz abschaffen. Helmholtz war da anderer Meinung, seiner Ansicht nach hatte die Philosophie durchaus eine berechtigte, wenn auch begrenzte Rolle zu spielen. Und er drang darauf, dass Naturphilosophie nicht »mit der Philosophie überhaupt« zu verwechseln sei.26 Was Helmholtz nicht in seine Überlegungen einbezog, war die Möglichkeit, dass der jüngste Aufstieg der Wissenschaften in Deutschland den Streit zwischen Philosophie und Naturwissenschaft ein Stück weit mit angefeuert haben könnte. Denn vielleicht nahmen die Philosophen und anderen Geisteswissenschaftler die vielen neuen Professorenstellen, Institute und Labore ja als Bedrohung wahr?
Nachdem er die Philosophie abgehandelt hatte, ging Helmholtz zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur menschlichen Sinneswahrnehmung über, als dem »Punkt, an dem sich Philosophie und Naturwissenschaften am nächsten berührten«. Das Auge nannte er »ein von Natur aus gebildetes optisches Instrument, eine natürliche Camera obscura«. Wie er glaubte, gab es Daguerreotypie und Photographie mittlerweile lange genug, dass der Vergleich eines Auges mit einer menschengemachten Kamera seinem Publikum etwas sagen musste. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen den beiden liege darin, dass dort, wo sich in der Kamera eine lichtempfindliche Glasplatte befand, auf die das Licht traf, das Auge eine sensible Netzhaut hatte, mithilfe derer es das Licht über ein komplexes Nervensystem ans Gehirn meldete. Im Folgenden erklärte Helmholtz die Akkommodation des Auges und wie man die Netzhaut mithilfe eines Augenspiegels untersuchen konnte. Aus physikalischer Sicht hielt er das Auge für ein mangelhaftes optisches Instrument – so mangelhaft, dass er seine Messungen der Hornhautkrümmung bei der Erforschung der Akkomodation nur zu illustrativen Zwecken durchgeführt habe. Es sei Zeitverschwendung, hier präzise Ergebnisse erzielen zu wollen. Helmholtz machte sich nun daran, den physikalischen Prozess des Sehens zu erklären: Jeder Bildpunkt auf der Netzhaut entspreche einem Lichtpunkt, der von außen einfalle. Lichtstrahlen würden dabei von Objekten reflektiert und gelangten durch Hornhaut und Kammerwasser zur Linse, die sie bündele und durch den Glaskörper ein Bild auf die Netzhaut übertrage. Der Nervenapparat des Auges, so erklärte er weiter, unterscheide die Helligkeit verschiedener Objekte. Unser Bild von den Dingen werde in der »Kristalllinse« des Auges gebildet, die das Bild dann auf die Netzhaut werfe.27
Helmholtz führte weiter aus, dass die Wahrnehmung von Licht das Auge auf verschiedene Weise (beispielsweise mechanisch oder elektrisch) stimulieren könne. Aus einer Stimulation des Sehnervs ergebe sich aber immer eine optische Empfindung. Wenn derselbe Reiz auf einen anderen Nerventyp treffe, entstehe eine andere Art von Empfindung (keine Lichtempfindung). Ließe man denselben Reiz beispielsweise auf den Hörnerv einwirken, entstehe eine Schallempfindung, bei Hautnerven eine Tastempfindung oder ein Wärmegefühl, beim Muskelnerv jedoch gar keine Empfindung, sondern ein Zucken. Es sei ein und derselbe Reiz, der diese unterschiedlichen Empfindungen auslöse, so Helmholtz weiter, wobei die Art der Empfindung nicht von dem äußeren Objekt abhänge, von dem sie ausgehe, sondern von dem Sinnesnerv, der sie empfange. Hier kam er natürlich auf Müllers Gesetz der spezifischen Sinnesenergien zu sprechen, das dieser erstmals in Über die phantastischen Gesichtserscheinungen (1826) beschrieben hatte. Es war Helmholtz zufolge der bedeutendste Fortschritt, »den die Physiologie der Sinnesorgane in neuerer Zeit gemacht hat«. Die verschiedenen Farben entstünden, wenn Licht modifiziert werde. Je nach Schwingungsfrequenz erhalte man die Farbtöne von Violett bis Rot; mische man verschiedenfarbiges Licht, ergebe sich eine neue, eine Mischfarbe.28
Diese wissenschaftlichen Fakten zur Entstehung von Empfindungen führten Helmholtz zu einem erkenntnistheoretischen Aspekt »von der höchsten Wichtigkeit«: Unsere Wahrnehmung hängt genauso von unseren Sinnen wie von äußeren Objekten ab. Die moderne Sinnesphysiologie als eine experimentelle Wissenschaft habe, so Helmholtz, gezeigt, was Kant einst über die Rolle eingeborener Gesetze und die Vorgehensweise des Geistes bei der Ideenbildung zu beweisen versucht habe. Helmholtz glaubte, die moderne Wissenschaft werde zu philosophischen Erkenntnissen führen. Auch gebe es eine Parallele zwischen einer modernen, physiologisch begründeten Theorie der Wahrnehmung und Kants Erkenntnistheorie. Damit ließ er durchblicken, ohne es direkt zu sagen, dass er Kants Vorstellung von Geist für überholt hielt. Er berief sich zwar auf den Philosophen, lehnte seinen Standpunkt jedoch de facto ab.29 Kant war zurück, wenn auch nicht vollständig.
Der physikalische und physiologische Prozess der Lichtempfindung war für Helmholtz nicht das eigentliche Sehen, sondern eine Voraussetzung dafür. »Das Sehen besteht also erst im Verständnis der Lichtempfindung.« Hier führte Helmholtz eine psychologische Dimension in seine Analyse der menschlichen Wahrnehmung ein, womit er sich klar von den Ansichten der Materialisten distanzierte.30
Um seinen Zuhörern und Lesern die Tiefenwahrnehmung zu verdeutlichen, also den Unterschied zwischen der Betrachtung einer perspektivischen Zeichnung und der Betrachtung eines Objekts selbst, brachte Helmholtz an dieser Stelle Wheatstones Stereoskop ins Spiel: Unsere zwei Augen betrachten die Welt stets aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, blicken sie aber auf die perspektivische Zeichnung eines Objekts auf einer ebenen Fläche, nehmen sie beide dieselbe Perspektive ein. Dadurch können sie den »wirklichen Gegenstand von seiner Abbildung unterscheiden«. Würde man aber dem linken und dem rechten Auge jeweils eine räumliche Zeichnung desselben Objekts vorlegen »und dann jedem Auge die betreffende Zeichnung in einer richtigen Lage zeigen, so hört der wesentliche Unterschied zwischen der Ansicht des Gegenstands und seiner Abbildung auf, und wir glauben nun, statt der Zeichnung in der That die Gegenstände zu sehen«. Hier kam das Stereoskop zum Einsatz: Es zeigte zwei Zeichnungen desselben Objekts aus leicht unterschiedlichen Perspektiven und konnte so ausgerichtet werden, dass die Zeichnungen sich an ein und demselben Ort zu befinden schienen. Auch mit Schielen lasse sich dieser Effekt erzielen, erklärte Helmholtz, wenn man so lange auf zwei dicht nebeneinander liegende Objekte schiele, bis sie irgendwann wie eins wirkten. Ob mit Stereoskop oder Schielen – das Ergebnis sei immer eine optische Illusion.31
Zwar hielt Helmholtz den Vortrag zu Ehren Kants, dachte aber bezüglich der Raumverhältnisse ganz anders als der Philosoph. Kant sah die räumlichen Beziehungen als a priori gegeben an, Helmholtz hielt sie für etwas, was unsere Augen mithilfe ihrer beiden Perspektiven und individuellen Bewegungen, also durch ihre erfahrungsbasierten Aktivitäten, gewissermaßen ständig neu konstruierten. Auch eine psychologische Komponente – den menschlichen Willen – sah Helmholtz bei der geistigen Bildung von Raumbezügen involviert. Er führte als Beispiel verschiedene Situationen an, in denen es zu Bewegungsillusionen kommen konnte: Schwindel, hohes Fieber, wenn man sich schnell im Kreis drehte oder in einem fahrenden Zug saß, lange Schiffsreisen. Dabei handele es sich um körperliche Zustände oder Orientierungswechsel, in denen die Bewegungen der Augenmuskeln fehlinterpretiert würden. Wie er glaubte, vermochte die Wissenschaft viele ansonsten unerklärbare Illusionen zu erklären. Sehen war für Helmholtz größtenteils ein erlerntes Verhalten.32
Teile unserer Geistestätigkeit, so führte er weiter aus, gingen unbewusst und unabhängig von Willen, Intelligenz und Überzeugungen vonstatten, sodass es fraglich sei, ob man hier überhaupt von etwas wie »Denken« sprechen könne. Wie er einräumte, sei der psychologische Prozess, der körperliche Empfindungen in Wahrnehmungen umwandelte, allerdings schwer zu verstehen. Der Vorgang der Wahrnehmung beinhalte nämlich immer auch den sogenannten unbewussten Schluss, der sich auf zuvor Gelerntes stütze. Um dies zu veranschaulichen, rekurrierte Helmholtz auf seine – ja reichlich vorhandenen – Theatererfahrungen: Auch wenn ein Schauspieler so gekleidet sei und sich so bewege und betrage wie die Figur, die er auf der Bühne darstellen wolle, sei das Publikum sich doch dessen stets bewusst, dass es der Schauspieler ist und bleibt, der da auf der Bühne steht. Es halte »unwillkürlich« an seiner Erwartung fest, dass es die Gefühle und Handlungen des Schauspielers sind, die der Rolle entsprechen, die er spielt. Die besten Darsteller schafften es allerdings, das Publikum vergessen zu lassen, dass sie spielten, sodass sie »ganz natürlich« wirkten. Erst im Vergleich mit weniger begabten Kollegen erkenne man ihr Talent und werde daran erinnert, dass sie tatsächlich schauspielerten. Ähnlich sei es mit optischen Illusionen: Zwar wissen wir, dass die Vorstellung oder das mentale Bild, das ein Sinneseindruck hervorgerufen hat, falsch ist, und dennoch bleibt diese Vorstellung »in all ihrer Leibhaftigkeit bestehen«. Genau wie das Talent eines Schauspielers eine Illusion erzeugen und aufrechterhalten kann, sind unsere Sinneseindrücke mit Vorstellungen verbunden, »welche durch die Natur unserer Sinne selbst bedingt« sind. Millionen Male in unserem Leben durchlaufen wir diesen Prozess, beispielweise »wenn in gewissen Nervenfasern unserer beiden Augen, bei einer gewissen Stellung derselben, ein Gegenstand Lichtempfindung erregte, wir den Arm so weit ausstrecken mussten, oder eine bestimmte Zahl von Schritten gehen mussten, um ihn zu erreichen. Dadurch ist denn die unwillkürliche Verbindung zwischen dem bestimmten Gesichtseindruck und der Entfernung und Richtung, in welcher der Gegenstand zu suchen ist, hergestellt«. Dies lasse sich auch auf die Einschätzung von Entfernungen übertragen, die ebenfalls ein erlernter Prozess sei. Helmholtz erinnerte sich noch gut daran, wie ihm als Junge zum ersten Mal »das Gesetz der Perspective aufging«, als er mit seiner Mutter an einem hohen Turm vorbeikam, auf dem sich Leute befanden. (Als er ein Jahr nach dieser Ansprache du Bois-Reymond zur Geburt seines ersten Kindes gratulierte, äußerte er, nur halb im Scherz, dass dessen Sohn mit seinen drei Monaten »sich wahrscheinlich schon mit den schwierigen Fragen, wie sich Raum- und Zeitvorstellungen bilden, praktisch beschäftigt und davon jetzt mehr weiß als alle gelehrten Physiologen der Welt«.) Die Sinnesorgane durchliefen demnach eine Art Ausbildung, wodurch sich für Helmholtz »die Sicherheit und Genauigkeit in der Raumconstruction unserer Augen« erklärte. Der Mensch lerne wie ein geschickter Jongleur oder Billardspieler, visuelle Objekte zu beurteilen. Sehen zu lernen, bedeutete für Helmholtz, die Vorstellung oder das Bild von einem Objekt mit bestimmten in der Vergangenheit gehabten oder aktuellen Empfindungen zu verbinden.33
Zum Abschluss seiner Rede kam Helmholtz wieder auf Kant zurück. Wenn es nämlich eine Verbindung zwischen einer Empfindung und dem Bild eines bestimmten Körpers gebe, müsse es notwendigerweise eine Idee von dem Körper als solchem geben. Letztendlich nähmen wir mithilfe unserer Sinne nie direkt die Objekte der äußeren Wirklichkeit wahr, sondern von Geburt an lediglich ihre Wirkung auf unseren Nervenapparat. Der Übergang von der Welt der Empfindungen in unserem Nervensystem zur äußeren Wirklichkeit geschehe »nur durch einen Schluss«. Das Vorhandensein von äußeren Objekten dürften wir als Ursache unserer Nervenerregung allerdings voraussetzen, führt Helmholtz weiter aus, denn eine Wirkung ohne Ursache existiere nicht. Dieses Gesetz sei kein Erfahrungssatz, sondern die notwendige Bedingung, um überhaupt Kenntnis über die Dinge der Außenwelt erlangen zu können. Es ergebe sich nicht »aus der inneren Erfahrung unseres Selbstbewusstseins«, denn »die selbstbewussten Akte unseres Denkens betrachten wir gerade als frei«. Nun war Helmholtz in seinen Ausführungen zur Sinneswahrnehmung wieder bei Kants Satz »Keine Wirkung ohne Ursache« angelangt, einem vor aller Erfahrung stehenden Gesetz des Denkens. So diplomatisch, wie er seinen Vortrag begonnen hatte, beendete er ihn auch: »Es war der ausserordentlichste Fortschritt, den die Philosophie durch Kant gemacht hat, dass er das angeführte Gesetz und die übrigen eingeborenen Formen der Anschauung und Gesetze des Denkens aufsuchte und als solche nachwies.« Helmholtz fand sogar: »Damit leistete er, wie ich schon vorher erwähnte, dasselbe für die Lehre von den Vorstellungen überhaupt, was in einem engeren Kreise für die unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmungen auf empirischen Wegen die Physiologie durch Johannes Müller geleistet hat.« Er war überzeugt, »dass Kant’s Ideen noch leben, und noch immer sich reich entfalten, selbst in Gebieten, wo man ihre Früchte vielleicht nicht gesucht haben würde«. Der Konflikt zwischen der Philosophie und den Naturwissenschaften beziehe sich daher nur auf »gewisse neuere Systeme der Philosophie« (Hegelianer und dergleichen) und nicht »auf alle Philosophie überhaupt«. In seinem Vortrag habe er darzulegen versucht, »dass das gemeinsame Band, welches alle Wissenschaften verbinden soll, keineswegs durch die neuere Naturwissenschaft zerrissen ist«. Kant war zurück, und Helmholtz war als einer der Ersten maßgeblich daran beteiligt, ihn zurückzuholen.34
Aber auch wenn Helmholtz ihn nicht offen kritisierte und selbst seine implizite Kritik an Kant nicht so harsch war wie die an Goethes Optik, hatte er ihn doch geschickt korrigiert. Ganz nebenbei hatte er dafür gesorgt, dass sich sein eigener Name für immer mit zwei ganz großen Namen deutscher Kultur verband. In kultureller Hinsicht waren er und Humboldt mittlerweile zu den vornehmsten Vertretern der deutschen Naturwissenschaften avanciert. Seine Vorträge zu Goethe und zur menschlichen Wahrnehmung wirkten romantischen und idealistischen Anschauungen in der deutschen Philosophie und Kultur entgegen und gaben der gesamten intellektuellen Szene Europas einen neuen, naturalistischen Ton vor – genau wie Darwin es bald mit On the Origin of Species (Über die Entstehung der Arten) und The Descent of Man (Die Abstammung des Menschen) tun würde, oder Marx mit seinen Schriften zur politischen Ökonomie. Im europäischen Denken wurde die Welt zunehmend ein Ort, der in naturalistischen, nicht in übernatürlichen (religiösen) Kategorien erklärt werden musste. Es war der Anbruch eines neuen Zeitalters.
Anfänge einer Farbwissenschaft
Keine zwei Monate vor Helmholtz’ Vortrag zur menschlichen Wahrnehmung charakterisierte Maxwell dessen Theorie der zusammengesetzten Farben als die philosophischste Herangehensweise an das Thema, die ihm je begegnet sei. Er stellte Helmholtz mit Blick auf seine Farbtheorie in eine Reihe mit Newton, Thomas Young, James David Forbes und Hermann Günther Graßmann. Maxwells Lob zum Trotz erfuhr Helmholtz dafür aber auch Kritik. Auf die Einwände des Mathematikers und Wissenschaftlers Graßmann reagierte Helmholtz, indem er der BAAS in Hull eine überarbeitete und erweiterte Version seiner früheren Ausführungen vorlegte. Auf Basis einer neuen Instrumententechnik zum Mischen der Farben und unter Nutzung seiner eigenen Farbwahrnehmung als Standard gelang es ihm, Graßmanns mathematische (geometrische) Gesetze und empirische Ergebnisse zur Farbmischung teils zu kritisieren, teils sich zu eigen zu machen und teils anzupassen. Für die Darstellung der Farbmischung nutzte Helmholtz eine Art Dreieckskurve anstatt eines Kreises oder einer baryzentrischen Figur (wie Newton und Graßmann vorschlugen). Er zeigte graphisch und empirisch, wie das Auge Farben additiv mischte. Youngs Dreifarbentheorie gegenüber blieb er skeptisch. Was ebenso wichtig war und zu einem unterscheidenden (und kontrovers diskutierten) Merkmal seiner eigenen Theorie zur Farbwahrnehmung wurde: Wieder räumte er dem menschlichen Ermessen eine Rolle dabei ein. Noch bevor das Jahr 1855 zur Neige ging, stellte auch Maxwell seine eigenen Farbgleichungen vor, die er im Grunde der Vorarbeit beider, Graßmanns und Helmholtz’, verdankte. Innerhalb von drei Jahren hatten diese drei Männer die Wissenschaft der Farbmetrik begründet.35
Gerangel um eine Stelle in Bonn
Er ließ es sich zwar nicht anmerken, aber Helmholtz wollte schon eine ganze Weile fort von Königsberg. Er war einfach zu weit weg von Berlin, von vielen seiner Kollegen und auch von seinen potenziellen Studenten in der Mitte und dem Westen Deutschlands, ganz zu schweigen von seiner Familie. Als Helmholtz’ Mutter 1854 starb, kam er nicht zu ihrer Beerdigung, vermutlich weil das Semester bald anfangen würde und Königsberg zu weit von Potsdam entfernt war, um es rechtzeitig hin und zurück zu schaffen. Zwar ist der Einfluss der Mutter – von der Helmholtz sagte, sie habe im Leben gelitten und für die Menschen gelebt, die sie liebte – auf ihn weniger offensichtlich als der seines Vaters, er verdankte ihr jedoch viel. Die Wichtigkeit, die Helmholtz einem stabilen Familienleben beimaß, seine Bewunderung für gebildete Frauen und die offensichtliche Tatsache, dass er sich in ihrer Gegenwart wohlfühlte (weil er mit ihnen nicht fachlich konkurrieren musste) – all dies konnte man zumindest teilweise dem Einfluss seiner Mutter zuschreiben. Vor allem aber zog es ihn aus Königsberg fort, weil das dortige Klima für Olgas angeschlagene Gesundheit nachteilig war. Er war entschlossen, eine akademische Position an einem wärmeren Ort zu finden, der Olgas Gesundheit zuträglich wäre. Dass es in Heidelberg nicht geklappt hatte, bedauerte er ebenso wie Bunsen, der ihn nicht hatte herholen können.36
1854 schließlich tat sich eine Möglichkeit in Bonn auf. Die medizinische Fakultät suchte einen Nachfolger für einen Anatomen, der in den Ruhestand ging, wollte aber allgemein gesprochen auch das Personal und Angebot der Fakultät ausbauen. Man empfahl dem Ministerium, Julius Budge, der seit 1847 als außerordentlicher Professor für Anatomie, Physiologie und Zoologie tätig war, zum ordentlichen Professor für Physiologie zu bestellen. Das Ministerium kam dem nach, zog aber ansonsten nicht so mit, wie Bonn es sich wünschte. Die Situation blieb im Fluss.37
Helmholtz unternahm einige Anstrengungen, um sich die Option auf eine Stelle in Bonn zu sichern. Darin lag Konfliktpotenzial im Verhältnis zu du Bois-Reymond und Ludwig, die sich beide ebenfalls für den Posten interessierten. Helmholtz glaubte auch durchaus, dass eine ordentliche Professur in Bonn besser zu du Bois-Reymonds wissenschaftlicher Ausrichtung und dessen Selbstgefühl passen würde als seine aktuelle Stellung als außerordentlicher Professor in Berlin. Das Ministerium werde wohl mehrere gute Wissenschaftler nach Bonn holen wollen, um die medizinische Fakultät aus der derzeitigen Versenkung zu holen. Helmholtz riet du Bois-Reymond daher, die Stelle anzunehmen, falls man sie ihm anböte. Wolle er sie jedoch nicht, bat er ihn, so früh wie möglich Bescheid zu geben, sodass er selbst mit dem Ministerium sprechen könne. Wenn das Salär mit dem in Königsberg vergleichbar sei, würde er Bonn vorziehen, da er dort seinen Tätigkeitsbereich ausweiten und so mehr verdienen könne. Außerdem würde Olga, deren Gesundheit er als dauerhaft gefährdet einschätzte, ein angenehmeres Klima zugutekommen. Auch ihm habe das Königsberger Klima in den vergangenen 18 Monaten das Arbeiten zunehmend erschwert und ihm heftige Bauchschmerzen verursacht, die seiner Vermutung nach vom Darm herrührten. Dennoch hielt er seine Gründe für nicht so dringlich wie du Bois-Reymonds und wünschte ihm Erfolg. Falls aus der Sache aber nichts würde, möge er Helmholtz doch die angebotenen Bedingungen wissen lassen, damit er informiert nach Berlin reisen könne, um mit dem Ministerium direkt zu verhandeln.38
Da du Bois-Reymond ihn nicht auf dem Laufenden hielt, bat er Schulze (vom Ministerium), ihn für die Stelle in Betracht zu ziehen. Helmholtz gab zu, dass er nichts über Bonn wisse, ja sich sogar unsicher sei, ob die Stelle überhaupt vakant sei, ob Bonn ein physiologisches Institut besitze und welche Vorlesungen man dort von ihm erwarte. Dass er nach Bonn wollte, hatte nach seinen eigenen Angaben verschiedene Gründe: Es lag näher an England und Holland, wohin er enge berufliche Kontakte pflegte. Julius Budge war in Bonn. Königsberg war schlicht und einfach abgelegen. Last, but not least war da der schädliche Effekt von Königsbergs rauem Klima auf Olgas und seine Gesundheit. Er glaubte ihr Leben in Gefahr und stellte deshalb alle anderen Überlegungen hintan, als er im Ministerium um die Versetzung bat. Die Sorge über die hohen Lebenshaltungskosten in Bonn ließ ihm aber doch keine Ruhe, und er gab der Hoffnung Ausdruck, dass er dort mindestens so viel verdienen würde wie in Königsberg. Die ganze Angelegenheit, erklärte er, liege ihm sehr am Herzen. Sollte es sich schwierig gestalten, Ersatz für ihn zu finden, könne das Ministerium auf seinen Kollegen Wittich zurückgreifen.39 Er machte sich nicht die Mühe, eine Liste seiner Publikationen beizufügen, das Ministerium wusste schließlich bestens Bescheid über seine Leistungen und sein steigendes Ansehen. Es ließ sich ja auch leicht feststellen, dass er in bisher 13 Jahren Berufstätigkeit 34 Publikationen vorgelegt hatte, 26 davon aus seiner Zeit in Königsberg. Vermutlich war seine Publikationsliste in qualitativer wie quantitativer Hinsicht im Kollegenkreis einzigartig.
Innerhalb von 14 Tagen erhielt er eine positive Antwort des Ministeriums, die jedoch an Bedingungen geknüpft war. Helmholtz schrieb zurück, dass er gerne, wie gewünscht, die Lehrtätigkeit in Pathologie gegen eine solche in Anatomie tauschen würde, dies sei ohnehin eher sein Interessengebiet. Auch sei er an den Entwicklungen in der Pathologie nicht mehr dicht dran und habe Anatomie bereits an der Akademie der Künste gelehrt. Seine ersten Veröffentlichungen hätten die mikroskopische Anatomie zum Gegenstand gehabt, und auch wenn eine oberflächliche Durchsicht seiner Arbeiten dazu verleiten könne zu denken, er habe mit Anatomie nicht viel am Hut, lägen seine Interessen der anatomischen Wissenschaft doch nicht allzu fern.40 So drehte er es zumindest.
Helmholtz hatte seinerseits ebenfalls drei Anliegen, beziehungsweise Bedingungen. Seine Ernennung sollte zum Professor für Anatomie und Physiologie lauten, da sich seine Bemühungen bisher doch hauptsächlich auf letztere Disziplin konzentriert hätten. Bonn hatte, wie er inzwischen erfahren hatte, noch kein physiologisches Institut. Daher fragte er beim Ministerium an, ob es Gelder für die Anschaffung physiologischer Instrumente zur Verfügung stellen könne; schließlich war wissenschaftliche Arbeit in seinem bevorzugten Forschungsfeld an ein entsprechendes Equipment gebunden. Und zu guter Letzt: Seinem Königsberger Gehalt von 1000 Talern würden in etwa 1200 Taler für Bonn entsprechen – oder besser noch 1400, weil die medizinische Fakultät dort mehr Medizinstudenten zählte (ungefähr 85), was für ihn mehr Arbeit bedeuten, sich jedoch kaum in seinem Honorareinkommen niederschlagen würde. Unter den genannten Bedingungen werde er die angebotene Stelle gerne antreten.41
Ludwigs Aussichten auf eine Anstellung in Preußen sahen eher finster aus, er ließ sich aber dadurch, dass Helmholtz ihn in Bonn ausstach, nicht aus der Bahn werfen. Ludwig berichtete Henle, Helmholtz habe ihm von seinen Verhandlungen mit Schulze geschrieben. Er selbst hatte zudem von einem gut informierten Freund am Ministerium gehört, dass seine eigene Kandidatur (ausschließlich) vom Minister abgelehnt worden war, dem erzkonservativen Karl Otto von Raumer. Er vermutete, dass jemand – vermutlich Wagner – den Minister über Ludwigs allzu materialistische Ansichten und die leidige Göttinger Sache informiert habe. Hier ging es um Frömmigkeit versus Materialismus, und Ludwig hielt es für undenkbar, dass Raumer dem König empfehlen würde, ihn nach Bonn zu berufen. Falls er noch Hoffnungen gehegt haben mochte, so fielen sie dem reaktionären politischen Geist Preußens der 1850er-Jahre zum Opfer. 1855 verließ Ludwig Zürich für eine Stelle als Professor für Physiologie und Zoologie an der medizin-chirurgischen Militärakademie, Josephinum genannt, in Wien.42
Mitte März 1855 gingen die Verhandlungen um die Stelle in Bonn in die finale Phase. Die politischen Schachzüge waren einigermaßen komplex. Humboldt ließ du Bois-Reymond wissen, dass man ihn unter Druck setze, Helmholtz zu unterstützen, für den er ebenso viel Zuneigung und Respekt hege wie für du Bois-Reymond selbst, für den er sich jedoch nicht verwenden wolle, bis er nicht von du Bois-Reymond gehört habe, ob er nach Bonn kommen wolle. Er versicherte ihm, in Berlin stehe ihm eine große Zukunft bevor. Raumer für seinen Teil wollte Helmholtz, Schönlein wollte jemand anderes und nahm ihm den Wind aus den Segeln. Du Bois-Reymond schrieb an Humboldt, er solle Helmholtz unterstützen, dem er alles Gute wünsche. So machte sich Humboldt daran, eine Liste mit Helmholtz’ wissenschaftlichen Leistungen zusammenzustellen. Helmholtz war sehr dankbar für du Bois-Reymonds Rückhalt. Er schrieb selbst an Humboldt, mit der Bitte um Unterstützung und um den Stand der Dinge zu erfahren. Es beunruhigte ihn, dass es vielleicht Krieg (wohl auf der Krim) geben würde und die Regierung gezwungen sein könnte, die Berufung zu verschieben. Zudem stand er in direktem Kontakt mit Schulze und einem befreundeten Chemiker, der wiederum einem Freund im Ministerium schrieb und nachfragte, was er wisse. Helmholtz scheute keine Mühen, zumal Olgas Zustand sich in der zweiten Winterhälfte verschlechtert hatte. Eine Grippe, die in Königsberg umging, hatte sie zwei Wochen lang ans Bett gefesselt, einen ganzen weiteren Monat lang vermochte sie nicht zu sprechen. Als sie sich dann langsam erholte, war ihre Stimme noch immer nicht ganz die alte und sie litt weiter an Husten.43
Humboldt schrieb sofort an Raumer und Helmholtz. Raumer ließ er wissen, wie sehr er sich gefreut habe, als Helmholtz zum ordentlichen Professor berufen wurde, der »junge Mann« und er stünden »in freundschaftlichsten Verhältnissen«. Durch Olgas »ernst gefahrendrohenden Gesundheitszustand« sei Helmholtz im Grunde gezwungen gewesen, sich in Bonn zu bewerben. Humboldt verwendete sich gerne für diesen »so talentvollen, überaus thätigen und strebsamen Gelehrten«. Er äußerte sich im Folgenden hauptsächlich zu Helmholtz’ Arbeit in der Anatomie (so, wie sie war). Lobend nannte er dessen Dissertation zu den Ganglienzellen, sie gehöre »zu den feinsten Arbeiten der neueren mikroskopischen Anatomie«. Seine anatomischen Beiträge zum Auge und die damit zusammenhängende Akkommodationstheorie seien »nicht minder wichtig«. Zudem seien sich wohl alle darin einig, wie nützlich der Augenspiegel sei. »Gleich grosse Stärken in Anatomie und Physiologie in einem Individuum sind nie zu finden in dem jetzigen Zustand des Wissens.«44
Humboldt ließ Helmholtz wissen, dass er sich für ihn eingesetzt hatte, noch bevor dieser ihn darum gebeten hatte. Sobald er erfahren habe, dass ihr gemeinsamer Freund du Bois, dem er sich aufgrund ihrer alten Freundschaft stärker verpflichtet fühle, Berlin nicht verlassen wolle, habe er sich frei gefühlt zu handeln. Seine warme Empfehlung an die Adresse des Ministeriums stütze sich vor allem auf die Schriften, die Helmholtz ihm hatte zukommen lassen. Er habe jedoch auch Olgas Gesundheitszustand, ihre Freundschaft und Helmholtz’ herausragende Talente berücksichtigt. Der Umzug werde Helmholtz sicher guttun, ihm selbst sei es eine Freude, Helmholtz zu unterstützen.45 Humboldt unterhielt beste Kontakte zum Hof und zum Kultusministerium wie kein zweiter preußischer Wissenschaftler und genoss das denkbar größte internationale Renommee – und dieser Mann hatte Helmholtz aufs Neue seine vollste Unterstützung zugesichert.
Dennoch war Raumer nicht ganz zufrieden und forderte von Helmholtz weitere Zusicherungen, dass er Anatomie lehren könne und werde. Helmholtz versicherte ihm, dass er dazu vollkommen in der Lage sei, was seine Lehrtätigkeit zur Anatomie von Mensch und Tier an der Akademie der Künste in Berlin sowie seine Forschung seit 1843 bewiesen. Außerdem habe er als Assistent am anatomischen Museum bei den Sammlungen geholfen. Helmholtz schloss seinen Brief an Raumer in fast flehendem Ton und versprach, sein Bestes in Wahrnehmung seiner neuen Aufgabe zu geben, wenn ihm die Stelle nur freundlicherweise gewährt würde.46 Er war wirklich verzweifelt.
Anfang Mai kam er endlich, der lange ersehnte Ruf. Helmholtz würde am 1. Oktober 1855 die Professur für Anatomie und Physiologie in Bonn antreten und würde das anatomische Institut und Museum leiten. Sein Gehalt würde 1200 Taler betragen, plus 300 Taler für die Umzugskosten. Im Grunde erhielt er ein ausreichendes Gehalt, jedoch nur magere 50 Taler für Gerätschaften. Bestenfalls würde das seine experimentelle Forschung in Bonn schwierig gestalten. Zudem durfte er seine Königsberger Instrumentensammlung nicht mitnehmen. Er schrieb Ferdinand: »Dass ich meine Instrumente hier lassen muss, ist der unangenehmste Verlust, der mich bei meiner Uebersiedlung trifft.« Der Dekan der Bonner Medizin, Moritz Naumann, informierte Helmholtz, er müsse keine Antrittsvorlesung halten, da er ja bereits ordentlicher Professor an einer anderen preußischen Universität sei. An der Fakultät freue man sich bereits, ihn kennenzulernen, fügte Naumann noch an und zollte seinerseits Helmholtz’ hervorragenden Leistungen Respekt. In der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde habe man oft über seine Arbeiten gesprochen. Naumann bat Helmholtz, schnell zu entscheiden, welche Anatomiekurse er im nächsten Semester unterrichten wolle. In diesem Zusammenhang ließ Helmholtz Moritz Ignaz Weber, den zweiten ordentlichen Professor für Anatomie in Bonn, brieflich wissen, dass er, dessen Bitte entsprechend, Anatomie unterrichten werde. Weber war überaus dankbar für diese Bekundung guten Willens. Er informierte ihn im Detail über seinen eigenen Stundenplan und schickte eine vierseitige Beschreibung des anatomischen und physiologischen Institutes, samt einer Aufstellung zu Gerätschaften, Bücherei, Studentenzahl (43 – 60 in der Anatomie) und Budget.47 Endlich war alles in trockenen Tüchern.
Abschied von Königsberg
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ludwig erfuhr, dass Raumer ihn wegen seiner materialistischen Ansichten abgelehnt hatte und jemand im Ministerium sich auch das Ohr des Königs geneigt gemacht hatte. Noch im letzten Oktober hatte Ludwig sich des Postens sicher geglaubt. Man habe ihm den Eindruck vermittelt, dass er die gleichen Chancen habe wie Helmholtz und du Bois. Ludwig äußerte sich Helmholtz gegenüber dahingehend, dass der Minister seiner Meinung nach Helmholtz sein Talent vergeuden ließ, indem er ihn Anatomie zu unterrichten zwang – anstatt ihm alle Freiheit zu lassen, in Bonn mit seinen Instrumenten als Professor der Physiologie zu wirken. Dass Helmholtz und nicht Ludwig die Stelle bekam, lag teils an Helmholtz’ Quietismus und Zuverlässigkeit in politischer Hinsicht (und an Ludwigs Mangel daran). Auch Brücke gratulierte Helmholtz. Wie er vermutete, würden ihm in Bonn anfänglich nicht alle Kollegen die Stelle gönnen, doch würden sie irgendwann ihre Meinung sicher ändern.48
Einen Großteil des Juni und Juli verbrachte Helmholtz mit Vorbereitungen für den Abschied aus Königsberg. Mitte Juni legte er sein Amt als Vorsitzender des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde nieder – ein herber Verlust für die Mitglieder, die ihn schätzten und mochten. Sie gaben ihm zu Ehren ein Bankett, auf dem sie ihm eine silberne Votivtafel überreichten und ihn zum Ehrenmitglied machten. Mitte Juli fuhr Olga mit den Kindern nach Dahlem, wo sie sich in ärztliche Behandlung begab. Helmholtz blieb noch in Königsberg, um einige Doktorexamen abzunehmen (die ihm schon um die 100 Taler eingebracht hatten), letzte persönliche Angelegenheiten abzuwickeln und sich von Freunden und Kollegen zu verabschieden. Derweil erteilte er Olga weiter per Brief ärztliche Ratschläge und erinnerte sie daran, ihre Medikamente zu nehmen. Sie solle sich vor Koliken oder Appetitverlust hüten und ihm immer genau berichten, »wie es mit Deinem Appetit und Deinen Kräften steht«. Auch das Verhalten seiner jüngeren Schwester Julie bereitete ihm Sorgen. Diese hatte sich offenbar zu etwas hinreißen lassen – das Helmholtz nicht näher beschreibt –, was in seinen Augen ihren guten Ruf gefährden würde, wenn es bekannt würde. Er war wütend und schämte sich für sie. Geplant war, dass er am 29. Juli von Königsberg nach Berlin und Dahlem aufbrechen, seine Familie besuchen und dann nach Bonn weiterfahren würde, um dort eine Wohnung zu suchen und sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.49
Fast zwei Wochen nahm er sich Zeit für den Abschied von Freunden und Kollegen. In der zweiten Julihälfte vereinbarte er sage und schreibe 60 persönliche Abschiedsbesuche. Am Nachmittag des 18. Juli gaben 37 seiner Kollegen und Freunde ihm ein »großes Abschiedsdiner im Börsengarten« mit musikalischer Begleitung. Die meisten Gäste waren Fakultätsmitglieder (über die Hälfte des gesamten universitären Lehrkörpers war anwesend), einige wenige offizielle Vertreter der Universität oder klinische Ärzte. Alle zahlten zwei Taler für die Veranstaltung – »Ich natürlich frei«, frohlockte Helmholtz typischerweise in seinem Brief an Olga. Er saß zwischen dem Universitätskurator, Seiner Exzellenz Franz Eichmann, und Eduard von Simon, dem Rechtsprofessor. Eichmann brachte einen Toast auf den König aus, Simson einen auf Helmholtz. »Abgesehen von den unendlichen Schmeicheleien war die Rede sehr schön, herzlich und ergreifend«, schrieb Helmholtz an seine Frau. »Daß ich selbst etwas dadurch ergriffen war, war wohl natürlich, aber auch unter den anderen, wie sie zu mir herankamen um anzustoßen waren einige thränenschwere Blicke, Rathke, [Justus] Olshausen, Wittich, [und] Richelot waren darunter.« Ebenso Neumann und Moser. Nach dem Dessert brachte Helmholtz einen Toast auf die Bürger Königsbergs und die Professoren der Albertina aus: »Ich sage es gern, dass ich in diesen Mauern schöne, an Erhebungen des Geistes und des Herzens reiche Jahre verlebt habe, dass ich hier einen Kreis von Amtsgenossen gefunden habe, der keiner anderen deutschen Universität an Reichthum des Wissens und geistiger Schöpfungskraft nachsteht, der vielleicht allen deutschen Universitäten voransteht durch ungestörte Eintracht des collegialischen Verhältnisses, durch die uneigennützige Anerkennung der Verdienste, durch die bereitwilligste Unterstützung der Arbeiten jedes Genossen.« Von Preußens nordöstlichster Ecke breche er in den fernen Westen auf, werde aber nie die »besonnenen und wackeren Bewohner« Königsbergs vergessen. Er hoffe, auch seine Kollegen würden sich seiner erinnern oder ihn besuchen, er jedenfalls trage Königsberg im Herzen. Die Universität der Stadt lobte er für ihre »ernste, strenge« und sogar »hervorragend protestative Wissenschaftlichkeit«. Alles in allem steckte in seinen salbungsvollen Worten wohl ebenso viel Wahrheit wie diplomatische Freundlichkeit und professionelle Höflichkeit. In jedem Fall, so schrieb er an Olga, war es »ein sehr animirtes Fest, und die Leute außerordentlich herzlich gegen mich« gewesen. Abends besuchten er und Adolf Sotteck seine guten Freunde, die Olshausens.50
Den Abend des 20. Juli verbrachte er bei den Richelots und genoss, wie Frau Richelot aus Beethovens Liedern sang – ob auch Olga nach ihrer Behandlung wieder etwas daraus zu Gehör bringen würde? Am nächsten Morgen absolvierte er über 15 Abschiedsbesuche und verbrachte auch die folgenden Tage mit noch mehr Besuchen und Kistenpacken. Am 26. war er mit seinen Besuchen durch. Olga ging es besser, aber Helmholtz ärgerte sich, dass er ihre Diät nicht besser kontrollieren konnte. Sie hatte Bohnen gegessen, die für sie doch schwer verdaulich seien. Ihr Schnupfen bereitete ihm weniger Sorgen, als dass sie Zug abbekommen könnte.51
An Helmholtz’ letztem Tag in Königsberg (28. Juli) gab es für ihn eine Abschiedsparty. Die Ostpreußische Zeitung wusste zu berichten, wie sehr ihn seine Universitätskollegen und Studenten schätzten und verehrten – charmant und bescheiden, wie er sei. Weiter heißt es, dass Helmholtz sich nicht nur in der Physiologie, sondern auch in der praktischen Medizin einen Namen gemacht und sogar den König persönlich kennengelernt habe. (Als jener das letzte Mal die Stadt besucht hatte, hatte er alle Fakultätsmitglieder getroffen, auch Helmholtz, damals Dekan der medizinischen Fakultät und daher im offiziellen roten Dekansgewand. Bei dieser Gelegenheit scherzte der König Helmholtz gegenüber, dass das nicht notwendig gewesen wäre, er hätte ihn auch ohne Mantel erkannt.) Kurz bevor Helmholtz an diesem Abend mit Wittich – seinem Freund, Kollegen und nun auch Nachfolger – in den Zug nach Berlin steigen wollte, überreichte ihm die medizinische Fakultät eine silberne Tafel, auf der die Namen aller Fakultätsmitglieder geschrieben standen. Seine Studenten, die wussten, wie sehr er die Kunst liebte, schenkten ihm mehrere Kupferstiche mit berühmten Zeichnungen Raffaels sowie ein Bild des gerade fertiggestellten anatomischen Museums. Wittich und er würden am nächsten Abend um 21 Uhr 15 in Berlin ankommen.52 Königsberg sollte Helmholtz nie wiedersehen.