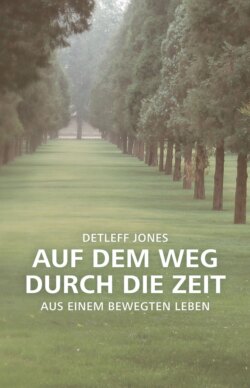Читать книгу Auf dem Weg durch die Zeit - Detleff Jones - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erste Reise
ОглавлениеAn einem frühen Herbsttag des Jahres 1952 - ich war knapp 3 Jahre alt - zogen wir von Schloss Georghausen, wo ich geboren bin, zurück nach Köln. Dieser Umzug ist mir als meine früheste Erinnerung geblieben. Meine Eltern hatten von der Stadt Köln eine Wohnung in diesem normannischen Wasserschloss im Bergischen Land östlich von Köln zugewiesen bekommen, da das Elternhaus meiner Mutter in der Richard – Wagner Straße am Rudolfplatz ausgebombt und nicht mehr bewohnbar war. Meine Oma – Mutter meiner Mutter – wohnte bis zu ihrem Tod 1974 bei uns; ihr Mann – mein Großvater – war in den letzten Kriegstagen einem Herzinfarkt erlegen, und meine Eltern hatten sie aufgenommen. Es gab ohnehin im fast völlig zerstörten Köln kaum Wohnraum. Unsere Schlosswohnung war allerdings alles andere als „schlossmäßig“ – wir lebten im Gesindehaus hinter meterdicken Mauern, an denen im Winter Eiskristalle wuchsen und mit einem Ofen in nur einem von den beiden winzigen Räumen. Das Gesindehaus umgab in einem großen Quadrat den Schlosshof mit seinem Wassergraben. Im Schloss selbst lebte ein Graf, der keinerlei Kontakt zu den Menschen pflegte, die von der Stadt in seinem Schloss einquartiert wurden. Nur seinen großen Pyrenäenhund schickte er manchmal hinunter in den Hof, und der verbellte dann jeden, der ihm und dem Hauptgebäude zu nahekam. Aber immerhin schaffte ich es dann doch noch, meine ersten Schritte in diesem Schlosshof zu machen – woran meine Mutter schon nicht mehr geglaubt hatte. Ich war nämlich ein ziemlicher Spätzünder, denn ich hatte noch mit 1 ½ Jahren oft in Tagträumen im Kinderwagen gelegen und die Hände langsam vor meinem Gesicht bewegt, so dass mein Onkel, der Zwillingsbruder meiner Mutter, immer behauptete, seine beiden Jungs hätten in meinem Alter schon auf dem Fußballplatz gestanden!
Unser Umzug war recht bescheiden – mein Vater hob mich in den vollbeladenen Tempo und setzte mich zwischen den Fahrer und meine Schwester. Ich erinnere mich noch gut an die Fahrt im zugigen Führerhaus von Georghausen nach Köln - Dünnwald, während meine Eltern mit meiner Oma hinten auf der Ladefläche saßen – mit all unserem Hab und Gut – und wenn man sich heute einmal einen Tempo ansieht, dann wird klar, dass es nicht viel gewesen sein kann, was da umgezogen werden musste. Unsere neue Wohnung lag an der Odenthaler Straße, am östlichen Stadtrand von Köln – zwar nicht in der Stadtmitte, wohin meine Mutter am liebsten gezogen wäre – aber immerhin noch so gerade innerhalb der Grenzen des Stadtgebietes von Köln in einem Anbau neben dem Hardthof, einem damals recht beliebten Ausflugslokal mit Hotel. Es gab einen langen Flur, von dem jeweils 3 Zimmer nach rechts gingen und 3 nach links. Mein Zimmer war das mittlere auf der linken – der Straßenseite. Das heißt – es war nicht nur mein Zimmer, sondern auch das Arbeitszimmer meines Vaters und später auch das Esszimmer, wenn Besuch sich angesagt hatte, und wenn es sich ergab, spielten wir in späteren Jahren auf dem Ausziehtisch in diesem Zimmer auch Tischtennis.
In der Mitte rechts befand sich das Badezimmer. Freitag war Kinderbadetag, dann wurde der große kupferne Boiler mit Briketts so lange beheizt, bis eine entsprechende Wassermenge die nötige Temperatur erreicht hatte. Es ging nach Alter - meine Schwester durfte immer als erste in die Wanne, nach ihr durfte ich baden. Und wenn das Wasser dann abgelassen wurde, blieb am Rand der Wanne meist eine breite Schmutzschicht, die ich dann mit Putz- und Scheuermitteln zu entfernen hatte.
Über die gesamte Wohnung erstreckte sich der Dachboden mit offenen Holzbalken, in den man über eine Falltreppe in der Decke des Wohnungsflurs gelangte. Dieser Dachboden sollte später eines meiner Rückzugsgebiete werden – dort baute ich mir in den kommenden Jahren einen eigenen Flugplatz, den ich mit selbstgebastelten Abfertigungshallen bestückte, alle auf einer großen Holzplatte aufgebaut. Ich malte mir eine Landebahn darauf – vielleicht waren es auch zwei. Jeder Junge schien damals eine elektrische Eisenbahn zu haben, und wenn wir sonntags die Familie des Zwillingsbruders meiner Mutter in der Siebachstraße in Köln-Nippes besuchten, spielten wir auch immer mit der Eisenbahn meiner beiden Cousins Franz und Barry. Aber mich interessierten Eisenbahnen eigentlich nur am Rande; mein Interesse lag eher in der Luft. Fliegen – das war immer eine meiner großen Leidenschaften, und schon als kleiner Junge konnte es mir passieren, dass ich mir den Kopf an einer Laterne anschlug, weil ich wieder einmal einem Flugzeug hinterhergeschaut hatte! Diese Leidenschaft hat mich übrigens nie losgelassen, und noch heute, nach zahllosen Fernreisen, die ich aus beruflichen Gründen immer wieder unternehme, besteige ich ein Flugzeug stets mit der Vorfreude aufs Fliegen! Die Beschleunigung beim Start zu erleben und wie die Erde dann unter mir zurückbleibt, während sich das Flugzeug über alle Kräfte am Boden hinwegzusetzen scheint – das fasziniert mich bis auf den heutigen Tag.
Hinter dem Haus erstreckten sich weite Wiesen, die an einen Wald grenzten, und auf der Vorderseite lag auf der anderen Straßenseite ebenfalls ein ausgedehnter Wald, der in den folgenden Jahren mein Spielplatz werden sollte. Hinter dem Haus gab es Pferdeställe, in denen verschiedene Reiter ihre Pferde zur Miete unterstellten. Vor dem Haus war eine Bushaltestelle, und man konnte mit der Wupper – Sieg – Linie in ihren crème-roten Bussen bis zum Busbahnhof hinter dem Dom in Köln fahren, was etwa eine halbe Stunde dauerte und rund eine Mark kostete.
Bei unserem gesamten Besitzstand handelte es sich um das Ehebett meiner Eltern, einen Wohnzimmerschrank mit zwei Glastüren – ein Hochzeitsgeschenk an meine Eltern und ihr ganzer Stolz („echt kaukasischer Nussbaum!“), einen Küchentisch mit 4 Stühlen und für meine Schwester und mich je eine Matratze und – nicht zu vergessen – die Möbel meiner Großmutter, ein altes Eichenbett und einen Schrank mit geschnitzten Rosetten, über die wir Kinder manchmal auf den Schrank hochkletterten, um von seinem Deckel in Omas Bett zu springen, das irgendwann natürlich die Sprünge nicht mehr aushielt und einkrachte.
Meine Oma hatte ursprünglich 8 Geschwister, von denen damals noch 5 lebten. Zwei ihrer Brüder waren im Krieg gefallen und ein dritter - Spätheimkehrer, der erst auf Adenauers Intervention zu Beginn der 50er Jahre nach Hause kommen konnte, verunglückte auf dem Weg in die Heimat tödlich. Die Geschwister hatten bis auf meine Oma, die als Haushälterin in Köln arbeitete und dort ihren späteren Mann kennenlernte, ihre Heimat nie verlassen und wohnten alle in kleinen Eifeldörfern in der Umgebung von Bitburg, wohin mich Oma immer mitnahm, wenn sie im Sommer ihre Verwandten dort besuchte. Diese Aufenthalte dauerten in der Regel sechs Wochen – die Dauer der gesamten Sommerferien, wenn ich auch damals noch nicht zur Schule ging. Wir wohnten dann gewöhnlich bei meiner Großtante Nini in Messerich. Sie war zwar die Schwester meiner Oma, wurde aber von allen „Tante Nini“ genannt. Ihr Mann, Onkel Nikla, war bei der Bahn gewesen und hatte daher Dauerwohnrecht in einem kleinen Haus mit einem Zwiebelturm direkt an einer Bahnlinie, die aber nur noch sehr selten befahren wurde. Im Garten wuchsen Gemüse und bunte Blumen, und im hinteren Eck wucherte ein großer Holunderbusch, der im Sommer Schatten spendete. Vor dem Busch stand eine alte Holzbank, auf der meine Tante und Oma oft den späten Nachmittag oder Abend in den letzten Sonnenstrahlen der untergehenden Sonne verbrachten. Tante Nini liebte Kinder über alles. Sie war die freundlichste und liebste Tante, die man sich vorstellen kann, und so manches Mal beschützte sie mich vor den Ohrfeigen meiner Oma, wenn ich über die Stränge geschlagen hatte. Immer nahm sie mich in Schutz, wenn ich mal wieder nicht fertig wurde mit Essen – ich muss für meine Eltern eine ziemliche Herausforderung gewesen sein, was mein Essenstempo anging. Und auch sonst hörte ich sehr häufig die vage Warnung „warte nur, bis du zum Militär kommst, dann wirst du Gas geben müssen!“ Nur Tante Nini war einfach immer solidarisch mit mir – sie war für mich so sicher wie eine Bank und dabei stets gutgelaunt. Im Gegensatz zu Oma war sie auch keineswegs so bigott und kirchentreu. Das Tischgebet sprach sie, während sie auftischte und mit Schüsseln und Platten, die sie auftrug, zwischen Küche und Esstisch hin- und herlief. Und dabei vernuschelte sie immer einen Teil des Gebets, das aber stets mit „guten Appetit“ endete. Und überhaupt – die Kirche: In Messerich wie auch in anderen Eifeldörfern hatten die Priester offenbar eine gewaltige Machtposition inne – denn wie sie sich mitunter aufführten, das war schon erstaunlich! In späteren Jahren, als ich für alt genug befunden wurde, am sonntäglichen Gottesdienst teilzunehmen, sah ich dort mit eigenen Augen, wie der Priester sich während der Messe zu einem seiner Messdiener umsah und ihn ermahnte. Und als die Ermahnung offenbar nicht zum gewünschten Erfolg führte, drehte sich der Priester wieder zu seinem Ministranten, lief zu ihm und ohrfeigte ihn. Oder aber er verteufelte von der Kanzel während seiner Predigt einzelne Nicht – Kirchgänger, deren Fehlen ihm beim Sonntagsgottesdienst offenbar aufgefallen war! Ich kann nicht sagen, dass diese frühkindlichen Erfahrungen mit der Kirche mich in besonderem Maße für sie eingenommen haben – obwohl ich viele Jahre später noch Kontakte haben sollte, die mich ziemlich nah an das konservative Herz dieser Kirche heranbrachten, aber davon wird noch zu erzählen sein.
Meine Ferien in der Eifel waren für mich immer ein Höhepunkt des Jahres – und die Eifel wurde mir zur gefühlten 2. Heimat. Dort hatte ich Freunde, die mir in Köln fehlten, da wir ziemlich weit ab vom Schuss wohnten, und die ersten Gleichaltrigen, mit denen ich es zu Hause in Köln zu tun bekam, waren meine Mitschüler im ersten Volksschuljahr 1956. Dank Tante Nini musste ich während der Ferien in der Eifel auch nicht immer schon um 20 Uhr ins Bett, sondern wir spielten draußen auf der Straße, rollten in Leiterwagen den Hügel von der Eisenbahnbrücke hinab, sahen den Söhnen der benachbarten Gaststätte Leisen zu, wie sie auf einer Wiese Regenwürmer sammelten und den einen oder anderen zu unserer Gaudi verspeisten und dadurch natürlich enorm in unserer Hochachtung stiegen! Wir waren immer um die 4 oder 5 Kinder, einer von uns war Leo, ein behinderter Mann von etwa 25 Jahren mit dem Gemüt eines Vierjährigen, der mich aus heutiger Sicht an Obelix erinnert – zumindest hatte er dessen Leibesumfang. Leo war geradezu gierig auf „Gutsjer“ – Bonbons, und sie hatten seinen Zähnen offenbar schon seit langem zugesetzt, denn ihm waren nur noch einige wenige halbverfaulte Stummel geblieben. Und er war stets der erste, der abends nach Hause und ins Bett musste. Wir blieben oft noch bis nach Sonnenuntergang draußen. Montag war immer ein besonderer Abend, denn dann passierte gegen 19 Uhr ein langer Güterzug das Haus. Wir Kinder hielten schon Minuten vorher nach ihm Ausschau, und auf den Ruf „er kommt“, rannten wir auf die Brücke und ließen den stampfenden Zug unter uns hindurchdonnern. Eine Dampflok zog ihn, so dass wir immer eine Zeitlang im Dampf der ausgestoßenen Wolken standen, bevor wir anfangen konnten, die Waggons, deren Räder auf den Schienen sangen, zu zählen. Dort in der Eifel hatte ich auch meine ersten Kontakte zu Tieren und zur Landwirtschaft, wenn man einmal von unserem Foxterrier „Bobby“ absieht, den wir in Schloss Georghausen gehabt hatten und den meine Mutter irgendwann an Freunde verschenkt hatte – aber daran erinnere ich mich nur aus Erzählungen. In der Eifel gab es immer jemanden – meist Verwandte – die „Vieh“ hatten – in der Regel zwei oder drei Kühe und ein paar Schweine und natürlich Hühner. Manchmal schickte man mich nach draußen in den Hühnerstall, um die frischen Eier aus den Nestern zu holen. Ich bilde mir ein, dass mir Eier niemals besser geschmeckt haben als dort! Und wenn wir etwa nach Edingen kamen, an der Luxemburger Grenze gelegen – an den „Edinger Berg“, wo Tante Traudchen lebte, eine weitere Schwester meiner Oma, dann führte mein erster Weg immer in den Kuhstall, denn dort waberte der für mich damals betörendste Duft der Welt – nämlich der von Kühen, frischer Milch, von Wiesen und Natur – Landluft halt, und die Begeisterung für diesen Odeur hat mich bis heute nicht losgelassen! Auch heute noch werden für mich beim Duft nach Jauche oder Kühen sofort Erinnerungen an meine Kindheit in der Eifel wach.
Um in die Eifel zu kommen, fuhren wir mit dem Zug von Köln nach Erdorf, wo uns Tante Ninis Sohn Walter mit seinem Goggomobil abholte. Ich weiß bis heute nicht, wie Walter es schaffte, meine Oma in dieses Auto zu bugsieren, denn sie war eine ziemlich korpulente Frau – und dazu noch unser Gepäck, das hochkant auf dem Rücksitz Platz fand und mit mir in der Mitte. In späteren Jahren, als mein Vater sein erstes Auto gekauft hatte, einen schilfgrünen VW Käfer, kamen meine Eltern normalerweise gegen Ferienende nach Messerich, um uns abzuholen. Unser VW kam mir dann immer riesig vor im Vergleich zum Goggo – und das war er wohl auch.
Eine der Bahnfahrten in die Eifel ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Es war an einem heißen Sommertag. Wir fuhren natürlich zweiter Klasse, in der man auf Holzbänken saß (daher „Holzklasse“!), und durch die heruntergeschobenen Fenster drang die warme sommerliche Luft. Ich saß neben meiner Mutter mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Uns gegenüber saß ein Herr mittleren Alters in einem dunkelblauen Anzug, weißem Hemd und passender Krawatte. Ich hatte Keuchhusten, und zwischen zwei Hustenanfällen wollte ich unbedingt einmal aus dem Fenster spucken und bat meine Mutter – immerhin! – um Erlaubnis. Natürlich ließ sie das nicht zu. Aber ich muss wohl so gedrängt haben, dass sie ihrem kranken Sohn irgendwann nachgab, und so stellte ich mich ans Fenster und spuckte aus Leibeskräften nach draußen. Leider reichten diese jedoch nicht aus, einen dicken Batzen Schleim durch den Fahrtwind hindurch nach draußen zu befördern, denn er kam auf gleichem Weg durchs Fenster wieder hereingeflogen und landete auf dem makellosen Revers unseres Mitfahrers. Entweder war es blankes Entsetzen oder eine Art Schockstarre, in die der Mann verfiel. Aber er rührte keine Miene. Meine entsetzte Mutter versuchte sogleich, den Schaden mit einem Taschentuch zu beheben, was ihr mehr schlecht als recht gelang. Zum Glück war es nicht mehr weit bis nach Erdorf, wo wir endlich aussteigen und dieser peinlichen Situation entkommen konnten. Da ich damals auch zu keiner Entschuldigung mehr zu bewegen war, möchte ich mich jetzt (better late than never!) hier in aller Form bei diesem Herrn entschuldigen; wenn er noch unter uns weilen sollte, erinnert er sich vielleicht noch an den Bengel, der ihm seinen Anzug vollgerotzt hat!
Meine Aufenthalte in der Eifel waren durchaus prägend, weil sie auch eine Zeit völliger Unbekümmertheit waren – eine Zeit, in der ich die Schule ja noch vor mir hatte und damit alle ernster werdenden Aufgaben, die sich mir stellen sollten. Hinzu kam, dass es Ferienzeiten waren, losgelöst vom Kölner Alltag – jeder Tag war dort besonders, die Menschen und der Eifeler Dialekt, den ich noch heute für mein Leben gern höre, das Essen, die Luft und die Landschaft.
Doch auch aus dieser Zeit völliger Unbekümmertheit ist mir ein Erlebnis in Erinnerung, das mich noch heute schaudern lässt. Wir – meine Oma und ich - waren zu Besuch bei einem nahen Verwandten - nennen wir ihn hier Manfred - der aber schon seit vielen Jahren nicht mehr lebt. Im Haus war Jirina, eine polnische Haushaltshilfe beschäftigt, ein hübsches junges Mädchen von vielleicht 15 oder 16 Jahren, die sich auch um mich kümmerte und mit mir – einem damals vielleicht 5-jährigen Jungen spielte. An einem heißen Sommernachmittag spielten das polnische Mädchen und ich vor der Tür und direkt neben dem Misthaufen mit einem Ball, als Manfred, damals etwa Mitte dreißig, aus dem Haus trat. Er trug seine blaue Arbeitshose und ein Unterhemd. Er sah uns eine kurze Weile zu, dann schrie er das Mädchen an – sie solle sofort zu ihm kommen. Jirina kauerte sich darauf auf den Boden und wimmerte nur – offenbar vor Angst. Da öffnete Manfred seinen Gürtel und zog ihn aus den Hosenschlaufen, während er langsam und bedrohlich auf uns zukam. Auch mich befiel nun eine tiefgründige Angst, obwohl ich eigentlich nicht wusste, wovor oder warum ich Angst haben sollte – aber diese Situation war plötzlich äußerst unheimlich. Manfred trat zu uns, sagte zu mir „nein – nicht du“ und griff nach Jirinas Arm. Sie wimmerte laut vor Angst, doch Manfred zog sie hinter sich her und verschwand mit ihr in der Scheune. Ich wagte es nicht, den beiden hinterherzulaufen und versteckte mich im Haus, bis meine Oma abends von einem Ausflug wieder zurückkam und somit wieder Normalität einkehrte. Wir reisten am nächsten Morgen ab, und ich weiß nicht, was aus Jirina geworden ist. Damals habe ich diesen Vorfall offenbar verdrängt. Doch in all den langen Jahren habe ich ihn nicht vergessen – er hat sich also ziemlich tief in meinen Erinnerungen eingenistet. Ganz offenbar war ich Zeuge geworden eines Aktes des Missbrauchs, und wer weiß heute schon noch, in welchen Ausmaßen diese Verbrechen auch damals gerade auf dem Land stattgefunden haben - ohne, dass sie jemals ans Licht der Öffentlichkeit gelangt wären!
In den folgenden Jahren verbrachte ich immer wieder mit meiner Oma ein paar Tage bei dieser Familie, und ich fuhr seit dem beschriebenen Vorfall nie mehr mit meiner kindlichen Unbekümmertheit dorthin. Meine Gefühle waren vielmehr ambivalent – auf der einen Seite gab es dort Kühe und Schweine und Hühner, Hunde und Katzen, und Manfred war zu mir immer die Freundlichkeit in Person. Aber auf Haus und Hof lastete aus meiner Sicht ein bedrohlicher Schatten, den ich nie mehr verdrängen konnte.
Die Eifel ist eine rauhe Gegend mit einem rustikalen Charme, und nirgendwo habe ich je freundlichere und offenere Herzen kennengelernt. Die Menschen dort lebten früher alle einmal von der Landwirtschaft – bis die zunehmende Industrialisierung – der Ausbau der Bahn und in Bitburg vor allem die Brauerei – neue Ausbildungen anbot und somit einen Ausweg aus der harten Landarbeit. Gerade die Bitburger Brauerei avancierte zu einem der größten, wenn nicht zum größten Arbeitgeber in der Region, und es gab kaum eine Familie, die nicht einen Sohn oder eine Tochter dort unterbrachten. Arbeitete man nicht in der Brauerei, dann vielleicht bei den Amerikanern, die auch heute noch in Bitburg eine große Air Base unterhalten. Insofern wandelte sich ab 1945 das Leben der Menschen in dieser Gegend sehr stark, und eine neue Mittelschicht entstand, man baute sich schmucke Häuser, während die alten Gehöfte zunehmend verfielen – eine neue Zeit löste die alte ab. Ich fuhr als Kind oft so nah wie möglich an den Flughafen, um die dicht über meinen Kopf hinweg startenden Düsenjäger zu beobachten. Das Donnern ihrer Nachbrenner ließ die Luft vibrieren, und ich sah ihnen fasziniert hinterher, bis sie als winziger flammender Punkt vom Himmel verschluckt wurden.
In Köln wohnten wir damals überaus bescheiden. Unseren Hausstand habe ich ja bereits beschrieben. Doch hatte uns mein Vater immer versprochen, dass es uns bald besser gehen würde. Er hatte Träume und Visionen von Wohlstand und wirtschaftlicher Sicherheit – ja, wir würden vielleicht sogar eines Tages ein Telefon haben – und das war für Mama damals noch vollkommen unvorstellbar. Aber mit der Zeit ging es tatsächlich aufwärts, und es kamen dann andere Dinge hinzu wie eine Wohnzimmercouch und zwei Sessel, mein Vater bekam einen Schreibtisch und ich ein Wandbett, das neben dem Schreibtisch meines Vaters stand und tagsüber hochgeklappt und mit einem Vorhang mehr oder weniger unsichtbar gemacht wurde. Im selben Zimmer stand auch unser Esstisch, ein Ausziehtisch für ca. 10 Personen und eine weitere Schlafcouch. Mein Zimmer war also gleichzeitig Büro, Ess- und Gästezimmer. Mamas Zwillingsbruder Onkel Hans hatte die Wohnung tapeziert und gestrichen, und überhaupt war er immer derjenige, der bei handwerklichen Problemen zur Stelle war und aushalf. Er war Schreibmaschinenmechaniker und schleppte auch nach Arbeitsschluss noch ein paar Schreibmaschinen zu sich nach Hause, wo er sie bis tief in die Nacht zerlegte, reinigte und reparierte. Onkel Hans und seine Frau Christel hatten zwei Söhne, Franz und Barry, und wir sahen sie in der Regel an den Wochenenden, wenn sie uns besuchten oder wir sie. Ihre erste Wohnung nach Kriegsende war in der Siebachstraße in Köln Nippes, wo sie in zwei Zimmern wohnten – einer Wohnküche und einem gemeinsamen Schlafzimmer. In Ermangelung eines Badezimmers wusch man sich in der Küche; die Toilette war auf dem Hausflur und wurde von allen Bewohnern des Hauses benutzt, und das waren drei weitere Familien. Es gab einen langen, schmalen Hinterhof, in dem wir Jungs Fußball spielten, wobei oft die eine oder andere Fensterscheibe zu Bruch ging, was fast immer mit Prügel von Onkel Hans geahndet wurde. Aber ich möchte ihn keineswegs als üblen Prügler bezeichnen – er war nämlich das genaue Gegenteil, ein herzensguter, immer hilfsbereiter Mann mit einem unglaublichen sonnigen Humor, eine echte kölsche Seele von einem Mann, den wir über alles liebten. In den meisten Familien wurden Kinder mit Schlägen bestraft, und wenn ich auch nicht der Meinung bin: ‚Was uns nicht geschadet hat, das schadet auch nicht meinen Kindern‘ – so waren die Prügelstrafe oder eine Ohrfeige damals nicht unüblich. Man mag sich das aus heutiger Sicht nur nicht mehr vorstellen! Ich hingegen hatte das Glück, einen Vater mit pazifistischem Hintergrund zu haben, dem Gewalt völlig fremd war und der mich nie auch nur ein einziges Mal geschlagen hätte. Von meiner Mutter mag ich die eine oder andere Ohrfeige bekommen haben – jedoch erinnere ich mich nicht mehr daran, was mir sagt, dass dies unbedeutende Ausrutscher waren, für die ich – sollten sie stattgefunden haben – sehr wahrscheinlich einen ausreichenden Grund gegeben hatte!
Wenn wir Onkel Hans und Familie in der Stadt besuchten, was meist jeden zweiten Sonntag geschah, spielten wir Kinder auch oft auf den umliegenden Trümmergrundstücken. Wohlgemerkt – das Kriegsende lag da gerade mal ein paar Jahre zurück, die meisten deutschen Innenstädte waren von den alliierten Bombern dem Boden gleichgemacht worden, und Köln hatte es besonders schlimm getroffen. In der Nacht zum 31. Mai 1942 hatten 1000 Bomber der Alliierten im bisher größten Luftangriff der Geschichte die Stadt angegriffen und sie in Schutt und Asche gelegt, und bei Kriegsende waren weit über 90 % der Stadt vollkommen zerstört. Nippes war bis auf wenige Häuser völlig platt. Ich erinnere mich gut an die freie Sicht zwischen Riehler und Neusser Straße – weil kein einziges Haus mehr stand. Und von der Florastraße aus konnte man auch immer wieder den Dom sehen – was heute schlicht unmöglich ist. Wir verkrochen uns in ausgebombten Häusern und hohlen Kellern, wippten auf Betonplatten, die wie schlechte Zähne schräg in den Himmel ragten, suchten nach Hausrat und allem Möglichen, was uns interessant erschien – ein ungeheurer, allerdings auch recht gefährlicher Abenteuerspielplatz, der natürlich im Laufe der folgenden Jahre kontinuierlich geräumt und wieder bebaut wurde.
Irgendwann schenkte uns ein Kollege meines Vaters, der nach Afrika versetzt wurde, ein Klavier. Es war ein uraltes Hochklavier, das im Wohnzimmer Platz fand, und meine Mutter, die als einzige in unserer Familie damals Klavier spielen konnte, setzte sich oft nachmittags hin und spielte ihre Standardwerke, die bis zu ihrem Lebensende viele Jahre später nie variierten: eine Etude von Chopin, eine andere von Mozart und dann vielleicht noch einige wenige klassische Klavierstücke. 1954, da war ich vier Jahre alt, bekam meine Schwester, die damals acht war, erste Klavierstunden. Sie musste jeden Tag eine halbe Stunde üben, erste Fingerläufe und Sonaten und kleinere Melodien. Das früheste Stück, an das ich mich erinnere, war der „Fröhliche Landmann“ von Schubert. Wenn Sylvia fertig war mit Üben, setzte ich mich gleich auf den noch warmen Klavierstuhl und versuchte nachzuspielen, was ich eben gehört hatte. Und das schien mir ziemlich schnell zu gelingen, denn bald spielte ich dieses Stück nach Gehör besser als meine Schwester nach Noten. Nicht nur das – ich modulierte es auch von Dur nach Moll und wieder zurück. Wie Mütter so sind – dachte Mama offenbar, ich sei mit einem für mein Alter ungewöhnlichen Talent gesegnet und schleppte mich bei nächster Gelegenheit mit zur Klavierlehrerin, um mich ebenfalls zum Unterricht anzumelden. Fräulein Odenthal hieß die Lehrerin, eine ebenso nette wie hübsche junge Dame. Und Fräulein Odenthal wimmelte meine Mutter erst einmal ab. Ich könne doch nicht einmal lesen und schreiben und daher auch keine Noten lesen, und ich solle doch erst einmal ein oder zwei Jahre auf die Schule gehen, dann könne man gerne weitersehen. Doch Mama ließ nicht locker und schlug vor, dass ich etwas vorspielte. Die Lehrerin willigte schließlich ein, und ich setzte mich an dieses schwarze Monstrum von Bechstein Flügel und spielte – den „Fröhlichen Landmann“ – natürlich ohne Noten, denn ich konnte Noten ja nicht lesen. Fräulein Odenthal wurde sehr ernst und still, und Mama bat mich triumphierend, das Stück jetzt in Moll zu spielen, was ich ohne weiteres hinbekam – den Schluss allerdings spielte ich wieder in Dur – ich war ja positiv gestimmt! Und als ich fertig gespielt hatte, drehte ich mich zu Fräulein Odenthal, die völlig regungslos und in Tränen aufgelöst neben meiner Mutter saß. Mit einer Entschuldigung wischte sie ihre Tränen weg und meinte, dass ich selbstverständlich Klavierunterricht bekäme – und zwar ab sofort. Fortan gehörte der Mittwochnachmittag der Musik, um 15 Uhr Klavierstunde, erst eine halbe Stunde, doch schon bald jeweils eine ganze. Und jeden Tag war eine halbe Stunde Klavierspielen angesagt – ich musste „üben“, aber damals machte mir das noch einen Riesenspaß.
In den Monaten und Jahren danach folgten diverse Vorspielabende, bei denen ich stets der Kleinste und Jüngste war und schon allein dadurch fast immer den größten Applaus einheimste. Doch vor jedem dieser Abende quälte mich starkes Lampenfieber, und ich war entsetzlich aufgeregt und nervös. Einmal spielten wir – also alle Schüler von Fräulein Odenthal und später auch die ihres Mannes Gerold Kürten – in einer Festhalle in Köln Mülheim. Ich sollte einen Boogie Woogie spielen und dabei vom Kölner Jugendorchester „La Volta“ begleitet werden, das auf der Bühne spielte. Von meinem Klavier, das vor der Bühne stand, konnte ich das Orchester nicht sehen – ich konnte es lediglich hören. Vom Bühnenausgang zum Klavier waren es nur ein paar Meter. Und kurz vor meinem Auftritt stand ich allein vor der Tür, die nach draußen zu meinem Klavier führte, mit rasendem Herzen, schweißnassen Händen und weichen Knien. Ich betete, dass alles gut gehen möge. Dann bekam ich ein Zeichen, ging hinaus, und als das Publikum mich sah – diesen kleinen Knirps, der jetzt einen Boogie spielen sollte, war der Applaus schon groß! Es lief dann perfekt, aber ich werde vor allem nie diese Angstmomente vergessen, die mich fast lähmten.
Erster Schultag und der sogenannte Ernst des Lebens – wir waren mehr als 60 Kinder. Man saß an Doppelpulten – jeweils zwei Kinder nebeneinander. Links eine Pultreihe mit Mädchen, die bei uns Jungs nur „die Weiber“ hießen, in der Mitte und rechts die Jungen. Meine Schultüte war fast so groß wie ich, aber besonders ist mir meine Hose in Erinnerung. Denn die hatte Oma in hellgrauer Wolle gestrickt – und zwar auf Zuwachs, denn sie reichte bis kurz unter die Arme! Ich glaube nicht, dass ich wegen dieser Hose gehänselt wurde – zumindest nicht am ersten Schultag, an dem ja auch die Eltern anwesend waren – da hätte niemand gewagt, Hänseleien an den Mann oder das Kind zu bringen! Später irgendwann trug ich allerdings auch einmal einen gestrickten Outfit – wieder von Oma gestrickt, eine sehr knappe weiße Hose und ein passendes Jäckchen, und da wurde mir dann doch ziemlich übel mitgespielt. Ältere Jungs drohten mir Prügel an und versuchten mich lächerlich zu machen, was ihnen bei meinem Aufzug natürlich ziemlich leicht fiel. Und nach Schulschluss rettete ich mich nur durch einen Dauerlauf vor den Aggressionen meiner Mitschüler.
In der Volksschule Leuchterstraße und mit mehr als 60 Kindern in einer Klasse war das soziale Gefälle ziemlich groß. Von einem Jungen hieß es, er sei ein „Plutenkind“, was so viel heißt wie Lumpenkind. Er hatte sieben oder acht Geschwister und kam aus schwierigen sozialen Verhältnissen, der Vater im Gefängnis und die Mutter Trinkerin. Die Bezeichnung „Pluten“ (kölsch für Lumpen) bezog sich allerdings weniger auf seine Herkunft als auf seine Kleidung. Wohl auch aus diesem Grund wurde dieses Kind ausgegrenzt und musste die Schule bald verlassen. Ein anderer Junge bekam vor versammelter Klasse jede Woche mindestens eine Tracht Prügel. Bei dieser Strafe musste er sich über das Pult legen und der Lehrer – ein Stellvertreter unserer geliebten Lehrerin Fräulein Vogt – prügelte mit einem Rohrstock auf seinen Hintern ein, von den Staubwolken in die schräg einfallenden Sonnenstrahlen stoben. Körperliche Züchtigungen waren an der Tagesordnung – weniger bei den Lehrerinnen als bei den Lehrern, und wir wurden zielstrebig zu Respekt und Autoritätshörigkeit erzogen. Es gab Lehrer, deren Unterricht in einer Atmosphäre von Angst auf Seiten der Schüler ablief, denn Widerworte oder Unaufmerksamkeit führten nicht selten zu körperlichen Züchtigungen. Der 2. Weltkrieg und die Nazi – Herrschaft waren erst seit gut 10 Jahren beendet. Die Väter meiner Mitschüler hatten fast ausnahmslos als Soldaten in diesem Krieg gekämpft, waren an der West- und Ostfront gewesen, und die Schrecken dieser Erlebnisse ließen sie offenbar nie mehr los. Wenn Erwachsene sich abends zu einem Essen trafen oder wenn wir Besuch zu Hause hatten, landete das Gespräch früher oder später unweigerlich bei Kriegserlebnissen, und wir Kinder lauschten diesen Gesprächen immer besonders aufmerksam – waren sie für uns doch so aufregend und abenteuerlich wie ein spannender Film für spätere Generationen. Wir erkannten in unseren jungen Jahren natürlich nicht die Entsetzlichkeiten dieser gottlob vergangenen Zeit, und uns war auch nicht bewusst, dass unsere Eltern in den 12 Jahren des Nazi – Terrors weitgehend ihrer Grundrechte und Freiheiten beraubt worden waren. Das Thema Holocaust wurde so gut wie nie thematisiert. Erst in der Schule, aber auch da erst in viel späteren Jahren - und später aus den Medien bekamen wir mit, was sich an Unvorstellbarem hier in unserem Land abgespielt hatte. Mama erzählte einmal, wie sie als junges Mädchen lange vor dem Krieg auch eine jüdische Mitschülerin zu ihrem Geburtstag eingeladen hatte. Als ihr Vater, den ich nie kennengelernt habe – er starb in den ersten Tagen nach dem Krieg an einem Herzinfarkt im heutigen Tschechien, wo er beruflich unterwegs gewesen war – davon erfuhr, war er außer sich – nicht etwa, weil er Antisemit gewesen wäre, sondern weil er befürchtete, von irgendeinem Nachbarn denunziert zu werden und weil dann mit Repressalien von Seiten des Staates zu rechnen war. In späteren Jahren fragte ich meine Eltern, wie das gewesen sei im Dritten Reich, als man nicht wirklich frei war, als man nicht sagen durfte, was man dachte oder fühlte oder woran man glaubte, und besonders interessierte mich natürlich auch die vordringliche Frage, wie sie, meine Eltern, die „Endlösung“ erlebt hatten – besonders nach der Reichskristallnacht im November 1938. Meine Eltern konnten mir hierzu nicht viel sagen, vielleicht wollten sie es auch nicht. Man habe nie gewusst, was sich in Wahrheit abgespielt habe. Jüdische Mitbürger seien „abgeholt“ worden, man habe von Deportationen gehört, Nachbarn und auch Freunde verschwanden. Aber man habe immer angenommen, sie seien ins Ausland gebracht oder geschickt worden oder sie seien aus freien Stücken ausgewandert. Aber man habe auch nie gewagt, nachzufragen. Wo oder bei wem auch – der Staat sei allgegenwärtig gewesen, und es habe ja auch deutsche Bürger gegeben, die verhaftet wurden – nur, weil sie sich nach jüdischen Mitbürgern erkundigt hatten. Es macht mich auch heute immer noch betroffen und fassungslos, wie ein ganzes Volk sich derart knechten ließ, dass es nicht einmal seine Stimme zu erheben wagte, wie ein Staat seine Macht derart missbrauchen konnte, um die Menschen ihrer Grundrechte auf Freiheit und Toleranz zu berauben. Und natürlich – wie ein Massenmord von diesem Staat in all seinen Details und Abläufen und seiner schrecklichen Infrastruktur organisiert und durchgeführt wurde – vor den verschlossenen Augen seiner Bürger. Dies alles ist aus heutiger Sicht völlig unfassbar.
Angesichts des Erfolges einer rechtpopulistischen AFD in vielen Landtagswahlen (und vermutlich auch in den kommenden Bundestagswahlen) mögen doch gewisse Zweifel aufkommen, ob die Menschen in Deutschland wirklich ein für allemal gelernt und nach dem 2. Weltkrieg eine für alle Zeiten geltende positive Veränderung herbeigeführt haben. Denn beim Anblick brauner Horden, die Ausländer durch die Straßen einer ostdeutschen Stadt jagen und sie bedrohen, muss man sich doch fragen, wie weit das Gedächtnis dieser Menschen zurückreicht – bzw. warum dieser fehlgeleitete Mob bar jeder geschichtlichen Einsicht geblieben ist.
Dennoch: Es war ein großes Glück für Nachkriegsdeutschland, besonnene demokratische Führer zu haben, die viel dafür taten, aus dem Schreckensstaat, der Deutschland zwölf Jahre lang gewesen war, eine funktionierende Demokratie zu formen. Dies kann man offenbar nicht von der Menschheit im allgemeinen sagen – denken wir nur an die größte von Menschen verursachte humanitäre Katastrophe der Geschichte und den gewaltsamen Tod von bis zu 45 Millionen Chinesen unter Mao Tse Dong, der erst offenbar wurde, als man vor wenigen Jahren bei einer in China durchgeführten Volkszählung einen Knick in der Demographie feststellte, der auf diese unfassbare Menge an Toten zurückzuführen war, die weit über die normale Sterblichkeitsrate hinausging. Oder an die Millionen Menschen, die von den Roten Khmer in Kambodscha willkürlich abgeschlachtet wurden oder – wenn wir auf die nähere Vergangenheit blicken – auf die Opfer von Willkür, Hass und Machtgelüsten etwa im Nahen Osten. Nichts von alldem kann natürlich die Untaten, einen Völkermord und die monumentalen Verbrechen, die im Namen Deutschlands von den Nazis verübt wurden, relativieren. Diesem Teil unserer Geschichte müssen wir uns – ob es uns nun gefällt oder nicht – auch heute noch stellen, und wir sollten ihn auch immer wieder beleuchten – vor allem für nachfolgende Generationen, damit er nie in Vergessenheit gerät.
Aber von diesen Gedanken war ich damals in den 50er Jahren noch sehr weit entfernt. Ich wuchs in einem behüteten Elternhaus in liebevoller Atmosphäre auf – und war eher ein verwöhntes Einzelkind – meine Schwester war ja fast 4 Jahre älter als ich und lebte in ihrer Jungmädchenwelt. Oma und Mama teilten sich die Hausarbeit, während Daddy – so nannte ich meinen Vater - für den Unterhalt der Familie sorgte – ein klassisches Familienidyll aus der heilen Welt der 50er – so, wie man es auch aus heutiger Sicht kennt.
Mein Vater war gebürtiger Engländer und hatte Deutschland zwischen 1933 und 1939 mehrmals besucht; im Mai 1939 war er dann endgültig nach Deutschland gekommen, als Gastarbeiter sozusagen – auf der Suche nach einer besseren Zukunft, denn in England hatte er damals für sich keine Aufstiegschancen mehr gesehen, während Deutschland unter den Nationalsozialisten wie ein Phoenix aus der Asche des 1. Weltkrieges zu steigen schien. Er ahnte damals nicht, dass er den Rest seines Lebens hier verbringen würde. Er hatte auch innerhalb kürzester Zeit einen Job als Sprachlehrer bei der Berlitzschule bekommen, wo sein Anfangsgehalt gleich mehr als doppelt so hoch war wie das letzte Gehalt, das er in England bezogen hatte!
Mit Daddy redete ich ausschließlich Englisch, mit Mama und dem Rest der Familie Deutsch. Meine Eltern sprachen miteinander Englisch, und wenn wir beim Essen alle zusammensaßen, wurden beide Sprachen gesprochen. Sonntags machten wir des öfteren ein Picknick im Bergischen Land. Dazu fuhren wir zu viert auf der Goggo, dem Motorroller meines Vaters - ich stand vorne zwischen den langen Beinen meines Vaters, meine Schwester wurde zwischen Vater und Mutter eingeklemmt, so wie man es heute noch häufig in Indien sieht, hinaus und suchten uns ein Plätzchen auf einer Wiese in der Nähe des Flüsschens Dhünn, wo meine Mutter dann einen Korb auspackte mit Broten und gekochten Eiern sowie Säften und einer Thermoskanne Tee.
Mittlerweile hatten wir ein Radiogerät bekommen – ein Loewe Tischgerät, mit dem wir über Kurz- oder Mittelwelle in die Welt hinaushorchen konnten. Manchmal erwischten wir einen afrikanischen oder asiatischen Sender, auf dem Daddy die Nachrichten las. Seinen Job als Englischlehrer bei der Berlitzschule hatte er da längst aufgegeben. Er war mittlerweile freiberuflicher Übersetzer und Nachrichtensprecher bei der Deutschen Welle und produzierte auch Werbefilme oder Dokumentationen für die Industrie. Meist arbeitete er in unserem Kombizimmer an seiner Schreibmaschine, deren Klappern in der ganzen Wohnung zu hören war. Allerdings gab er noch vereinzelt Privatunterricht in englischer Konversation, so auch einem sehr wohlhabenden Professor mit dem Namen Bumm, dem Inhaber eines chemischen Werkes in Köln. Meist fuhr mein Vater mit seinem Goggo Motorroller nach Mülheim zu Professor Bumm, manchmal kam der Professor aber auch zu uns in unser bescheidenes Heim. Er hatte schon damals einen schwarzen Mercedes 300, den sogenannten Adenauer Mercedes, gefahren von seinem Chauffeur, Herrn Krimann. Der wartete dann draußen vor der Tür im Auto, während Daddy und der Professor sich auf Englisch unterhielten. Bei einem dieser Abende wurde Krimann jedoch mit dem Auto in die Stadt geschickt, um Frau Bumm abzuholen. Sie war eine hübsche Blondine – ich erinnere mich nur an ihre etwas aufgedrehte Art und ihre blonden Haare. Und als sie an diesem Abend unsere Wohnung betrat, erzählte sie ihrem Mann – und damit auch meinem Vater, was sie alles heute eingekauft hatte, Klamotten, Schuhe und den üblichen Kram, mit dem auch heute noch Heerscharen von Frauen und natürlich auch Männern aus der Stadt nach Hause kommen. Darauf meinte mein Vater, diese Schätze könne er sich leider nicht leisten, doch er wolle Frau Bumm und ihrem Gatten gerne seinen eigenen Schatz zeigen, den er zu den größten in seinem Leben zählte. Die Bumms waren sofort neugierig. Mein Vater öffnete die Tür zu meinem Schlafzimmer und zeigte auf mich, der ich in meinem Kinderbett lag und friedlich schlief. „This is my greatest treasure!“ Frau Bumm muss daraufhin in Tränen ausgebrochen sein, so sehr war sie gerührt. Einige Zeit später offenbarte der Professor meinem Vater, dass seine Frau leider keine Kinder bekommen konnte und auch aus diesem Grund von der Geste meines Vaters derart berührt war, worauf sich dieser mächtig Gewissensbisse machte, denn er hatte die Bumms absolut nicht auf den Unterschied zwischen konventionellen und emotionalen Schätzen ansprechen wollen, aber genau das hatte er ja getan.
Wir hatten mittlerweile auch längst das versprochene Telefon bekommen, und damit begann die Welt ein kleines Stückchen kleiner zu werden, man konnte erreichen und war erreichbar. Sonntags nahm mich Daddy oft mit ins Funkhaus am Wallrafplatz in Köln. Dann war dort wenig los, die Hektik in den Redaktionen hielt eine Verschnaufpause, und ich konnte ihm bei seiner Arbeit zusehen. Zuerst übersetzte er die in deutscher Sprache und auf DIN A 5 Zetteln verfassten Nachrichten ins Englische, und zur vollen Stunde ging er ins Studio, wo er sie verlas. Diese Nachrichten gingen dann hinaus in die weite Welt. Die Deutsche Welle sendete damals als „the voice of Germany“ überall hin – außer nach Deutschland. Einige Male durfte ich mit ins Studio. Dort saß ich dann ehrfurchtsvoll an dem Sendetisch mit seinen diversen Tasten und Knöpfen, über dem 2 Mikrofone von der Decke herabhingen. Es gab auch einen Hustenknopf, auf den der Sprecher zu drücken hatte, wenn er sich räuspern wollte oder husten musste, denn die verlesenen Nachrichten sollten ein cleanes Produkt sein – ohne störende Nebengeräusche.
Ich weiß nicht, wie es heute in Funkhäusern zugeht, aber damals war da – zumindest bei der Deutschen Welle – ein Haufen bunter Vögel am Werk. Es gab nicht nur die englischen Nachrichten mit ihrem Sprecher – es gab das gleiche auch in fast allen Weltsprachen. Daher arbeiteten dort Sprecher und Sprecherinnen aus ganz Europa, aus Schwarzafrika, aus dem gesamten asiatischen Raum und aus Südamerika – halt aus allen Regionen, in die auch gesendet wurde. Und offenbar hatte man dort auch sehr viel Spaß! Daddy war mit einem besonders ausgeprägten tiefschwarzen britischen Humor gesegnet, mit dem so mancher aber auch seine Probleme hatte. Einige meiner Mitschüler wussten oft nicht, woran sie waren, wenn mein Vater seine Pointen abfeuerte – man war zumindest damals die Respektlosigkeit dieses Humors noch nicht gewohnt, eines Humors, der vor allem auch nie vor sich selbst haltmachte und durchaus verunsichern konnte. Und wenn dann doch die gesamte Runde herzhaft lachen musste, schoss mein Vater üblicherweise ein „never laughed so much since the night my first wife died“ (‚so habe ich seit dem Tod meiner ersten Frau nicht mehr gelacht!‘) hinterher. Als ich eines sonntags neben meinem Vater im Studio saß, kamen ein Franzose und ein Spanier in den Regieraum, der vom Sprecherraum durch eine dicke, schalldichte Glasscheibe getrennt war. Und diese beiden versuchten dann mit unvorstellbaren Grimassen und Gesten, sowie mit pantomimischen Kommentaren zu den gelesenen Nachrichten, meinen Vater zum Lachen zu bringen. Aber Daddy bewahrte eine stoische Ruhe – er kannte diese Tricks und hatte oft genug selber dabei mitgemacht. Nichts schien ihn aus der Ruhe bringen zu können. Ich hingegen war auf dieses Spektakel überhaupt nicht vorbereitet, und so platzte ich mitten in die Nachrichten über das Ableben eines wichtigen Politikers hinein – ich bog mich vor Lachen. Mein Vater drehte sich mehr belustigt als entsetzt zu mir und drückte, so schnell er konnte, auf die Hustentaste. Aber das war ja alles live, und es war nun mal gesendet. Es wurde eine längere Pause, bis ich mich endlich beruhigt hatte und er seine Nachrichten zu Ende lesen konnte. Die Verursacher im Regieraum bekamen sich überhaupt nicht mehr ein ob ihres Erfolges – sie feixten und klopften sich auf die Schenkel vor Begeisterung. Ich glaube nicht, dass jemals irgendein Kommentar von offizieller Seite gekommen ist – und wenn, dann wird das sehr weit weg gewesen sein, so dass er es nie bis nach Köln geschafft hat!
Damals nahm man in Funkhäusern die Dinge vielleicht auch nicht ganz so ernst, wie das heute wohl der Fall ist. Als etwa der Pacelli - Papst Pius XII im Oktober 1958 im Sterben lag, mussten in den Nachrichtenredaktionen Sonderschichten gefahren werden, weil man ja ganz nah an den aktuellen Geschehnissen dran sein wollte bzw. musste. Der magenkranke Papst hatte mehrere Schlaganfälle erlitten, und nun zog sich sein Sterben über Tage und Wochen hin. Als dann eines nachts einem Gerücht aus Castel Gandolfo zufolge sein Tod eingetreten war, wurde dieses Gerücht nicht etwa verifiziert, sondern mit einem „endlich“ dankbar aufgenommen, und der Tod des Papstes wurde in einer Sondermeldung der Deutschen Welle in die Welt gesendet. Der Papst lebte dann allerdings noch 2 weitere Wochen, bevor er sich in die ewigen Jagdgründe aufmachte.
Manchmal blieb ich auch im Funkhaus in dem kleinen Büro meines Vaters sitzen, während er die Nachrichten las, die er dort vorher übersetzt hatte und die über einen Lautsprecher direkt in eben dieses Büro übertragen wurden. Von diesem Büro ging der Blick bis hinüber zum Dom, und ich liebte es, dem Treiben um die Kathedrale zuzusehen. Straßenbahnen zogen vorbei, einige wenige Autos und erste Touristen waren damals unterwegs, die Domplatte war ja noch nicht gebaut, und während er heute in großer Erhabenheit seine Türme in den Himmel reckt, stand der Dom damals noch gleichsam mitten im Stadtgewühl auf einem kleinen mit Gras bewachsenen Hügel. Dann kamen die Nachrichten, erst das Sendezechen der „Welle“, wie man den Sender nannte, die klaren, weichen Celesta Klänge „es sucht der Bruder seine Brüder“ aus Beethovens Fidelio. Hierauf die vertraute Stimme meines Vater – „this is the news…“. Es folgten die belanglosen Meldungen aus aller Welt – nichts Bedeutendes war passiert in den Stunden zuvor. Und dann, am Ende eines Satzes, laut und deutlich „hello Dettie“! Er hatte es gewagt, mich in seiner Nachrichtensendung einfach zu begrüßen! Das war eigentlich ein unerhörter Vorgang, der ohne weiteres zumindest eine Rüge hätte nach sich ziehen können. Doch es war ja ein Sonntagvormittag, und mein Vater vertraute wohl auch darauf, dass zu diesem Zeitpunkt keiner der Rundfunkräte ihm zuhören würde. Diese kleine Einlage blieb ohne irgendwelche Konsequenzen – wenn man von meiner Begeisterung einmal absieht. Wenn Daddy fertig war mit seiner Arbeit – die letzten Nachrichten waren gelesen, der Schreibtisch wieder aufgeräumt, liefen wir hinüber zum Hauptbahnhof, wo er sich täglich – und zwar bis an sein Lebensende – seine „Daily Telegraph“ kaufte. Dies war für ihn mehr als ein Ritual. Er sagte immer, dass er die englische Zeitung brauche, um sprachlich am Ball zu bleiben. Denn Sprache ändere sich, sei dynamisch, und wenn man nicht achtgebe, könne man sich von seiner eigenen Sprache entfernen, spreche nicht mehr zeitgemäß, und das sei immer zu hören! Und da Sprache schließlich sein Beruf war, kann ich das auch heute sehr gut nachvollziehen. Viele Jahre später bezeichnete ihn der bekannte englische Sprachwissenschaftler Richard D. Lewis in seinem Buch „The Road from Wigan Pier“ als einen brillanten Linguisten – und ich denke, da hatte er wohl recht!
Es kam nicht selten vor, dass Daddy unangemeldete Gäste mit nach Hause brachte. Einmal waren es zwei Afrikaner – wenn ich mich recht erinnere, waren sie aus Uganda. Sie waren wie mein Vater Sprecher bei der Deutschen Welle. Der Sender strahlte seine Programme auch in die entlegensten Regionen der Welt in den jeweiligen Landessprachen aus, wozu er eben Sprecher auch dieser Länder beschäftigte. Beide waren in weiße Tücher gekleidet – so kam es mir zumindest vor – und sie hatten Gesichter mit langen Narben, die ihnen in der Kindheit gemäß ihrer Stammeszugehörigkeit geritzt worden waren. 1954 sah man in Deutschland nie einen „Neger“ – so wurden sie damals ohne schlechtes Gewissen genannt – ich glaube, den Ausdruck „Farbiger“ oder „Schwarzer“ – die gab es damals noch gar nicht! Sie brachten mir einen Brieföffner aus Elfenbein mit, den ich noch heute aufbewahre. Die Kollegen meines Vaters waren ein bunter verschworener Haufen, und wenn sie abends bei uns zu Besuch waren, was nicht selten vorkam, dann ging es immer hoch her – es wurde ausgelassen getrunken und gegessen und gelacht. Dies waren die Jahre, als Deutschland wieder einmal wie ein Phoenix aus der Asche stieg. Aus Trümmerbergen wuchsen Häuser, die bittere Armut der ersten Nachkriegsjahre nahm langsam, aber sicher ab, und der neue Wohlstand brach sich unaufhaltsam Bahn. Daddy bekam zunehmend Aufträge für Film- und Sprachproduktionen und war viel in Deutschland unterwegs.
Irgendwann brachte er abends einen sympathischen Engländer mit einer prägnanten Stimme mit nach Hause. Er war relativ klein und drahtig und hatte einen sonnigen Humor, und ich erinnere mich sehr gut, dass wir vor Lachen kaum essen konnten, so lustig war er. Er hatte während der letzten Jahre neben diversen Moderationsjobs den Deutschlandspiegel übersetzt und gesprochen – eine Wochenschau, die von der Bundesregierung finanziert wurde und in vielen Sprachen in der ganzen Welt zur Aufführung kam. Chris Howland – das war der Name des Engländers, hatte aber mittlerweile vom neuen WDR in Köln das Angebot bekommen, eine wöchentliche Musiksendung zu moderieren. Dieses Angebot wollte er gerne annehmen, suchte aber vorher noch einen Nachfolger für den Deutschlandspiegel. Und mein Vater war nur zu gerne bereit, Chris Howlands Erbe bei dem in Hamburg produzierten Magazin anzunehmen! So kam es, dass Daddy alle zwei Wochen für zwei Tage nach Hamburg flog. Mama und ich brachten ihn meist zum Flughafen nach Wahn, und einige Male trafen wir dort auch Chris Howland, mittlerweile Moderator von „Studio B“ – wohlgemerkt der Radiosendung, über die heute so gut wie nichts mehr zu erfahren ist, da man nur noch von der Fernsehsendung mit demselben Namen hört. Offenbar hatte der zuständige Redakteur des Senders sich heillos mit Howland zerstritten und als Racheakt sämtliche Bänder aller Sendungen zerstört – ein unerhörter und beispielloser Vorgang. Das Fernseh – Studio B wurde dann aber ebenfalls von Mr. Heinrich Pumpernickel, wie sich Chris auch zu nennen pflegte, moderiert, der schon bald einer der ersten großen Stars in Deutschland werden sollte – wenn man so will, war er der erste DJ überhaupt, ein Pionier der ersten Tage! Wenige Wochen vor seinem Tod hatte ich noch – oder besser: wieder Kontakt zu ihm; er schrieb mir eine e-mail, auf der er sich „anhörte“ wie vor 60 Jahren. Er wollte mich treffen und in seine Sendung „Spielereien mit Schallplatten“ einladen, die er immer noch oder wieder moderierte. Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen.
Mein Vater war ein überaus empathischer Mensch. Familie bedeutete ihm alles, und er war der liebevollste Vater, den man sich denken kann. Er hatte immer Zeit für mich, obwohl er schon damals ziemlich viel für seine Film- und Sprachproduktionen unterwegs war. Ich kann mich an kein böses Wort aus seinem Mund erinnern. Er suchte immer die positiven Seiten in den Menschen und versuchte, auch den negativen Dingen oder Niederlagen noch eine positive Seite abzugewinnen. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die schon ziemlich aufbrausend sein konnte und ein eher südländisches Temperament hatte (sie behauptete immer, sie habe italienische Vorfahren, was sie allerdings nie belegen konnte), war mein Vater immer die Ruhe selbst, ein Fels in der Brandung und insofern auch ein Vorbild, an dem ich mich orientieren konnte, das sich vor allem auch zur Orientierung eignete! Manchmal nahm er mich mit auf einen seiner vielen Spaziergänge durch unseren Wald, den er so liebte. Jeden Morgen machte er sich auf seinen „early morning walk“ und marschierte strammen Schrittes mit seinem Spazierstock den Weg gegenüber von meinem Schlafzimmer in den Wald hinein. Oft verfolgte ich ihn mit meinem Blick, bis er hinter Bäumen und Büschen verschwand. Wenn er dann eine gute halbe Stunde später wieder zurückkam, sein Gesicht kalt von der Morgenluft, empfing Oma ihn immer – jeden Morgen! – mit den Worten „wie isset draußen?“ Das wurde später ein standing joke in der Familie. Dann hatte Oma schon das Frühstück zubereitet, Speck brutzelte, und sie schlug ein Spiegelei in die Pfanne. Der Duft durchzog jeden Morgen die Wohnung, und wenn ich heute daran denke, läuft mir immer noch das Wasser im Munde zusammen, obwohl mein Frühstück in der Regel mittlerweile wesentlich schmäler ausfällt! Oder vielleicht gerade deswegen? Aber damals bekam mein Vater fast jeden Tag sein „full English breakfast“ mit Spiegeleiern auf Toast, vorher einen Porridge und danach zwei Scheiben Toast mit bitterer Orangenmarmelade. Ich sah oft fasziniert zu, wie die Milch, die er sich über seinen Porridge goss, die ausgelöffelten Stellen weiß füllte. Mein Vater war der Einzige, der ein solch opulentes Frühstück zu sich nahm – wir Kinder, meine Mutter und auch Oma hatten sich mit einem Brötchen oder einer Scheibe Brot und Marmelade zu bescheiden.
Wir waren einmal an einem Sommertag im Wald unterwegs – nur Daddy und ich, und wir setzten uns an einer mächtigen alten Tanne ins Gras. Hier - mitten in der Natur, die Welt weit weg, umgaben uns der Duft der Farne und Bäume und das Zwitschern der Lerchen. Und er erklärte mir die Welt, so wie er sie sah – er meinte, dass keine Kathedrale dieser Welt je die Schönheit und Erhabenheit der Natur wiedergeben könne – dieser Baum, an den wir uns lehnten, sei nicht von Menschen gebaut worden, und kein Mensch schaffe es, eine Konstruktion mit einer derartigen Statik zu erschaffen, die Wind und Wetter standhalten könne und dabei lebendig sei. Als klassischer Pantheist sah er Gott in dieser Welt – sein Gott lebte hier in der Natur, die ihn mit einem tiefen inneren Frieden erfüllte. Wenn ich mir seine Sicht dieser Dinge auch nie völlig zu eigen machte, so hat sie mich doch bis auf den heutigen Tag sehr nachhaltig beeinflusst.
Dieser Spaziergang damals hatte einen besonderen Grund. Ich ging in die katholische Volksschule Leuchterstraße in Köln – Dünnwald, und unser Religionslehrer, ein Kaplan Helmig, sah in mir den geborenen Messdiener – also Ministranten. Ich war auch keineswegs abgeneigt, diese Aufgabe anzunehmen – stellte sie doch in den Augen der Kinder durchaus ein Privileg dar – man war dem Altar näher, durfte Messgewänder, Kelche und das riesige Messbuch, das sogenannte Missale, berühren. Doch was heißt schon berühren – der Messdiener hatte während der Messe, die damals – vor dem 2. Vatikanischen Konzil - noch auf lateinisch gelesen wurde, dieses schwere Messbuch von links nach rechts und wieder zurückzutragen, wobei ich schon mehrmals kleine Jungen habe straucheln sehen! Wir wohnten allerdings gut 3 Kilometer von der Kirche entfernt, und so manche Messe wurde schon um 5 Uhr morgens gelesen, so dass ich als Ministrant um 4 Uhr hätte aufstehen müssen – und meine Mutter oder mein Vater ebenfalls, denn man wollte mich ja schließlich so früh morgens nicht allein mit dem Fahrrad durch den Wald nach Dünnwald fahren lassen. Daddy arbeitete bei der Deutschen Welle im Schichtdienst, d.h. er kam manchmal erst früh morgens nach Hause, weil die ganze Nacht über Nachrichten gesendet wurden. Und daher war es meinen Eltern einfach zu viel, mich einmal pro Woche in aller Herrgottsfrühe in die Kirche zu bringen – zumal vor allem mein Vater ohnehin kein großer Freund von Institutionen – welcher Art auch immer – war, und zu denen zählte er auch die Kirche. Er wurde daraufhin von Kaplan Helmig zu einem Gespräch in die Pfarrei gebeten. Dieses Gespräch endete in einem Fiasko – mein Vater wurde des Hauses verwiesen und blieb, solange Helmig in Dünnwald war, persona non grata. Und darauf war er sehr stolz! Denn er hatte Helmig, der offenbar versucht hatte, meinem Vater mächtig zuzusetzen und ihn mehr oder weniger beschimpfte, die Stirn geboten und ihm gesagt, er solle nicht glauben, dass sein Gott ganz allein in seinem Backsteinbau zu finden sei, worauf Helmig ihn kurzerhand rausschmiss. In der Folgezeit bekam ich die Ablehnung des Kaplans mehrfach zu spüren, aber irgendwann verschwand er sang- und klanglos; auf Grund mehrerer Beschwerden von verschiedenen Eltern war er versetzt worden.
Meine Achtung vor Daddy war mächtig gestiegen – er hatte der allmächtigen Kirche die Stirn geboten, und die hatte ihm mit ihrem Kaplan Helmig keine Argumente entgegensetzen können. Die stärksten Argumente lieferte mein Vater - nämlich als wir unter der mächtigen Tanne im Gras saßen und er mir sein Verständnis von Gott und der Welt erklärte.
Wenn er sich danach fühlte oder er mich beschäftigen wollte, gingen Daddy und ich in den Wald, um Fußball zu spielen. Es gab in der Nähe eine Lichtung mit mächtigen alten Buchen. Wir nannten diesen Ort die „dicken Buchen“, und 4 Bäume mussten für die beiden Tore herhalten, zwischen denen wir den Ball hin und her kickten, wobei mein Vater eher ungelenk an den Ball trat, lebte er doch nach Churchills Devise: no sports! Ich schätzte diese Aufenthalte in meinem geliebten Wald umso mehr, wenn mein Vater mit von der Partie war. Meist war ich allerdings alleine unterwegs, streifte durchs Gebüsch, kletterte bis hoch in die Wipfel der Bäume oder baute mir Unterstände oder „Lager“, wie wir sie nannten. Dort lebte ich in meiner eigenen Fantasiewelt - ich war Krieger, Fallensteller, Indianer – was immer mir gerade einfiel. In den Ferien stand ich manchmal in aller Frühe auf, meist um 4 Uhr - und lief in den noch dunklen Wald, wo ich auf Jägerstände kletterte, von denen aus ich Rehe beobachtete, Füchse und Wildschweine, während das erste Licht in den Himmel kroch. Und wenn ich um 7 wieder nach Hause kam, schlich ich mich zurück in mein Bett, so dass meine Eltern meist nichts von meinen Eskapaden bemerkten. Bei all dem war ich eigentlich immer alleine, ohne mich einsam zu fühlen. Ich hatte meinen Rückhalt zu Hause, und meine Freunde waren neben meinem Teddybär, den mir mein Patenonkel zur Geburt geschenkt hatte und den ich noch heute hüte, die Tiere im Wald und meine Fantasie, die allerdings ziemlich lebhaft war. Ich horchte dem Gesang der Vögel, den ich mir in Sprache übersetzte, um so mit diesen kleinen Sängern zu kommunizieren. Und als ich alt genug war, begann ich zu lesen. Meine ersten beiden Bücher waren „Old Surehand“, beide Bände, von Karl May. Die hatte ich im Bücherschrank meiner Eltern entdeckt, weil sie kleiner waren als alle anderen Bücher. Ich schlug einen Band auf und tauchte ein in die Fantasiewelt des Autors. Meine Eltern verbaten mir die Lektüre – weiß der Himmel, warum. Vielleicht meinten sie, ich sei mit meinen 8 oder 9 Jahren noch zu jung für die Brutalitäten des Wilden Westens! Was sie wohl empfunden hätten, wenn die sie heute einen Film von Quentin Tarantino hätten ansehen müssen! Aber ich las die Bücher natürlich dann heimlich, nachts im Schein meiner Taschenlampe unter der Bettdecke und wann immer sich die Gelegenheit bot.
Und in der Folge las ich dann auch fast den kompletten Rest – die meisten der 70 Karl – May -Bücher, wie so viele Leser vor und nach mir. Meine Eltern hatten natürlich bald nachgegeben, und es gibt ein Foto, das mich Weihnachten 1960 mit meinen Geschenken zeigt: mehrere Bände von Karl May – zusammen mit einem Flugticket nach London. Ich durfte mit meinem Vater ein paar Tage in England verbringen, und drei Tage später sollte es losgehen. Dies war das zweite Mal, dass ich fliegen würde – das erste Mal war 1954 gewesen, zur Goldenen Hochzeit meiner Großeltern – der Eltern meines Vaters. Hierzu waren wir von Düsseldorf nach Birmingham geflogen – mit einer Elisabethan der BEA, der British European Airways. Meine Mutter litt damals unter panischer Flugangst, und um sich zu beruhigen, hatte sie ein ganzes Fläschchen Klosterfrau Melissengeist getrunken. Daher war sie wahrscheinlich mehr oder weniger vom Alkohol benebelt, als wir unsere Plätze einnahmen. Wir saßen uns zu viert in Zweiersitzen an einem Tisch gegenüber. Und als die Stewardess kam und Mama fragte, ob sie ihren Kaffee schwarz oder weiß haben wollte („would you like your coffee black or white?“) verstand meine Mutter „are you feeling all right“ und antwortete mit „yes, thank you“!
Für meine Eltern hatte diese Reise einen ganz besonderen Stellenwert, und sie war wesentlich wichtiger, als wir Kinder das wahrnehmen konnten: Es ging nicht nur um die Goldene Hochzeit meiner Großeltern; für meinen Vater war dies nach vielen langen Jahren auch die erste Reise zurück in seine Heimat. Zum ersten Mal nach fünfzehn Jahren würde er seine Eltern wiedersehen, nach all dieser Zeit, in der so unglaublich viel geschehen war – der Holocaust, ein grausamer Krieg, der weite Teile Europas nahezu verwüstet hatte, die Hochzeit meiner Eltern, der Kampf ums Überleben, meine Schwester und ich wurden geboren, und nichts war mehr so wie zuvor. Bei vorher geplanten Reisen war der Krieg dazwischengekommen, und während des 2. Weltkrieges gab es natürlich keine Reisemöglichkeiten zwischen den verfeindeten Ländern England und Deutschland. Nach Kriegsende hatte es dann andere Probleme gegeben, und die waren für meine Eltern zutiefst Besorgnis erregend. Mein Vater war am 15. Mai 1945 in der Nähe von Oldenburg, wo meine Eltern das Kriegsende erlebt hatten, von anrückenden kanadischen Soldaten verhaftet worden. Sie handelten auf einen von den Engländern ausgegebenen Haftbefehl und übergaben den Gefangenen noch am selben Tag an eine englische Einheit. Man warf ihm „Kooperation mit dem Feind“ vor, was mit Hochverrat gleichzusetzen war, denn er hatte für den deutschen Reichs-Rundfunk gearbeitet, wo seine Aufgabe darin bestanden hatte, die Nachrichten in englischer Sprache zu verlesen (zu seinem Glück nicht, sie auch zu verfassen!). Sein Chef beim Reichs-Rundfunk war ein gewisser William Joyce, der auch die „englische Stimme Hitlers“ genannt wurde. Bekundungen meines Vaters zufolge hatte er Joyce lediglich einmal kurz getroffen und ihn dabei als eher unangenehm empfunden; zusammengearbeitet hatte er nie mit ihm. Joyce – wegen seiner markanten Aussprache in England auch Lord Haw Haw genannt - war Verfasser zahlloser antisemitischer Pamphlete und Autor einer unsäglichen Propaganda für die Nazis gewesen, und seine Wortbeiträge, deren Inhalt mitunter an das Geschrei des berüchtigten deutschen Propagandaministers Joseph Goebbels erinnerten, wurden über das Radio in ganz England gehört. Doch für die englische Bevölkerung war Joyce eher ein Clown; richtig ernst genommen wurde er zumindest von der breiten Bevölkerung wohl nicht. Joyce war nach Kriegsende in einem Wald bei Flensburg ebenfalls festgenommen worden und wurde später im Gefängnis von Wandsworth südlich von London nach einem stark umstrittenen Verfahren hingerichtet. Umstritten, weil Joyce womöglich ein englischer Doppelagent war, der den englischen Behörden in seinen Radioberichten angeblich codierte geheime Mitteilungen hatte zukommen lassen und der zudem nicht die englische Nationalität besaß und demzufolge weder der englischen Gerichtsbarkeit unterlag, noch wegen Hochverrats hätte verurteilt werden dürfen – zumindest nicht von den Engländern. Er war eigentlich Amerikaner, der die deutsche Nationalität angenommen hatte. Meinem Vater drohte derweil in England ebenfalls die Todesstrafe – denn man warf ihm genau das vor, was Joyce an den Galgen gebracht hatte. Barry Jones wurde in ein englisches Militärgefängnis nach Brüssel gebracht, während meine Mutter, damals mit meiner Schwester hochschwanger, in ein ehemaliges KZ gebracht wurde, in dem man sie ohne Angabe eines konkreten Grundes über mehrere Wochen hinweg internierte. Dieses KZ wurde von Kanadiern als Gefängnis genutzt, und das Einzige, was meine Mutter jemals erfuhr, war der Vorwurf, einen Engländer geheiratet zu haben, der als Verräter angeklagt werden würde.
Der Vorwurf des Hochverrats auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit beim Rundfunk ließ sich zum Glück jedoch nicht erhärten und beweisen schon gar nicht, aber die englischen Behörden ließen nicht locker. Sie versuchten schließlich meinem Vater nachzuweisen, dass er seine Nationalität während des Krieges geändert hatte, und nicht – wie er bei den Verhören stets behauptet hatte – bereits vor dem Krieg, nämlich im Juli 1939. Aber auch dieser Versuch, ihn eines Aktes des Hochverrats zu überführen, führte aus Sicht der Engländer zu nichts, denn in einem der letzten Luftangriffe auf Berlin hatten sie selbst alle entsprechenden Archive, in denen man möglicherweise hätte fündig werden können, in Schutt und Asche gelegt. Und so wurde mein Vater nach über fünf Monaten wieder auf freien Fuß gesetzt – allerdings mit der Auflage, nie mehr englischen Boden zu betreten. Bei Zuwiderhandlung wäre er beim Versuch der Einreise umgehend verhaftet und möglicherweise wieder angeklagt worden.
Meine Großeltern hatten ziemlich weitreichende Verbindungen bis ins englische Unter- und Oberhaus und hatten Gott und die Welt angeschrieben und Petitionen eingereicht, um eine Aufhebung des Reiseverbots gegen meinen Vater zu erreichen. Mein Großvater bombardierte das englische foreign office mit zahllosen Briefen und Dokumenten, die die Unschuld meines Vaters belegen sollten. Diese Initiativen meiner Großeltern gingen bis hin zur Familie des ehemaligen Premierministers Neville Chamberlain. Viele dieser hochangesehenen Personen waren zum Tee im Haus meiner Großeltern eingeladen – noch heute zeugt davon eine weiße Tischdecke, auf der meine Großmutter die Signaturen ihrer Gäste sammelte, die sie dann mit blauem Faden nachstickte. Und tatsächlich – irgendwann geschah das nahezu Unmögliche: England gab nach und erlaubte ab 1954 meinem Vater, England für 2 Wochen pro Jahr zu besuchen – vorausgesetzt, der Aufenthalt im Vereinigten Königreich diente allein dem Besuch seiner Eltern. Laut Unterlagen des englischen Geheimdienstes MI5, die heute einsehbar und frei verfügbar sind, nachdem sie während der vergangenen Jahrzehnte als „TOP SECRET“ klassifiziert gewesen waren, dauerte die Überwachung meines Vaters durch eben diesen Geheimdienst immerhin ziemlich genau 44 Jahre, nämlich von 1939 bis zum Februar 1983! Bis zu diesem Zeitpunkt stempelte man ihm bei jeder Einreise ins Vereinigte Königreich jeweils die Anweisung in seinen Pass, dass er nicht länger als 2 Wochen bleiben dürfe. Ich frage mich nicht nur, wie es zu dieser Paranoia kommen konnte, sondern auch, ob es nicht Wichtigeres für diese Institution gegeben hat, als die Bewegungsprofile eines nachweislich unschuldigen, politisch nicht aktiven und über jeden Verdacht erhabenen Menschen – noch dazu deutscher Nationalität – aufzuzeichnen und zu überwachen!
Jedenfalls befanden wir uns nun nach äußerst bewegten und aufregenden Zeiten auf dem Weg nach England. Professor Bumm hatte darauf bestanden, uns seinen Mercedes 300, den sogenannten „Adenauer“ - Mercedes mitsamt Chauffeur für die Fahrt zum Düsseldorfer Flughafen zur Verfügung zu stellen. Und so saßen wir in den blauen Samtfauteuils dieser Luxuslimousine und rauschten zum Flughafen nach Lohausen. Dort sah uns eine in Duisburg lebende Cousine meiner Mutter von der Besucherterrasse aus, wo sie sich zufällig mit ihrem Sohn aufhielt, dem sie den Flughafen zeigen wollte, aus dem Auto klettern und wie unser Chauffeur Herr Krimann in grauer Uniform unser Gepäck in den Flughafen schleppte. Sie verbreitete daraufhin das Gerücht, wir hätten offenbar im Lotto gewonnen und seien jetzt „reich“ – ein Gerücht, das sich jahrelang hartnäckig hielt und der Wahrheit nicht weniger hätte entsprechen können. Doch halt: reich waren wir ja eigentlich, denn wir waren eine glückliche Familie, und wirtschaftlich ging es auch aufwärts - das Wirtschaftswunder der Fünfzigerjahre hatte auch an unsere Haustür geklopft.
Nun flog ich also sechs Jahre später zum zweiten Mal – diesmal mit einer Viscount der Lufthansa. Kurze Zeit vor unserem Flug, den mein Vater und ich am 27. Dezember 1960 antraten, hatte es mehrere Flugunfälle und Abstürze gegeben, was zu einem massiven Rückgang der Passagierzahlen führte. Demzufolge war das Flugzeug fast leer. 1960 – das war noch Jahre vor den ersten Flugzeugentführungen, und die Welt hatte ihre Unschuld sozusagen noch nicht verloren. Daher durfte ich das Cockpit aufsuchen und mich zwischen die beiden Piloten stellen. Der Kapitän erklärte mir alles, was ich wissen wollte, und mit Sicherheit war es auch auf diesem Flug, dass meine Flugbegeisterung weiter angekurbelt wurde und dass ich mir den „Bazillus Aviaticus“, wie die Flieger sagen, einfing – der mich im Übrigen nie mehr loslassen sollte. Denn noch heute schaue ich Flugzeugen hinterher, und immer wieder fasziniert mich die Physik eines Flugzeuges, das mit seinen Riesengewichten die Kräfte der Erde überwindet und sich in die Lüfte erhebt. In meinem Lied „Nimm mich mit“ habe ich viele Jahre später versucht, das zum Ausdruck zu bringen, und insofern ist jede Zeile dieses Songs auch heute noch absolut authentisch. Der alte Traum vom Fliegen – ich finde, er hat noch nichts von seiner Faszination eingebüßt, und wenn ich heute ein Flugzeug besteige, dann liebe ich alles daran bis hin zu seinem Geruch. Der mag heute etwas klinischer und neutraler geworden sein; in früheren Jahren rochen, nein: dufteten Flugzeuge nach Öl und Kerosin, nach Leder auch und den verarbeiteten Metallen – ähnlich einem alten Auto, einem Oldtimer – die riechen nämlich ganz ähnlich. Überhaupt die Gerüche – ich richtete mir meinen Mikrokosmos schon als kleines Kind nach olfaktorischen Gesichtspunkten ein. Ich erwähnte ja schon meine Begeisterung für Landluft. Aber auch bei alltäglichen Dingen spielte der Duft für mich eine entscheidende Rolle. Meine Eltern erzählten immer, dass ich schon als Kleinkind an jedem Spielzeug immer erst schnupperte, bevor ich mit ihm spielte. Und wenn der Duft mir nicht passte, dann rührte ich es nie wieder an! Als mein Vater irgendwann mit einem nagelneuen VW Käfer nach Hause kam, setzte ich mich so manches Mal nachmittags einfach ins Auto, nur um mich am Duft des Neuwagens zu ergötzen. Damals dufteten Autos ja noch – zumindest nahm ich den Geruch immer als Duft wahr. Heute erzählt man mir, dass diese Düfte immer schon synthetisch waren und dass man heute auf vielfachen Kundenwunsch darauf verzichtet – was mir sehr Leid tut, denn diese Cuvée von frischem Lack, von Ölen und Gummimatten, Leder oder Polsterstoffen fand ich immer absolut betörend. Mit dieser Wahrnehmung bin ich offenbar nicht alleine, denn in Amerika sind mittlerweile Sprays im Handel, die – einmal im Auto versprüht - die Illusion eines Neuwagens vermitteln sollen – zumindest, was dessen Geruch angeht!
Meine ersten 4 Schuljahre verliefen relativ reibungslos. Ich war in diesen Jahren immer Klassenbester – vielleicht könnte man aber auch sagen: Einäugiger unter Blinden, denn das allgemeine Niveau war eher rustikal. Die Lehrerin sagte meinen Eltern, dass sie sich nur bei zwei Schülern sicher sei, dass sie das Zeug zum Abitur hätten, und das war neben mir meine spätere erste Liebe Christel. Doch bis dahin dauerte es noch ein paar Jahre…
1960 wurde ich nach bestandener Aufnahmeprüfung in das Staatliche Dreikönigsgymnasium, die älteste Kölner Jungenschule, eingeschult. Mama hatte mich dort angemeldet, weil das DKG, wie es bis heute genannt wird, damals in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ursulinenschule lag, einer Klosterschule für Mädchen, auf die meine Schwester Sylvia ging. Das DKG war hingegen eine reine Jungenschule. Dadurch konnten wir beide zusammen zur Schule gebracht, bzw. abgeholt werden und den Schulweg miteinander unternehmen, wann immer es möglich war.
Vielleicht lag es an meinem knallroten Blazer, den ich an meinem ersten Tag im Gymnasium trug – vielleicht auch daran, dass ich die Klasse gleich nach einer Stunde wechselte – man suchte einen Freiwilligen, der wechseln wollte, weil eine Klasse zu groß und die andere zu klein war, und ich hatte mich gemeldet – jedenfalls wurde ich gleich an diesem Tag zum Klassensprecher gewählt, und das blieb ich fast die gesamte Zeit bis zum Abitur. Wir waren in der Sexta mehr als 40 Schüler; beim Abitur waren es dann noch 25, aber dazwischen lagen lange Jahre, die aus heutiger Sicht spielerisch an mir vorbeizogen. Aber ich weiß sehr wohl, dass ich während meiner Schulzeit die ersten Kontakte zum Stress erlebte, Schulstress und auch Frust. Bis zu meinem Beginn als Gymnasiast hatte mir die Schule keinerlei Probleme bereitet, und ich hatte mich auch nie besonders engagieren oder anstrengen müssen, um das Klassenziel zu erreichen. Doch jetzt waren Fächer wie Latein und Mathematik hinzugekommen – Fächer, für die ein wenig Fleiß nicht schlecht gewesen wäre. Doch ich war ein ziemlich faules Kind, und dementsprechend waren meine schulischen Leistungen dann auch eher mittelmäßig – außer in Englisch, denn da war ich immer mit großem Abstand Klassenbester. Und wenn ich mal mit einer schlechteren Note als einer zwei in einer englischen Klassenarbeit nach Hause kam, dann gab es von Seiten meiner Mutter ziemlichen Zoff. Für eine Eins hingegen gab es eine Belohnung von zwei Mark, für eine zwei immerhin noch eine Mark.
Ich entwickelte früh einen gewissen Geschäftssinn. Wenn die Einnahmen, die ich mit meinen Klassenarbeiten erzielte, auch relativ bescheiden waren, so fanden sich doch immer wieder kleinere Jobs, mit denen sich mein Taschengeld aufbessern ließ. Einer dieser Jobs war das Waschen von Autos. Das geschah mit einem Schwamm und einem Eimer Wasser, im Pferdestall nebenan fand sich ein Schlauch, und so wusch ich an den Wochenenden des öfteren das Auto meiner Eltern. Dafür gab es 3 Mark, später 4, was nicht schlecht war, denn für ein Auto benötigte ich eine gute Stunde. Die Reiter, die an den Wochenenden kamen, um ihre Pferde zu bewegen, sahen mich dann beim Autowaschen, und so manches Mal wurde ich gebeten, auch ihre Autos zu reinigen. So kam ich an manchen Wochenenden auf über 10 Mark, damals für mich eine Menge Geld. Einer der Reiter war ein gewisser Herr Dachser, der Inhaber der internationalen Spedition gleichen Namens – damals schon eine der größten in der Bundesrepublik. Dachser war ein untersetzter, stämmiger kleiner Mann, und er fuhr einen cremefarbenen Mercedes 190 SL mit roten Ledersitzen. Als er mich sah, kam er zu mir und fragte mich, ob ich ihm sein Auto waschen wollte. Ich sagte nur zu gern zu, denn bei einem so wohlhabenden Mann war ja mit einem dicken Aufgeld zu rechnen – und so nah an ein solches Traumauto zu kommen, sich vielleicht einmal da hineinsetzen – ich machte ja auch eine Innenreinigung – fand ich aufregend. Ich gab mir dann auch große Mühe, polierte die verchromten Spiegel besonders sorgfältig und achtete peinlich darauf, dass auch der Innenraum blitzsauber war. Ich nahm mir viel mehr Zeit als sonst – obwohl das Auto ja nur halb so groß war die Ford Taunus oder Opel Rekord, die ich sonst so wusch.
Als Dachser von seinem Ausritt zurückkam, präsentierte ich ihm stolz sein blitzsauberes Auto, das aussah, als sei es gerade erst zugelassen worden. Er inspizierte es sehr ausgiebig und griff dann in die Tasche, aus der er eine 50 Pfennig Münze hervorzauberte, die er mir gab mit dem Kommentar „ich hab‘ auch mal klein angefangen!“ Meine Wut war grenzenlos, und mir stiegen die Tränen in die Augen. Doch dies war mir eine Lehre – und künftig nannte ich immer meinen Preis, bevor ich einen Job annahm. Übrigens denke ich noch heute jedes Mal, wenn ich einen LKW von Dachser überhole, an den damaligen geizigen Chef der Firma – und die Sympathiewerte haben sich nicht verändert!
In der Sexta lernte ich meinen ersten Freund kennen, einen ziemlich dicken Jungen, dessen Eltern in Köln – Merkenich eine Bäckerei besaßen. Die Schule hat mich auf jeden Fall geformt und mir natürlich das an Bildung vermittelt, das ich mitnahm in mein späteres Leben. Aber einen ebenso großen Gewinn, den ich von dort mit hinausgenommen habe in mein Leben, war und ist die Freundschaft mit Karl–Heinz, dem dicken Jungen aus der Sexta, der sich heute Carlo nennt und noch heute mein engster Freund und Vertrauter ist. Längst ist er nicht mehr dick, und man kann sagen, dass wir in den vergangenen 60 Jahren miteinander durch Dick und Dünn gegangen sind. Als Junge war ich nicht sonderlich sportlich. Ich hatte auch überhaupt keinen Spaß an Bodenturnen oder Leichtathletik, und so versuchte ich, mich vor diesen Disziplinen zu drücken. Dazu war ein Besuch beim Schul- oder Amtsarzt jedoch unerlässlich. Ich hatte jedoch damals eine panische Angst vor Ärzten, und ich weiß noch, dass ich es mir reiflich überlegte, ob ich mich wirklich vom Sport befreien lassen sollte oder nicht. Doch Karl-Heinz war wegen seiner Leibesfülle bereits vom Fach ‚Leibesübungen(!)‘ befreit, und so wagte ich den Gang zu einem Kölner Schularzt. Meine Eltern wussten von all dem natürlich nichts. Als ich schließlich zum Gesundheitsamt am Neumarkt ging, war ich derart aufgeregt, dass ich gar nicht den vielen Kaffee hätte trinken müssen, um mein Attest zu bekommen, so schnell schlug mein Herz. Ich musste mich nackt ausziehen, der Arzt berührte mich an meinen intimsten Stellen, offenbar um festzustellen, ob ich eventuell eine Phimose hatte. Wozu er das bei meinen vorgeblichen Beschwerden, nämlich einem zu schnellen Herzschlag, wissen wollte, weiß ich bis heute nicht, ich kann es nur vermuten, aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Zumal ein weiterer Mitschüler beim selben Arzt demselben Handgriff unterzogen wurde. Jedenfalls attestierte er mir schließlich eine akute Tachycardie mit der Neigung zu Herzrhythmusstörungen, also einen viel zu schnellen Herzschlag und befreite mich mit sofortiger Wirkung vom Sport. Das bedeutete alle zwei Wochen einen gewonnenen freien Nachmittag, denn donnerstagnachmittags fand im 14-Tage-Rhythmus der Sportnachmittag statt – meist draußen im Stadion oder in einem Park. Und da Karl-Heinz und ich vom Sport befreit waren, gingen wir stattdessen fast immer ins Kino, manchmal auch gleich zwei Mal hintereinander. Er erzählte seinen Eltern dann immer, er sei bei mir zu Hause, während ich meinen Eltern erzählte, ich sei bei ihm zu Hause. Unsere Eltern haben die Wahrheit nie erfahren – zum Glück, denn ich glaube, die Strafen wären – wohl zu Recht - wahrscheinlich ziemlich drastisch ausgefallen!
Wir besuchten einander recht häufig – aber eigentlich besuchte ich Karl-Heinz öfter als er mich. Denn bei ihm zu Hause genossen wir mehr oder weniger absolute Freiheit. Seine Mutter stand von früh bis spät hinter dem Tresen der Bäckerei, während sein Vater, ein sehr fleißiger kleiner Mann, morgens um 4 seinen Arbeitstag begann und wenig später bereits in der Backstube stand. An den Wochenenden fuhr er mit seinem Opel Rekord Caravan „Teilchen“ verkaufen, so dass er eigentlich nie einen Ruhetag hatte. Abends gingen er und seine Frau daher immer schon gegen 20 Uhr ins Bett – und dann fing für Karl-Heinz und mich der Abend ja gerade erst an! Fernsehen war damals noch nicht so angesagt (im Gegensatz zu meinen Eltern hatten sie immerhin schon ein Gerät!), aber das Programm endete ja meist um 23 Uhr oder Mitternacht mit dem Testbild.
Manchmal zogen wir nachts auch durch Merkenich. Wir liefen einfach durch den Ort, achteten dabei allerdings immer darauf, dass uns niemand sah. Einmal kletterten wir über Gerüste hinauf auf die noch im Bau befindliche Leverkusener Autobahnbrücke, an der es noch keine Geländer gab und von der wir dann einen Sack Zement von ganz oben in den Rhein warfen, wobei wir darauf achteten, dass er nicht etwa auf einem unter uns dahinziehenden Schiff landete.
Oder wir verzogen uns ins Wohnzimmer. Dies war das größte Zimmer im Haus und wurde tatsächlich nur an besonderen Feiertagen benutzt. Es lag zur Straßenseite hin, während die Schlafzimmer hinten zum Hof ausgerichtet waren. Wir waren also ungestört und konnten laut Musik hören. Ich weiß noch, dass der Weihnachtsbaum bis kurz vor Ostern in diesem eisigen Raum stehenblieb und kaum nadelte, denn es wurde hier praktisch nie geheizt. Und wenn es doch einmal etwas wärmer sein sollte, entzündeten wir einen kleinen Ölofen in der Ecke. Normalerweise setzten wir uns, jeder in eine Decke gehüllt, einander gegenüber und tranken im Laufe der Nacht eine oder auch mehrere „Familienflaschen“, also große Flaschen Coca Cola aus, die wir im Laufe der Nacht dann wieder halbvoll pinkelten, da der Weg zur Toilette über knarrende Dielen und durch quietschende Türen am elterlichen Schlafzimmer vorbeiführte. Und seine Eltern wollten wir ja unter keinen Umständen wecken! Weiß der Himmel, was wir uns in diesen Nächten alles erzählt haben – ich kann es heute nicht mehr nachvollziehen. Uns ist jedenfalls nie langweilig geworden. Vielleicht rührt auch aus diesen langen Nächten unser bis heute erhaltenes tiefes Verständnis her, wer weiß!
Manchmal lasen wir auch eine Messe – einer war Priester, der andere der Ministrant. Als Kostüme dienten uns Tischdecken oder Betttücher. Wenn ich mich recht erinnere, lasen wir aber nie eine Messe zu Ende, weil wir irgendwann vor Lachen nicht weiterkamen. Und wir hörten – ich erwähnte es ja bereits – Musik. 1965 erschien „Siebzehn Jahr‘, blondes Haar“ von Udo Jürgens. Und diese Scheibe drehte sich in mancher Nacht in Merkenich stundenlang auf dem Plattenteller! In diesen Nächten schmiedete ich offenbar die Musik von Udo Jürgens um mein Herz. Auf jeden Fall wurde ich wohl so etwas wie ein glühender Fan dieses Musikers, und das hatte ich mit zahllosen Gleichaltrigen gemeinsam.
Nicht zu vergessen war das Frühstück in Merkenich. Neben den Eltern Kappes arbeiteten und wohnten mehrere Bäckergesellen im Haus. Für alle gab es um 6:30 Uhr immer ein großes Frühstück. Der köstliche Duft von Kaffee und frischgebackenem Brot war da schon seit Stunden durchs Haus gezogen. Nach dem Frühstück nahmen Karl-Heinz und ich den Bus in die Schule. Doch an einem dieser Tage muss das Frühstück – aus welchem Grund auch immer – besonders gut gewesen sein. Es kam immer ein Riesenkorb mit dampfenden Brötchen direkt aus der Backstube auf den langen Tisch in der Essküche, dazu gab es Butter, frische Wurst, Käse, selbstgemachte Marmeladen und Rübenkraut. Ich mag es selber kaum glauben, aber an einem Morgen verdrückte ich ganz alleine sage und schreibe 11 ½ Brötchen – mit Butter, Marmelade und Rübenkraut! Ich kenne niemanden, der so etwas geschafft hätte – weder damals, noch heute. Den Bus verpassten wir übrigens!
Fast jeder in meiner Klasse hatte einen Spitznamen. Das ging von „dä Deck“ (der Dicke) über Yogi, Wuzz usw. in alle Richtungen. Ich wurde eine Zeitlang „Casey“ genannt – nach der Fernsehserie „Casey Jones, der Lokomotivführer“. Aber das hielt nicht lange an, und ich blieb eigentlich immer „der Jones“, manchmal auch so gesprochen, wie man es schreibt. Von Seiten der Lehrer war ich in dieser Hinsicht ohnehin Ungemach gewohnt, da nicht alle Lehrer des Englischen mächtig waren. Da hörte ich dann schon mal „Schonns“, oder Schonnes“, Johns (deutsch gesprochen!) und vieles mehr.
Ein Junge in meiner Klasse, Norbert Mertens, wurde „Führer“ genannt. Er war nach außen ein strammer Rechter, aber das täuschte und war offenbar nur eine Fassade, die er vor sich hertrug. In Wirklichkeit war Norbert ein in sich gekehrter tief religiöser Mensch, aber das wussten wir damals nicht. Er erzählte mir, dass er in einer „Hausaufgaben - Gemeinschaft“ sei und lud mich ein, da doch mal mit hinzukommen. Meine Leistungen in der Schule ließen in diesem Jahr ohnehin zu wünschen übrig, und ich sagte daher gerne zu und fuhr irgendwann zum ersten Mal in die alte Jugendstilvilla nach Köln Lindenthal, in der diese Gruppe arbeitete. Norbert verbrachte jeden Nachmittag dort – Schulaufgaben wurden unter der Aufsicht von Studenten gemacht, die uns jederzeit helfen konnten, wenn wir nicht weiterwussten. Und es gab ständig mehrere Priester im Haus – junge Männer, die meisten aus Spanien. Einer, Pater Martinez, genannt Don Jesus (spanisch gesprochen), war besonders freundlich und beliebt. Man blickte zu ihm auf, obwohl er in meiner Erinnerung kleiner war als wir, und er war ein hervorragender Motivator und ein sehr warmherziger, empathischer Mann. Er führte längere Gespräche mit mir, und so langsam wurde mir klar, wo ich da gelandet war – das Haus gehörte der katholischen Kirche und wurde vom Opus Dei geführt, dem man zumindest damals nachsagte, dies sei so etwas wie ein Geheimdienst der Kirche. Die Hausaufgabengruppen waren damals auch ein Mittel, um Nachwuchs für das „Werk Gottes“, was „Opus Dei“ übersetzt heißt, anzuwerben. Man begrüßte sich mit „Pax“, und der Begrüßte erwiderte den Gruß mit einem „in aeternum“, also: Friede in Ewigkeit. Vollmitglieder lebten priesterähnlich im Zölibat, gingen aber weltlichen Berufen nach und brachten sich irgendwie im Werk ein. Und es gab auch Halbmitglieder, die nicht im Zölibat leben mussten. Das Opus hatte es bald auf mich abgesehen, und die Gespräche mit Don Jesus führten immer wieder in diese Richtung. Norbert war bereits Vollmitglied, und auch er versuchte mich von meinem Heilsweg zu überzeugen, der mich als Vollmitglied erwarten würde. In diesem Jahr verfehlte ich das Klassenziel, wurde also nicht versetzt, was damals eine ziemliche Schande war – und heute muss ich sagen, es war in der Tat eine Schande, denn dass ich nicht versetzt wurde, lag ganz allein an meiner unglaublichen Faulheit! Das Opus, in dem ich zu der Zeit regelmäßig verkehrte, konnte den Negativtrend dann doch nicht mehr umkehren, dazu war ich wohl zu spät dazugestoßen.
Man hatte dort für die Hausaufgabengruppe eine Osterfahrt nach Rom organisiert, auf die sich alle natürlich mächtig freuten. Als klar war, dass ich das Klassenziel nicht erreichen würde, zogen meine Eltern die Erlaubnis zu dieser Osterfahrt zurück – irgendwie sollte ich schließlich für meine schlechten Leistungen bestraft werden. Da kam dann doch noch einmal Don Jesus ins Spiel, denn er lud meine Eltern in das herrschaftliche Haus nach Lindenthal ein und besprach sich lange mit ihnen. Und offenbar hinterließ er einen derart positiven Eindruck bei Mama und Daddy, dass ich dann doch mitfahren durfte in die Ewige Stadt.
Es ging mit dem Zug in etwa 20 Stunden von Köln nach Rom. Dort standen die üblichen Besichtigungsprogramme an, sowie die Entgegennahme des österlichen Segens durch den damaligen Papst Paul VI auf dem Petersplatz. Das war dann schon anstrengender, denn der Rummel dort erinnerte mich ziemlich an den Kölner Rosenmontagszug. Jeder Ländergruppe wurde eine Fläche zugewiesen, so dass alle Ausländer jeweils mit ihren Landsleuten zusammenstanden. Das riesige Areal war gefüllt mit einer unüberschaubaren Menge von friedlichen und gutgestimmten Menschen - es gab damals noch nicht die Ängste, die bei solchen Versammlungen im 21. Jahrhundert aufkommen sollten.
In Rom erfuhr ich auch von der Kraft und der Wirkung der Musik. Einer unserer Schüler, Michael Kürten, ein Neffe meines späteren Musiklehrers Gerold Kürten (der Mann meiner Klavierlehrerin), hatte einen ausgeprägten Bariton und konnte jede Menge italienischer Arien singen wie ein Opernsänger, und so manches Mal unterhielt er uns mit seiner Kunst. Das war dann für uns Zuhörer durchaus exotisch, denn wir zählten ja nicht unbedingt zu den klassischen Hörern von Opern! Wir wohnten am Stadtrand von Rom in einem von Nonnen geführten Kloster, wo es feste Essens- und Ruhezeiten gab. Gefrühstückt wurde jeweils von 7 – 8, Mittagessen um 12, und Abendessen um 18 Uhr. Die Pforte wurde um 22 Uhr geschlossen, und wir wurden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nach 22 Uhr keinen Einlass geben werde, und wer zu spät komme, der müsse die Nacht halt draußen verbringen – was nicht unbedingt erstrebenswert war, denn auch in Rom können die Aprilnächte durchaus kühl, wenn nicht kalt sein. Aber Wissen war eines, Tun etwas anderes. Und eines Abends kamen wir tatsächlich erst eine gute Zeit nach 22 Uhr am Kloster an. Dabei waren wir nicht etwa irgendeinem unseriösen Zeitvertreib nachgegangen – wir hatten ja ständig eine oder auch mehrere Aufsichtspersonen dabei – Studenten, die Mitglieder des Opus Dei waren, und da wäre ein Zug durch Roms Kneipen ohnehin nicht angesagt gewesen! Wir hatten uns halt irgendwie verschätzt, was die lange Busfahrt in den Vorort von Rom betraf, und nun standen wir vor einer fest verschlossenen Tür. Auf unser Läuten erfolgte – wie erwartet – keinerlei Reaktion. Wir schlichen uns daraufhin um das Kloster herum, um zu sehen, ob es nicht irgendwo eine Stelle gab, an der wir die hohe Mauer, die das Kloster und seinen großen Garten einfriedete, überwinden konnten. Doch da war nun einmal nichts zu machen. Wir standen also ziemlich ratlos auf der Straße und wussten nicht weiter. Da fing unser Sänger Michael plötzlich an, aus Leibeskräften das Ave Maria von Franz Schubert zu singen. Ich weiß nicht, ob er im Sinn hatte, die Nonnen damit zu wecken, oder ob er es einfach sang, um uns zu unterhalten und bei Stimmung zu halten. Doch er hatte kaum den ersten Durchgang beendet, als oben im Haus ein Licht anging. Und wenig später drehte sich ein Schlüssel in der Eingangstür und – was Wunder! – uns wurde geöffnet! Hinter der Tür standen mehrere Nonnen in ihren langen weißen Nachthemden, teils belustigt, eine oder mehrere waren in Tränen aufgelöst, und man bat Michael, eine Zugabe zu geben. Dieser Aufforderung kam er gerne nach, und so konnten wir dann doch noch in unseren Betten schlafen. Am nächsten Tag sagten uns die Nonnen, dass noch nie die Tür nach 22 Uhr geöffnet worden war, aber bei den Klängen des Ave Maria sei ihnen das Herz übergelaufen und der Herr habe die Hand mit dem Schlüssel gelenkt! Von diesem Tag an musste Michael jeden Abend vor dem Zubettgehen singen. Ich war mir damals ziemlich sicher, dass es nicht der Herr war, der uns aufgeschlossen hatte, sondern die Musik hatte ganz einfach ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie hatte eine Tür geöffnet!
Nach der Rom – Reise ließ mein Kontakt zum Opus Dei nach, denn ich war ja nicht versetzt worden, und in meiner neuen Klasse, der Obertertia, die ich ja nun zum 2. Mal machen ‚durfte‘, waren meine Leistungen schließlich absolut korrekt. Ich brachte gute bis sehr gute Noten nach Hause, und die Hausaufgabenüberwachung war nicht mehr erforderlich. Außerdem schien mir ein Leben im Zölibat, wie man es von mir erwartet hätte, wäre ich jemals Mitglied geworden, nicht nur wenig erstrebenswert, sondern völlig unmöglich. Ich war mit meinen 14 oder 15 Jahren gerade in der Pubertät, und unter den Hormonstürmen eines aufwachenden Jungen gingen meine Interessen und Intentionen genau in die dem Zölibat entgegengesetzte Richtung!