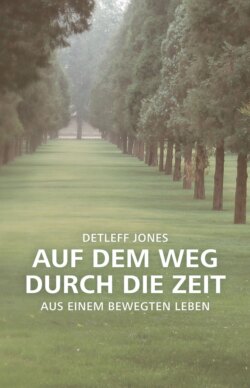Читать книгу Auf dem Weg durch die Zeit - Detleff Jones - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Ernst des Lebens
ОглавлениеNach dem Abitur hatte ich eine kurze Verschnaufpause, bevor ich am 1. Oktober 1969 zur Bundeswehr musste. Diese Pause hatte ich für eine zweimonatige Reise kreuz und quer durch die USA genutzt; mit Greyhound Bussen war ich von Küste zu Küste gereist, hatte Verwandte in Kanada und in Oklahoma besucht und gesehen, was ich mir hatte ansehen wollen. Doch dann begann – wie meine Mutter mir ja immer prophezeit hatte - der Ernst des Lebens….
Ich habe ja bereits erzählt, dass ich meine Probleme hatte mit Geschwindigkeit beim Essen und dass ich als Kind ziemlich herumgetrielt hatte. Das sollte sich beim Bund sehr schnell ändern. Gleich bei meiner Ankunft erlebte ich den Wechsel von 2 Monaten Freiheit in den USA zum Schützen Arsch – einen Wechsel von heiß auf kalt – sehr kalt! Da ich am allerersten Tag einem Unteroffizier meinen Namen nicht laut genug sagte, musste ich etwa 50 Meter weit bis ans Ende eines Flurs rennen („Laufschritt, Mann!“) und ihm von dort meinen Namen herüberschreien - na, das fing ja toll an!
Die Grundausbildung bei der Bundeswehr – 1969 dauerte sie noch 3 Monate – verbrachte ich in Goslar im Harz. Natürlich lebte ein kleines Stück der Erinnerungen an die Warnung, bzw. die Drohungen meiner Eltern in mir weiter („warte nur, bis du zum Militär kommst…“). Dort war ich aber auch nur einer von vielen – und die hatten fast alle ähnliche Anfangsprobleme mit dem Drill und dem strammen Ton, der dort herrschte. Doch auch, wenn man vieles in der Vergangenheit Erlebte oft und gern idealisiert und in der Erinnerung schöner färbt, als es in Wirklichkeit war („damals war alles besser!“), behaupte ich doch, dass die 3 Monate der Grundausbildung zu den wichtigsten in meinem Leben gehören und auch zu denen, an die ich heute sehr gerne zurückdenke. Denn ich erlebte dort etwas, das ich bis dahin noch nie gekannt hatte: Kameradschaft – etwas anderes als Freundschaft. Man stand füreinander ein – unabhängig davon, ob man sich kannte oder gar mochte, trotz eigentlich unüberbrückbarer Unterschiede, was Bildung und Ausbildung sowie Intellekt anging, und man erlebte eine Gemeinsamkeit, aus der eine große Stärke wuchs. Ich weiß nicht, ob dies ein beabsichtigtes Element in der Ausbildung von Soldaten ist (ich kann es nur hoffen!), aber es stellt sich ganz einfach ein, wenn man eine Gruppe von jungen Männern einem gewissen Druck aussetzt, in dem sie sich zu behaupten lernen, in dem sie auch lernen, miteinander umzugehen und sich bei Laune zu halten. Ich wohnte in einer „Stube“ mit drei „Kameraden“ – alle vier entstammten wir aus völlig unterschiedlichen sozialen und intellektuellen Verhältnissen, aber gerade diese Verschiedenheit erforderte einerseits eine hohe Toleranz und andererseits ein Aufeinander - Zugehen. Ich war ja eigentlich ein verwöhntes Einzelkind – war meine Schwester doch fast 4 Jahre älter als ich. Verwöhnt von Mutter und Oma – bei jedem Wehwehchen war jemand dagewesen, der mich als Kind getröstet hatte, und die meisten Konfrontationen waren von mir ferngehalten worden. Doch hier in Goslar musste ich sehen, wie ich zurecht kam – hier war ich auf mich selbst gestellt – und das zum ersten Mal überhaupt, aber in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten.
Gleich zu Beginn meiner Grundausbildung wurden Soldaten gesucht, die ein Instrument spielen konnten. Nach einigem Zögern (jemand anderes war doch sicherlich viel besser als ich) und nachdem sich niemand sonst gemeldet hatte, meldete ich mich, und ruckzuck wurde ich Mitglied einer Band. Wir nannten uns „Hot Dogs“, hielten regelmäßige Übungsabende im Keller ab und spielten die Hits der 60er rauf und runter. Es gab einen Gitarristen, einen Bassisten, einen Schlagzeuger, einen Sänger und mich an einer Philips Heimorgel – einem winzigen Keyboard. Wenn mich meine Mitspieler fragten, ob ich einen bestimmten Titel kenne - etwa „kennste ‚Venus‘?“ musste ich immer verneinen. Denn ich kannte so gut wie kein Lied mit seinem Titel. Wenn ich es allerdings hörte, wusste ich gleich, was gespielt werden sollte. Alle hatten ihre Noten – außer mir; ich spielte alles nach Gehör – Noten hätte ich damals schon gar nicht mehr lesen können!
Kurz vor Weihnachten spielten wir dann auf mehreren Kompaniefesten und –bällen. Wir hatten auch ein Lied drauf, das ich komponiert hatte: „Herbstwind“; der Text war von Ralf Siegel senior, dem Vater des „Schlager – Siegel“. Der Text hatte es mir angetan, und so hatte ich eine Melodie dazu geschrieben. Dies war wohl das erste Lied aus meiner Feder, das öffentlich aufgeführt wurde.
Und dann hatten wir nach einem unserer Auftritte in der Vorweihnachtszeit ein kleines Erlebnis, das mir und auch den anderen Musikern eine Gänsehaut bereitete. Es lag tiefer Schnee, und wir kamen sehr spät zurück in die Kaserne, hatten unsere Instrumente noch im Übungskeller verstaut und trafen uns dann auf ein letztes gemeinsames Bier im Lichthof am Ende des Flures, übrigens genau dem Lichthof, von dem aus ich wenige Wochen zuvor einem Unteroffizier noch meinen Namen hatte zubrüllen müssen! Dort hing ein großer Adventskranz. Wir entzündeten seine Kerzen, und irgendwann fing einer von uns an, „Stille Nacht“ zu singen. Die anderen vier fielen gleich ein, und so standen wir da im Schein der vier Kerzen, eine Flasche Bier in der Hand und sangen à capella fünfstimmig Weihnachtslieder (die wir im Übrigen nie geübt hatten!). Nach kurzer Zeit ging eine Tür nach der anderen auf, und unsere Kameraden standen in Schlafanzügen auf dem langen Flur und forderten Zugaben. Und ich sah bei vielen Tränen der Rührung. Ich bekomme noch heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, eine Gänsehaut, wenn ich an diese Momente denke.
Zum Jahresende erfolgte meine Versetzung nach Köln an den Flughafen Wahn, wo ich den Rest meiner Wehrzeit ableisten sollte. Und wieder hatte ich großes Glück – normalerweise kam man, das hatte man mir gesagt, erst einmal zum Wachbataillon, was nichts anderes bedeutete, als dass man ständig Bereitschaften hatte, sich nachts an einem der Kasernentore die Füße plattstehen und Wache schieben musste. Ich jedoch kam sofort zur Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, was damals so etwas wie eine kleine private Fluggesellschaft war. Seit meiner frühen Kindheit war ich verrückt nach Flugzeugen, und allein die Nähe zu den großen Silbervögeln bereitete mir Herzklopfen. Die Flugbereitschaft verfügte damals über eine recht ausgedehnte Flotte, zu der vier Langstreckenflieger vom Typ Boeing 707, mehrere Hansajets HFB 320, Lockheed Jetstars C 140, sowie sechs Convair 440 Propellermaschinen gehörten. Eine davon – wenn ich mich recht erinnere, war es das Flugzeug mit der Nummer 1204, hatte Gerüchten zufolge einmal Frank Sinatra gehört, dem man eine Schwäche für Flugzeuge nachsagte. Er hatte sie zeitweise John F. Kennedy für dessen Wahlkampf zur Verfügung gestellt – ein recht illustres Flugzeug also. Und so sah es auch aus: es gab mehrere geschwungene und halbrunde, mit goldfarbenem Stoff bezogene Sofas und Beistelltische, viel Chrom und Gold, und beim Fliegenden Personal hatte das Flugzeug den Spitznamen „Fliegender Puff“. Es wurde bevorzugt für VIP’s eingesetzt – also das höchste politische Personal aus dem In- und Ausland.
Ich war in dieser Einheit so etwas wie ein Auszubildender – und zwar einer ohne große Jobaussichten, da ich mich ja nicht für längere Zeit bei der Bundeswehr engagieren wollte. Daher wurde ich erst einmal im Büro eingesetzt, wo ich Flugaufträge zu schreiben hatte, die große abwaschbare Plastiktafel beschreiben musste, auf der die Flüge des Tages aufgeschrieben wurden mit Flugzeugnummer, Besatzung, Namen der Fluggäste, Abflugzeit und Ziel. Oder ich musste die riesigen Flugkarten falten – nach einem bestimmten System, bei dem ich mir immer fiese Schnitte an Fingern und Händen zuzog. Man kann aber wirklich nicht sagen, dass ich mich überarbeitet hätte. Es gab dort auch eine kleine Kantine, in der man ein Tagesgericht essen konnte oder Kleinigkeiten wie Rühreier oder Bockwurst o.ä. Die in dieser Kantine Beschäftigten waren ausschließlich Zeitsoldaten, die meisten in meinem Alter, die auch als Kabinenbesatzung sämtliche Flüge mitmachten – als Stewards auf Kurz- und Langstreckenflügen. Die Flugbereitschaft transportierte etwa Familienangehörige nach Texas, wo u.a. ein Teil der Pilotenausbildung stattfindet, aber auch Staatsgäste, Minister, Bundeskanzler und –präsident waren ständige Gäste an Bord. Ich sah diese illustren Personen zum ersten Mal aus allernächster Nähe, wenn sie an unserem Büro vorbeiliefen zum Flugzeug, das draußen auf sie wartete. Und ich durfte sogar an Bord – um sauber zu machen, Sitzgurte ordentlich auszulegen, und um die Kopflätzchen, die nach jedem Flug ausgewechselt wurden, anzubringen und um die Galley zu bestücken. Und wann immer ich konnte, schaute ich voller Sehnsucht und Fernweh den Flugzeugen hinterher, wenn wie zum Start rollten. Bis ich eines Tages einen Entschluss fasste, mich beim Staffelkapitän anmeldete und um ein Gespräch bat. Jürgen Reiss war sein Name, übrigens gleichen Namens wie unser Gitarrist in Goslar - und er war Oberstleutnant. Und nicht nur das – er war auch Kapitän auf der Boeing 707 und ein überaus freundlicher Mensch. Ich erzählte ihm von meiner Lust am Fliegen und fragte ihn, ob man nicht eine Ausnahme machen und mich als Steward einteilen könnte. Meine Flugbesessenheit schien ihm zu gefallen, denn nach ein paar Tagen Bedenkzeit, die er sich ausbedungen hatte, bekam ich eine Mitteilung, dass ich in Kürze ein Sicherheitstraining zu absolvieren habe - mit dem Ziel, als Steward auf ausgesuchten Strecken eingesetzt zu werden. Ich konnte mein Glück kaum fassen! Das Security Programm wurde dann auch zügig durchgeführt – ich musste lernen, wie man eine Notrutsche und die Notausgänge an den verschiedenen Flugzeugmustern betätigt, und ich lernte in einem Schnelllehrgang innerhalb weniger Tage, was ich für meinen neuen Job wissen musste. An einem Freitagnachmittag kam ich von diesem Lehrgang wieder zurück in meine Einheit – diesmal in die Kantine, denn als Steward wurde ich nicht mehr im Büro, sondern in der Kantine eingesetzt, wenn ich nicht fliegen musste. Freitagnachmittag – das war schon damals so, wie es auch heute ist – mit den Gedanken sind alle schon im Wochenende, und man wartete nur darauf, dass der Uhrzeiger auf 16 Uhr, dem Zeitpunkt für Dienstschluss – vorrückte. Kurz, bevor es soweit war, rief mein Vorgesetzter quer durch die Kantine: „Hey – Jones, haben Sie am Sonntag schon was vor?“ Normalerweise verhieß eine solche Frage nichts Gutes: Bereitschaft oder irgendeinen Dienst, zu dem sich kein Freiwilliger hatte finden lassen. Ich war aber bester Stimmung und antwortete mit „nein“, worauf meine Kollegen Seufzer der Erleichterung ausstießen, denn hätte ich ‚ja‘ gesagt, wären sie gefragt worden. „Ok, Jones, sie fliegen am Sonntag für eine Woche nach Skandinavien!“ Große Augen allerseits! Diese Einwochenflüge waren heiß begehrt, denn in der Regel fanden sie nur mit wenigen, manchmal auch ohne Passagiere statt. Das hieß, man wurde sozusagen in den Urlaub kommandiert! Meine militärische Laufbahn nahm zwar damit keine Wende, aber dies sollte der Anfang einer geradezu unglaublichen Zeit für mich werden, während der ich in zahllose Länder fliegen sollte und dazu noch gekrönten und ungekrönten Häuptern den Tee zu servieren hatte! Vielleicht halfen mir ja auch ein wenig mein halbwegs manierliches Auftreten und natürlich meine Sprachkenntnisse, denn im Englischen machte mir sowieso keiner was vor, und bei den vielen internationalen Fluggästen war man offenbar so manches Mal froh, mich vorschieben zu können. Ich genoss diese Zeit, und die Warnungen meiner Eltern vor „dem Militär“ hatten sich mittlerweile völlig in Luft aufgelöst und als unrichtig erwiesen.
Wenn ich gerade nicht fliegen musste, hatte ich Dienst in der Kantine. Da kam es des öfteren vor, dass ich mich gerade auf den Feierabend vorbereitete, als ein Anruf kam und man mir sagte: „Jones – sie fliegen noch mit dem „BuKa“ (Bundeskanzler) nach London“. Oder nach Stockholm, Brüssel, Madrid, nach Paris oder Amsterdam, in die USA, was dann eine knappe Woche dauerte, oder mit „BuPrä“ und Außenminister auf Staatsbesuch nach Venezuela, Ecuador und Bolivien. Es nahm kein Ende, und ich wurde des Fliegens nie müde. Wenn keine Passagiere an Bord waren, hielt ich mich meist im Cockpit auf und sah den Piloten zu oder ließ mir jeden Handgriff erklären. Ein Kindheitstraum hatte sich erfüllt – hautnah bei der Fliegerei dabei zu sein, was mich auch heute noch begeistert. Einmal flogen wir ohne Passagiere mit einer Jetstar von irgendwo zurück nach Köln. Die Jetstar - „Lockheed C 140“ war die offizielle Bezeichnung – war ein vierstrahliges Geschäftsflugzeug mit 8 Sitzen und von der äußeren und inneren Aufmachung nicht nur ein sehr teurer, sondern ein selten gesehener und überaus eleganter Flieger. Mit seinen 4 Triebwerken im Heck gehörte es zu den damals leistungsstärksten Privatflugzeugen überhaupt. Wir waren zu dritt im Cockpit, als eine Anweisung von der Flugaufsicht kam, die uns eine höhere Flugfläche zuwies. Der Pilot gab Gas und zog den silbernen Flieger steil nach oben. Man sagte der Jetstar Steigfähigkeiten nach, die einem Düsenjäger sehr nahekamen. Und als der Pilot dem Tower schon nach kürzester Zeit das Erreichen der neuen Flughöhe durchgab, kam von dort ein „Wow – that is incredible!“ Auf demselben Flug flogen wir eine Rolle. Dabei dreht sich das Flugzeug um seine Längsachse. Der Pilot fragte uns, ob wir was dagegen hätten, und alle (es waren ja nur der Copilot und ich) waren einverstanden. Und bevor ich wusste, was geschah, war der Himmel auch schon unten und die Erde oben, und dann war alles wieder dort, wo es hingehörte. Es war einfach unglaublich – dieses Zusammenspiel von Kraft, Tempo und fliegerischer Eleganz. So etwas hätte natürlich niemals stattgefunden, wenn wir einen Passagier an Bord gehabt hätten!
Mit einer Jetstar mussten wir einmal an einem Sonntag um 7 Uhr den Bundeskanzler und seine Begleitung von Köln nach Memmingen und später wieder zurück nach Köln bringen. Man hatte mich gewarnt, dass Willy Brandt ein ausgesprochener Morgenmuffel sei, und ich solle auf der Hut sein und nicht zu viel reden. Aber was heißt schon „nicht zu viel reden“, wenn man dem Bundekanzler lediglich einen Kaffee oder Tee zu servieren hat – dachte ich. Pünktlich brachte die schwarze Staatskarosse den Kanzler wenige Minuten vor 7 an das Flugzeugtreppchen. Brandts Begleiter, ein hochgewachsener, kräftiger Mann, stieg vor dem Kanzler aus und trug eine aufgefaltete „Times“ vor sich, unter der er etwas verbarg. Er kam ans Flugzeug, sah mich in meiner weißen Jacke und reichte mir die Zeitung, bzw. den Gegenstand, den er darunter verbarg. „Bring‘ das mal nach hinten und pass gut drauf auf!“ Ich nahm das Ding entgegen und sah, dass es eine Maschinenpistole war. Der Mann war Brandts Leibwächter! Ich verstaute die MP hinten in meiner Galley – peinlich darauf achtend, dass sie gesichert blieb! Die beiden Passagiere sanken dann in die Sitze entgegen der Flugrichtung. Nach dem Start - mittlerweile war es kurz nach 7 - ging ich zu Brandt und fragte ihn, was er trinken wolle. „Cognac!“ krächzte er. Zum Glück hatte ich eine Flasche Asbach an Bord – eigentlich hatte ich damit gerechnet, Kaffee servieren zu müssen. Aber Cognac oder in diesem Falle Asbach war ja einfacher – auch wenn es erst frühmorgens war! Ich servierte den Asbach in einem kleinen Cognacschwenker und stellte ihn vor Brandt, worauf dieser ihn zurückschob und mich anraunzte „das ist Scheiße, das Glas muss voll sein!“ Ich entschuldigte mich, nahm das Glas wieder zurück und verschwand in meiner Galley, wo ich ein Wasserglas nahm und es randvoll goss mit Asbach. Dieses Glas stellte ich vor den Kanzler, der es zufrieden annahm. Die Flasche behielt er dann auch da, und als wir eine knappe Stunde später in Memmingen landeten, musste ich eine neue Flasche besorgen, denn die alte war leer.
Ein anderer Flug – wieder mit Brandt, ging nach Paris. Diesmal flogen wir mit der guten alten Convair 440, einem zweimotorigen Propellerflugzeug. Nach der Ankunft in Paris am Nachmittag war der Besatzung für abends freigegeben worden, denn der Rückflug sollte erst am nächsten Morgen um 8 stattfinden. Unser Kommandant Oberstabsfeldwebel Stachel war ein älterer Pilot, der schon im 2. Weltkrieg Einsätze geflogen war. Ihm war in Paris nicht nach Ausgehen zumute – zumal er extrem geizig war. Er brachte immer seine eigene Verpflegung in Form von belegten Broten mit und machte damit auch in Paris, der Hauptstadt des guten Essens, keine Ausnahme. Aber immerhin kannte er ein Hotel in der Rue Washington unweit der Champs Elysées, das bei deutschen Soldaten sehr beliebt war. Die Besitzerin des Hotels hatte im Krieg offenbar mit der Wehrmacht kollaboriert und dadurch in der Nachkriegszeit sehr große Unannehmlichkeiten mit den Behörden der Stadt erfahren. Man hatte ihr allerdings nie eine Straftat welcher Natur auch immer nachweisen können. Aber die Animositäten ihrer Landsleute hatten die Dame offenbar in die Arme ihrer deutschen Freunde zurückgeschickt! Denn jeder deutsche Soldat, der in ihrem Hotel abstieg, wohnte dort zu einem Sonderpreis und bekam zur Begrüßung eine Flasche Wein geschenkt. Da unser Kommandant sich sofort nach unserer Ankunft in sein Zimmer zurückgezogen hatte, waren wir nur noch zu dritt: der Copilot, der Bordfunker (ja – diese Position gab es damals noch!) und ich. Und so zogen wir also los – zuerst in ein Restaurant, in dem wir gut aßen und dann ins Crazy Horse. Der Funker, nennen wir ihn Robby, war ein echter Freund der schönen Dinge und ein sehr lebensbejahender Mensch mit einem ausgeprägten und äußerst ansteckenden Humor. Seine Lachanfälle waren legendär, und wenn er einmal loslegte, lachte zum Schluss jeder in Hörweite, und kein Auge blieb trocken. Das geschah auch im Crazy Horse, diesem exklusiven Pariser Nightclub mit Legenden – Status. Wir drei waren nach Apéritif, reichlich Wein zum Essen und einem anschießenden Digestif schon ziemlich angeschlagen, aber durchaus noch im Besitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte. Vielleicht war es der Champagner im Crazy Horse, vielleicht auch tatsächlich die Show selbst, in der ein sehr lustiger Magier auftrat, jedenfalls brachte irgendetwas Robby zum Lachen. Er begann meist leise, in kurzen Stößen und wurde dann immer lauter – so laut, dass bald die ersten Zuschauer anfingen mitzulachen. Immer mehr wurden es, und schließlich lachten auch einige der Tänzerinnen auf der Bühne los – bis der komplette Saal aus vollem Hals lachte, Robby war zu diesem Zeitpunkt bereits vom Stuhl gerutscht uns saß unter dem Tisch. Uns allen liefen die Tränen herunter – die Show wurde unterbrochen, das Licht ging an und der schwere rote Vorhang sank auf die Bühne. Diese Show in der Show dauerte einige Minuten, bis einsetzende Atemnot bei den Lachenden dem Ganzen schließlich ein sanftes Ende bereitete und die eigentliche Show über die Runden gebracht wurde.
Nach der Show wurden wir beim Hinausgehen von einem Herrn im schwarzen Anzug zur Seite gebeten. Ich dachte schon, jetzt gäbe es Ärger. Aber im Gegenteil – er fragte uns überaus höflich, ob wir nicht am nächsten Abend wiederkommen wollten – als Gäste des Hauses. Das mussten wir leider ablehnen – auf uns wartete ja der Bundeskanzler!
Aber die Nacht war noch nicht zu Ende! Vom Crazy Horse, das unweit der Seine auf der Avenue Georges V liegt, war es ein Spaziergang von vielleicht einer halben Stunde bis zu unserem Hotel in der Rue Washington. Und die frische Luft machte natürlich durstig… Unterwegs kehrten wir in einer Bar ein, tranken weiter und kamen erst am sehr frühen Morgen am Hotel an. Gegenüber hatte noch ein Lokal geöffnet, und obwohl Robby da schon mächtig neben der Kappe war, kehrten wir ein weiteres Mal ein. Wir mussten dann nur noch die Straße überqueren, um unser Hotel zu erreichen. Doch bei Robby war an Gehen nicht mehr zu denken. Und während wir ihn links und rechts unterhakten und hinüberschleppten, fing er plötzlich an zu röhren, wie ein Hirsch – ich hatte solche Geräusche aus einer menschlichen Kehle noch niemals gehört. In den dunklen Häusern gingen die ersten Lichter an, und Menschen schauten aus den Fenstern besorgt nach unten auf die Straße. Doch Robby schaffte es so gerade noch zwischen zwei geparkte Autos, bevor er sich übergab – und zwar ungemein lautstark! Zum Glück waren seine Geräusche keiner Sprache zuzuordnen – ich glaube nicht, dass wir sonst einen positiven Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft geleistet hätten! Danach fühlte sich Robby ziemlich erleichtert und schaffte es aus eigenen Kräften bis ins Hotel. Auf der Treppe mussten wir ihn allerdings wieder stützen – was uns aber nicht davon abhielt, uns im Zimmer noch über die drei geschenkten Flaschen Wein der Hotelbesitzerin herzumachen! Es war ein Weißwein – das weiß ich noch, und dass wir so gut wie nicht geschlafen haben, auch. Denn kurz nach 6 stand schon ein Auto der Deutschen Botschaft vor der Tür, das uns zurück zum Flughafen bringen sollte. Im Hotel hatten wir es gerade noch geschafft, einen Kaffee auf die Schnelle zu trinken. Auf dem Weg zum Flughafen wurde eine Runde Kaugummi nach der anderen geschmissen – wir hatten größte Bedenken, dass unsere alkoholgeschwängerten Ausdünstungen auffallen könnten. Zu seiner Ehrenrettung sollte ich allerdings erwähnen, dass der Copilot der einzige von uns dreien war, der nicht mitgesoffen hatte – und der Bordfunker (Robby) kam ohnehin nicht oder kaum mit den Passagieren in Kontakt. Bei mir sah das allerdings schon anders aus! Aber unsere Befürchtungen sollten sich als völlig unnötig erweisen. Denn als der schwarze Mercedes den Kanzler an die Gangway brachte, stellte sich heraus, dass Brandt noch in einer ähnlichen Verfassung war wie Robby in der Nacht zuvor! Zwei Leibwächter schleiften ihn mehr oder weniger die Treppe hinauf ins Flugzeug, setzten ihn auf seinen Platz und schnallten ihn fest. Und dort blieb er – in komatösem Tiefschlaf versunken – sitzen, bis wir ihn nach der Landung in Köln – Bonn wieder wecken mussten.
Manchmal flogen wir den Verteidigungsminister, damals Helmut Schmidt, nach Brüssel zu irgendwelchen NATO Sitzungen. Die waren bei uns immer berüchtigt, weil sie oft bis tief in die Nacht andauerten, während der die Flugzeugbesatzungen den Flughafen von Brüssel nicht verlassen durften, um jederzeit abflugbereit zu sein. Wenn Schmidt dann mitten in der Nacht an Bord kam, war er meist aschfahl, abgespannt und sichtlich erschöpft. Dennoch hatte er immer ein freundliches Wort für den Steward übrig – mich verwickelte er einmal in ein Gespräch, er wollte wissen, was ich vorhatte nach der Bundeswehr und was ich bis jetzt so gemacht hatte. Ausgerechnet auf diesem Flug hatten wir einen Triebwerksausfall und landeten dann mit nur einem Motor in Hamburg. Der Minister nahm es mit Fassung.
Im September 1970 rief mich ein Kamerad von der Flugvorbereitung an. Ob ich schon gehört habe, wer demnächst mit der Flugbereitschaft fliegen werde? Ich hatte keine Ahnung. Es war Udo Jürgens. Die Flugbereitschaft sollte ihn von Fürstenfeldbruck bei München nach Ostfriesland zum Fliegerhorst Jever bringen, weil er dort als Passagier in einer F 104 G – dem schon damals berüchtigten Starfighter – mitfliegen sollte. Der Starfighter war ein äußerst problematisches Flugzeug für die Luftwaffe, die insgesamt 269 Muster der F 104 G durch Abstürze verlor – eine unglaubliche Anzahl! Und tragischerweise waren 116 Piloten bei diesen Unfällen ums Leben gekommen. Udos damaliger Manager Hans R. Beierlein hatte diese Mitfluggelegenheit mit Hilfe des Vier-Sterne-Generals Johannes Steinhoff, dem damaligen Inspekteur der Luftwaffe, eingefädelt, und es war sehr wahrscheinlich für beide Teile – die Bundeswehr und auch für Udo – ein bemerkenswerter PR Gag, der natürlich auch das Starfighter Image aufpolieren sollte. Udo war damals enorm erfolgreich, war Idol einer ganzen Generation. Und wenn er sich für die Bundeswehr interessierte, dann würde dies sehr wohl auch eine positive Wirkung in der Gesellschaft hinterlassen. Und umgekehrt stand es einem Star ja auch ganz gut zu Gesicht, wenn er einen Flug in einem dieser so legendären wie gefürchteten Silbervögel absolvierte, die mehr einer Rakete als einem Flugzeug glichen.
Man wusste in meiner Einheit, dass ich ein glühender Udo Fan war, und so war es nicht schwer, meinen Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass ich diesen Flug bekommen sollte! An einem sonnigen Spätsommertag flogen wir mit einer Convair 440 früh morgens nach Fürstenfeldbruck bei München. Dort stiegen nicht nur Udo Jürgens mit einem Begleiter, sondern auch mehrere Generäle ein. Udos rotes Halstuch wehte im Wind, unter dem Arm trug er eine Bildzeitung, die er aufschlug, nachdem er es sich im hinteren Teil der Maschine bequem gemacht hatte. Die Generäle stiegen ein paar Minuten später ein. Der ranghöchste Offizier, ein Viersterne-General und Udo begrüßten sich kurz, wobei der Soldat auf die Bildzeitung blickte, und ziemlich herablassend bemerkte „aha – Sie lesen Bild – naja – ich lese lieber meine FAZ!“ Udo stammelte dann noch etwas von einem Brand in seinem Haus, worüber die Bild in dieser Ausgabe groß berichtete, aber der General ließ ihn stehen und setzte sich auf seinen Platz weiter vorne. Zwischen den beiden gab es im weiteren Verlauf des Fluges keine weitere Kommunikation.
In der Tat war Udos Kitzbüheler Haus ein oder zwei Tage vorher vollständig ausgebrannt, und die BILD brachte Fotos und einen großen Bericht. Ich erinnere mich noch an ein Foto, auf dem man sah, wie der Flügel aus dem Haus herausgetragen wurde und so den Flammen entkommen war. Wie bei jedem Flug machte ich meine Ansage, wobei ich die Passagiere mit „sehr geehrter Herr Jürgens, verehrte Fluggäste“ begrüßte.
Zwei Wochen später wurde ich zum Staffelkapitän gerufen. Der teilte mir mit einem Augenzwinkern mit, dass der Viersterne-General sich wegen dieser Ansage bei ihm beschwert habe – dieser Udo Jürgens sei persönlich begrüßt worden, er als General hingegen nicht!
Niemals hätte ich gedacht, dass dies einen General derart beschäftigen würde – und mein Staffelkapitän teilte diese Meinung unverhohlen! Mein fauxpas blieb also ohne Folgen.
Nachdem ich ihm eine Fanta gebracht hatte, gab es während des Fluges Gelegenheit, mit Udo zu reden. Aber ich glaube, ich war viel zu aufgeregt, ihn all das zu fragen, was ich ihn eigentlich hatte fragen wollen. Aber bei unserem nächsten Zusammentreffen, das sechs Jahre später stattfinden sollte, erinnerte er sich tatsächlich noch an unser erstes Gespräch auf dem Flug nach Jever!
Eigentlich war ich ja nur so etwas wie „Hilfssteward“ – dadurch allerdings setze man mich auf allen möglichen Reisen und Flugzeugtypen ein, auf denen es von Vorteil war, wenn jemand dabei war, der gut Englisch und einigermaßen gut Französisch sprach. Auf den Langstreckenflügen, damals mit der guten alten Boeing 707, lernte ich den Kollegen Rolf Stolte kennen, Steward auf der 707 und Zeitsoldat mit längerer Verpflichtungszeit. Rolf war wie ich Hobbymusiker, wobei er sich aufs Singen verlegt hatte, während ich mich mehr für das Liederschreiben interessierte. Er schlug mir vor, ihm doch ein Lied zu schreiben, denn im kommenden Winter sollte es in Bonn ein Fest des Bundeministeriums der Verteidigung zugunsten der „Aktion Sorgenkind“ geben, auf dem große Künstler auftreten würden und er vielleicht die Chance bekommen könnte, als Bundeswehrangehöriger einen Auftritt abzustauben. Naja – ich war natürlich nicht abgeneigt. Und schrieb ihm daraufhin das Lied „Warum“ – und wenn ich heute daran zurückdenke, war dies vielleicht – sehr wahrscheinlich sogar - mein allererstes Lied, das ich komplett mit Text und Musik schrieb! Den Text habe ich mittlerweile vergessen, die Melodie aber habe ich noch im Kopf. Es war jedenfalls kein reiner Schlager, aber es als Chanson zu bezeichnen, wäre auch sicher übertrieben. Rolf war eigentlich ein reiner Schlagersänger und daher für diesen Song nicht unbedingt prädestiniert. Aber wir bekamen es eigentlich ganz ordentlich hin, und er bewarb sich um eine Teilnahme an dem besagten Abend. Als wir Wochen später vor einer Jury spielen mussten, um die Zulassung für das Bundeswehrfest zu bekommen, waren alle hellauf begeistert. Es ging ja auch darum zu zeigen, dass die Bundeswehr nicht nur eine Kampfmaschine ist, sondern ein sehr lebhafter Teil der Gesellschaft, aus der selbst Musiker hervorgehen können.
Der Abend wurde in der Lokalpresse groß angekündigt, und auch das Fernsehen sollte einige Minuten lang übertragen. Ich war natürlich schrecklich aufgeregt, denn ich sollte Rolf am Klavier begleiten. Zum ersten Mal bekam ich live mit, welch ein Apparat hinter einer solchen schlichten Veranstaltung steckt – Beleuchter, Techniker, Monteure, Regisseure und Redakteure – alle liefen dort durcheinander. Man musste über riesige Kabelstränge klettern – es wurde akribisch gearbeitet und in Szene gesetzt, und – das muss man dem Bund lassen – sehr professionell vorbereitet. Ich weiß nicht mehr, wo der Abend stattfand, ich glaube, es war in Bonn, aber die Halle war restlos ausverkauft. Irgendwann wurden wir angekündigt, ich setzte mich ans Klavier und spielte die ersten Töne. Rolfs Einsatz klappte gut – das war meine größte Sorge gewesen, dass er die Stelle verpasste, an der er anfangen musste zu singen! Doch bis auf einen kleinen Texthänger ganz zum Schluss lief es gut, und wir wurden mit einem Riesenapplaus belohnt. Wenig später war dann der Star des Abends dran – es war ein hochgewachsener schlaksiger junger Mann - Chris Roberts, und er wurde begleitet von Werner Twardy, dem Komponisten zahlloser Schlager für Roy Black & Co und eben auch Chris Roberts. Ich war fasziniert, wie Twardy in die Tasten hämmerte - so hatte ich das noch nie gesehen! Chris sang seine drei Titel routiniert runter – „ich bin verliebt in die Liebe“, „Mein Name ist Hase“ und „Du kannst nicht immer siebzehn sein“, großer Applaus, und dann war er auch schon wieder verschwunden. Ich sah ihn erst am nächsten Morgen wieder, als wir ihn nach München flogen. Er war der einzige Passagier, und so konnte ich mich ein wenig mit ihm unterhalten – zumindest hatte ich das erhofft. Doch er blieb eher verschlossen, unnahbar und unverbindlich. Ich sah ihn dann erst viele Jahre später in einer Fernsehsendung, in der er auftreten wollte, aber nicht gelassen wurde. Und ich stellte fest, dass er sich über all die Jahre nicht verändert zu haben schien – er war immer noch ein Schlagersänger, mit derselben Frisur, die aber nun irgendwie unpassend und künstlich wirkte – ebenso unverbindlich wie Jahrzehnte zuvor.
Die Lokalpresse feierte den Bundeswehrabend in Bonn groß – es gab halbe und ganze Seiten. Mein Song wurde sehr positiv bewertet, und man räumte ihm gar „Chancen für die Charts“ ein – aber darauf gab ich rein gar nichts, denn nirgendwo liest man mehr Unsinn über Musik und Musikschaffende als in der Zeitung! Aber immerhin musste ich ein paar Tage später zu einem höheren Offizier kommen, der mir vorschlug, mich mit Günter Noris zusammenzubringen. Der war vom damaligen Verteidigungsminister Helmut Schmidt mit der Bildung einer Bundeswehr Bigband betraut worden, und diese Band feierte sich gerade quer durch die Republik von Erfolg zu Erfolg. Zu diesem Termin nahm ich Rolf Stolte mit, und wir wollten den Song „Warum“ dort vorstellen. Die Bundeswehr Bigband probte in einer alten Halle in einem Hinterhof bei Euskirchen. Günter Noris war überaus zuvorkommend, und da es keine Noten von meinem Song gab (das Notenschreiben hatte ich ja seit Langem verlernt), bat er mich, das Lied kurz vorzuspielen. Das machte ich ein oder zweimal, und schon hatte die Band – die waren alle hervorragende Profis - den Song komplett drauf. Dann wurde Rolf gebeten, das Lied mit Bigband zu singen. Und das ging dann in die Hose! Rolf intonierte nicht sauber, lag mehrmals deutlich neben den Tönen, und so sagte mir Günter Noris dann – „sorry, der Song ist nicht schlecht, aber die Intonation ist nicht sauber – können wir so nicht übernehmen“. Damit wurden wir wieder entlassen.
Es war mir aber auch nie in den Sinn gekommen, selber zu singen – dazu fühlte ich mich einfach nicht berufen, und ich glaube, ich hätte keinen Ton herausbekommen, auch wenn man mich gebeten hätte! Ich hatte panische Bühnenangst, und selbst einen Sänger am Klavier zu begleiten, war für mich schon grenzwertig. Ich führe das heute darauf zurück, dass ich als kleines Kind zu Hause immer für unseren Besuch etwas vorspielen musste, und das hatte mich offenbar nachhaltig traumatisiert! Also kann ich allen Eltern heute nur raten – lasst eure Kinder in Ruhe und zwingt sie vor allem beim Erlernen eines Instrumentes nie dazu, etwas gegen ihren expliziten Willen zu tun! Vor allem in der Musikerziehung erscheint mir das wichtig, denn Zwang und Kreativität sind nun einmal keine harmonischen Partner!
Musikalisch gesehen zog ich mich zurück. Ich fuhr oft in meine ehemalige Schule, das Dreikönigsgymnasium am Kölner Thürmchenswall unweit vom Dom. Ich kannte den Hausmeister Herrn Scheidgen gut, und der gab mir – wann immer ich wollte – abends den Schlüssel für die große Aula der Schule. Dort stand auf einer meterhohen Holzbühne ein Steinway Konzertflügel, auf dem ich so manchen Abend zahllose Stunden spielte. Über der Bühne gab es in vier oder fünf Metern Höhe einige große Punktstrahler, die über große Drehregler eingestellt wurden. Ich ließ einen dieser Strahler dann ganz sanft auf den Flügel strahlen, um nicht völlig im Dunkeln zu sitzen. Und dann spielte ich los. Die große Holzbühne verstärkte die ohnehin starke Resonanz dieses fabelhaften Instruments, und das Gefühl, hier in der Schule, an der ich so viele Jahre verbracht hatte, in einer solch besonderen Atmosphäre zu spielen, war für mich einfach ergreifend. Ich fühlte jeden Ton, glasklar lebten die Töne des Steinway, die Luft schien zu vibrieren und brachte mein Empfinden zum Glühen. Manchmal spielte ich so zwei oder drei Stunden am Stück – alles, was mir gerade einfiel. Ich improvisierte einfach drauf los, und vielleicht legte ich in diesen für mich magischen Stunden und Minuten auch den ein oder anderen Grundstein für die Lieder, die ich später schreiben würde, aber bis dahin war es noch ein weiter Weg.