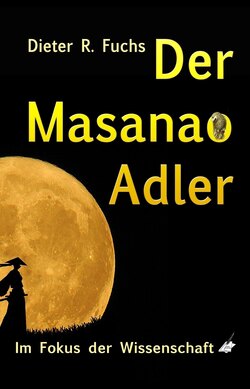Читать книгу Der Masanao Adler - Dieter R. Fuchs - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTod in Afrika
Er strotzte vor Kraft und strahlte Gelassenheit und Zielstrebigkeit aus, als er den durch Felsen verengten Eingang des ausgetrockneten Flussbetts passierte. Aber sein Leben sollte hier bald ein Ende finden.
Die Herde, in der er vor vielen Jahrzehnten aufgewachsen war, hatte ihn bereits im Alter von acht Jahren verstoßen, also lange vor der für die Separierung von Jungbullen üblichen Zeit. Denn er war anders. Er war viel größer und kräftiger als seine Altersgenossen und überragte schon in jungen Jahren die ausgewachsenen Elefanten in seiner Herde. Seine Haut war fast rosa-weiß, was ihn im dichten, grünen Dschungel an den Ufern des großen Flusses, den man später Volta nennen sollte, wie einen Fremdkörper wirken ließ. Seine Augen, die mit deutlich verminderter Sehkraft ausgestattet waren, funkelten blutrot aus dem unförmigen hellfarbenen Kopf. Der Schädel war bei dem Jungtier grotesk erhöht im Vergleich zu seinen Spielgefährten, die eigentlich keine waren für ihn – er blieb von Anfang an ein Einzelgänger und wurde ausgegrenzt von einer artspezifischen Sozialisierung im Herdenverbund. Im Gegensatz zu den anderen besaß er nur einen einzigen wirklichen Stoßzahn, aber was für einen! Während der linke verkümmert und kaum eine Handspanne lang war, ragte der rechte schon bald über einen Meter aus seinem mächtigen Oberkiefer heraus und zwang seinen jungen Nacken, sich immer wieder und immer tiefer zu beugen. Im dichten Wald war dies anfangs ein Problem für den rasch heranwachsenden Jungbullen, denn sein sperriger Stoßzahn verfing sich oft in den Schlingpflanzen und im Unterholz, zumal er leicht nach außen gebogen war, nicht wie bei seinen Artgenossen nach innen. Während diese sich flink und problemlos durch den Urwald bewegen konnten, musste er sich halbblind seinen Weg mit brachialer Gewalt durch das Dickicht bahnen, um mit ihnen Schritt zu halten. Doch mit wachsenden Kräften und seltsam geschärften anderen Sinnen für seine Umgebung gelang ihm dies zunehmend besser.
So wenig wie ihn die Natur bei der Geburt begünstigt hatte, als sie ihn mit derartigen genetischen Absonderlichkeiten versah, so wenig meinte es auch das weitere Schicksal gut mit ihm. Noch keine fünf Jahre alt verlor er seine Mutter und Tanten durch einen verheerenden Waldbrand, der die halbe Herde in Panik in einen Abgrund stürzen ließ. Nachdem er so auf einen Schlag seine direkte Protektion und sein vertrautes Habitat verloren hatte, war es nur eine Frage weniger Jahre, bis die Herde ihn vollends ausgrenzte und er schließlich seiner eigenen Wege ging.
Es war jedoch nicht nur dieser Gruppendruck, der auf ihm lastete. Da wirkten auch seltsame Antriebskräfte in seinem Innern, die ihn auf die äußeren Umstände plötzlich und willig eingehen ließen. Vielleicht könnte man das, was in seinem Körper und Gehirn vorging, mit den geheimnisvollen Sinnen und Leitprozessen von Zugvögeln vergleichen. Oder mit jenen von Fischen, die – durch Instinkte und uralte Prägungen getrieben – zu fernen Laichplätzen aufbrechen, an denen die Vorfahren einst geboren worden waren. Es zog den Elefanten nach Osten, immer weiter nach Osten.
Seine Wanderung dauerte über siebzig Jahre, immer weiter und weiter getrieben, der aufgehenden Sonne entgegen. Er durchquerte auf seiner von höheren Kräften bestimmten Wanderschaft schier endlose Wälder, durchschwamm unzählige Flüsse und Seen und zog seine deutliche Spur schließlich durch nicht enden wollende Savannen und Trockengebiete. Weder er noch ein anderes Wesen hätten nachvollziehen können, wie viele und dramatische Abenteuer er in dieser Zeit erlebte. Dies alles blieb nicht in seiner eingeschränkten Erinnerung festgehalten, sondern wäre nur mit Fantasie aus den zahlreichen Narben in seiner außergewöhnlichen hellen Haut erahnbar gewesen.
Und nun sollte sich also sein Lebenskreis schließen, seine lange Wanderschaft ein Ende finden.
Die etwa zwanzigköpfige Jagdgruppe vom Stamm der Mbuti aus der Untergruppe der Efe folgte den Spuren des riesigen Albino-Elefanten schon seit mehreren Wochen. Sie waren wie versteinert gewesen, als sie ihm plötzlich auf einer Lichtung im dichten Wald gegenüberstanden. Er verschwand wie ein Geist, noch bevor einer von ihnen aus der Erstarrung erwachte. Sein einziger Stoßzahn musste über drei Armspannen lang sein und seinen Rücken hätten wohl auch drei übereinandergestellte Jäger nicht erreicht – es war ein unglaublicher Anblick für die kleinen Menschen. Von diesem Moment an waren ihre Gedanken nur noch auf diesen Geisterelefanten fokussiert und sie folgten seiner Fährte, als würde ihr Überleben davon abhängen. Zeit bedeutete ihnen genauso wenig wie ihrer Jagdbeute, denn diese Jagd war die bedeutendste spirituelle Handlung, die jemand aus ihrem Volk je unternommen hatte.
Es war ungewöhnlich für diese ethnische Gruppe von Pygmäen, deren Ursprünge am Oberlauf des Flusses Kongo lagen, sich so weit von ihrem eigenen Stammesgebiet zu entfernen. Normalerweise fanden die Jagdzüge räumlich stets im engeren Umland des Sippenverbandes statt, auch wenn sie mehrere Wochen dauern konnten. Doch diese spezielle Untergruppe der Efe hatte ihre angestammten Jagdgründe bereits vor drei Generationen den überlegenen Bantu-Stämmen überlassen müssen und war in eine weniger wildreiche Gegend weit im Osten am Fluss Bahr Al Arab verdrängt worden. Von dort war der kleine Stammesverband später weiter nach Südosten gewandert, bis an die Ufer des Naivasha Sees. Viele ihrer originären, von den Ahnen übernommenen Riten und Lebensweisen hatten sich im Lauf der Zeit verändert und die daher in vieler Hinsicht entwurzelten Efe passten sich den neuen Rahmenbedingungen auf bestmögliche Weise an.
Elefantenjagd war für die kleinwüchsigen Waldmenschen früher ein absolutes Tabu, denn sie waren aus tiefer Spiritualität heraus unfähig, Nahrung zu verschwenden. Die Fleischmenge eines erlegten Elefanten hätte aufgrund nicht vorhandener Konservierungsmethoden somit einen Tabubruch ohnegleichen dargestellt. Doch in diesem Fall lagen die Dinge völlig anders. Eine der wenigen Überlieferungen, die die Vertreibungen überlebt hatten, wurde plötzlich zur greifbaren Realität.
In den traditionellen Jagdgesängen der Mbuti wurde die Erscheinung eines riesenhaften weißen Elefanten mit nur einem Stoßzahn vorausgesagt und mit ihm der Beginn einer neuen, glücklichen Zukunft für ihr Volk. Diese Stammes-Legende, die schon den Kleinsten am Lagerfeuer erzählt und so über viele Generationen lebendig gehalten wurde, beschrieb sehr genau, wie die Jagd enden würde und welche weiteren Schritte erforderlich wären, um ihnen den Geist des getöteten weißen Elefanten wohlgesinnt zu machen. Das Schicksal des Stammes solle sich damit für immer zum Guten wenden. Fern gen Sonnenaufgang würden die erfolgreichen Jäger einen fremden Stamm finden, am Rand des östlichen Salzmeeres. Hochgewachsene weißhäutige Menschen mit langen Bärten und weißen Gewändern, die auf riesigen schwimmenden Häusern sogar das unendliche Wasser am Rande der Welt bereisten. Deren Medizinmann sollte nach der Überlieferung als einziger in der Lage sein, die erforderlichen Opferriten mit dem Stoßzahn des weißen Elefanten richtig durchzuführen und die Efe als Heilsbringer wieder nach Hause zu senden. Dort würde man ihren Mut und ihre Geschicklichkeit loben und die siegreiche Jagd überall laut verkünden, sodass sogar die mächtigen Bantu erzitterten und ihr Stamm wieder in die eigenen Wälder zurückkehren konnte.
Doch noch war es nicht soweit, auch wenn alle Gedanken der Jagdgruppe trotz der Entbehrungen der letzten Wochen nur um dieses eine Ziel, die Erlegung und Opferung des sagenhaften weißen Elefanten, kreisten.
Sie hatten ihn in den vielen Tagen nach der ersten Begegnung nur noch ein einziges Mal zu Gesicht bekommen, am gegenüberliegenden Ufer eines breiten Flusses kurz vor Sonnenuntergang. Die Jäger sahen wieder deutlich seine ungewöhnliche Hautfarbe, seine Größe und einige körperliche Entstellungen, die für sie weitere Zeichen höherer Spiritualität waren. Aber der Elefantenbulle war an diesem Tag für sie unerreichbar. Am nächtlichen Lagerfeuer besangen sie leise und in Ehrfurcht ihre Vision und beschlossen, die unausweichliche Jagd zum prophezeiten Ende zu führen, wie lange und wie weit sie sie auch noch führen möge.
Das Objekt ihrer Gedanken ahnte nichts von dieser Bedrohung durch die kleinen Zweibeiner. Die Augen des Albino-Elefanten waren in den letzten Jahren deutlich schwächer geworden und auf seine Instinkte war kein Verlass mehr. Auch sein Geruchssinn hatte ihm in den letzten Wochen seiner Wanderung nie die drohende Gefahr signalisiert. Stets standen die Winde zu seinen Ungunsten, wie hätte es anders sein sollen. Dass die Jäger ihn trotzdem nicht einholten, sondern seit Wochen immer einige Stunden hinter ihm seiner unübersehbaren, breiten Spur folgten, lag wohl nicht an einem konkreten Fluchtinstinkt. Es lag eher an der ihm eigenen inneren Unruhe, die ihn schon seit Jahrzehnten antrieb und die von Jahr zu Jahr zu höherer Geschwindigkeit und größeren Tagesstrecken anspornte. Vielleicht war dem Elefanten aber tief im Inneren auf unerklärliche Weise bewusst, dass das Ende seiner langen Reise nahte.
Zwei weitere Wochen später war es soweit: Eine steile Schlucht versperrte ihm den Weg nach Osten. Sein Versuch, diese zu umgehen, führte ihn in ein kleines Trockental, das sich als Sackgasse erwies und dessen steile Felswände für den Koloss nicht zu erklettern waren. Er drehte also wie schon so oft in seinem Leben um und stand auf dem Rückweg seinen Verfolgern erstmals bewusst gegenüber. Die instinktive Flucht zurück in das Wadi konnte ihn nicht retten. Die Jagdgruppe folgte ihm vorsichtig und als ihnen klar wurde, dass es hier kein Entkommen mehr für ihn gab, begann man in Ruhe und mit viel Routine eine Fallgrube am engen Eingang des Wadi auszuheben. Ein anderer Teil von ihnen hielt die wertvolle Beute am Ende des Canyon in Schach. Sie errichteten Lagerfeuer quer durch das Tälchen, welche den Elefanten daran hinderten, durch ihre Reihen zu brechen. Einen Tag später ließen sie diese Feuer erlöschen und hetzten ihn mit viel Geschrei und von oben auf ihn herab geworfenen brennenden Büschen. Als er auf seiner panischen Flucht unausweichlich in die mit dürren Baumstämmen, Zweigen und Gras abgedeckte Fallgrube einbrach, durchstachen die mutigsten von ihnen mit ihren Lanzen seine Fußsehnen und fügten ihm mehrere große Wunden am Körper zu. Es dauerte noch drei lange Tage und Nächte, bis er an seinen Wunden verendete und kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Aber die entsetzlichen Trompetenstöße, die erst in der dritten Nacht langsam erstarben, sollten ihnen allen nie mehr aus dem Gedächtnis weichen.
Keiner sah die roten Augen erlöschen, die wie kein anderes Elefantenauge zuvor den afrikanischen Kontinent von weit im Westen bis weit im Osten gesehen hatten. Keiner von ihnen konnte ahnen, dass dies nicht nur das Ende der langen Wanderung dieses einzigartigen riesigen Albino-Elefanten war, sondern auch der Beginn der noch viel größeren Reise von etwas, was erst lange später aus der Spitze seines Stoßzahns erschaffen werden würde: einem Adler mit seiner Jagdbeute.