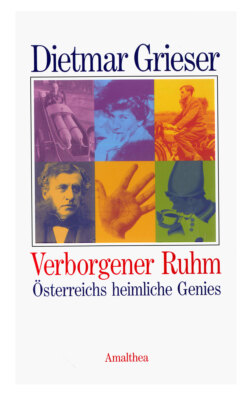Читать книгу Verborgener Ruhm - Dietmar Grieser - Страница 7
Für Elise Die Beethoven-Vertraute Therese von Malfatti
ОглавлениеFür Elise« – wer kennt sie nicht, Beethovens Klavierminiatur in a-Moll? Nur aus übergroßem Respekt vor dem Meister scheuen wir davor zurück, das häßliche Wort »Gassenhauer« in den Mund zu nehmen. Freuen wir uns statt dessen, daß das 1810 entstandene »Albumblatt«, das die Musikfeinspitze geringschätzig der Gattung »Bagatelle« zurechnen, auch den blutigen Anfänger in die Lage versetzt, sich an Beethoven zu versuchen. In Heumanns »Kunterbunter Spielkiste beliebter klassischer Melodien in leichter bis leichtester Fassung« steht es neben dem »Wiegenlied« von Johannes Brahms und Robert Schumanns »Träumerei«. Was seinen festen Platz im Kinderzimmer hat, kommt für den Konzertprofi höchstens als Zugabe in Betracht, obwohl auch er, unterdrückt er nur seine Vorbehalte gegen alles allzu Populäre und Abgespielte, aus dem 3-Minuten-Opus manches an Virtuosität herausholen könnte. Immerhin – Brendel und Buchbinder, Kempff und Ashkenazy waren sich nicht zu gut dafür, »Für Elise« sogar auf Schallplatte und/oder CD einzuspielen.
Eine andere Frage, die sich freilich weder der AnfängerDreikäsehoch noch der Meisterpianist zu stellen pflegt, ist die Frage nach der Identität der Widmungsträgerin: Wer ist sie eigentlich, diese Elise? Hat es sie tatsächlich gegeben?
Ja, hat es. Nur hieß sie nicht Elise. Sondern Therese. Als man 1867, vierzig Jahre nach Beethovens Tod, daranging, das Stück zum Druck zu befördern und somit für die Öffentlichkeit freizugeben, ereignete sich ein folgenschwerer Fehler: Beim Entziffern der kaum leserlichen Handschrift des Meisters deutete man den Namenszug, der in Wahrheit »Therese« heißen sollte, leichtfertig als »Elise«, und dabei ist es – überhaupt, nachdem das Originalmanuskript in Verlust geraten war – geblieben. Dabei hätte man sich nur die Mühe zu machen brauchen, die Entstehungsgeschichte des vielgeliebten, vielgeschmähten Werkchens aufzuhellen.
Bald zehn Jahre ist es her, daß sich Beethovens Gehörschwäche zum erstenmal bemerkbar gemacht hat. Nun, Ende Oktober 1808, kommt auch noch hinzu, daß sich bei dem knapp Achtunddreißigjährigen eine gewisse Wien-Müdigkeit einstellt: Der König von Westfalen, Napoleons jüngster Bruder Jérôme Bonaparte, hat die Absicht geäußert, Beethoven als Kapellmeister an seinen Hof zu berufen. Ein Sendbote trifft in Wien ein, der ihn mit dem Offert eines Gehalts von 600 Golddukaten nach Kassel locken soll.
Die durchwegs habsburgtreuen Wiener Mäzene schrecken auf, als sie erfahren müssen, ihr Schützling habe ernstlich vor, auf das Angebot aus dem Norden einzugehen: Es muß also gehandelt werden – und zwar rasch. Tatsächlich gelingt es Erzherzog Rudolph sowie den Fürsten Lobkowitz und Kinsky, den Wankelmütigen von dem fatalen Schritt abzuhalten und weiterhin an seine Wahlheimat zu binden. Am 1. März 1809 wird der entsprechende Vertrag unterzeichnet: Er sieht – »auf Lebenslänge« – die Zahlung einer Jahresrente von 4000 Gulden vor; Beethoven spekuliert außerdem auf Stellung und Titel eines kaiserlichen Kapellmeisters.
Unter den Freunden, die sich sogleich ans Werk machen, für Beethovens Verbleib in Wien die nötigen Konzepte zu erstellen, tun sich in erster Linie Gräfin Anna Marie Erdödy, die ihn gegenwärtig im Pasqualati-Haus auf der Mölkerbastei beherbergt, der Cellist Nikolaus von Zmeskall und ganz besonders Ignaz Freiherr von Gleichenstein hervor, letzterer übrigens unter ausdrücklichem Hinweis auf Beethovens »Patriotismus für sein zweites Vaterland«.
Gleichenstein, fast so etwas wie sein Sekretär, macht sich dem Meister schon seit Jahren nützlich, indem er ihn im Umgang mit den Verlegern berät, ihm die Geschäftskorrespondenz aufsetzt und überhaupt jede erdenkliche Gefälligkeit erweist. Der »liederliche Baron«, wie Beethoven ihn scherzweise nennt, sei zwar »kein Kenner von Musik, aber doch ein Freund alles Schönen und Guten«. Da ist es kein Wunder, daß er, dem selber so wenig Glück beschieden ist im Anknüpfen dauerhafter Beziehungen zum anderen Geschlecht, Freund Gleichenstein auch als Postillon d’amour einspannt. »Nun kannst Du mir helfen eine Frau suchen, wenn Du eine schöne findest, die vielleicht meinen Harmonien zuweilen einen Seufzer schenkt«, schreibt er ihm am 12. März 1809 nach Freiburg, wo sich Gleichenstein momentan aufhält, um auf seinen dortigen Besitzungen nach dem Rechten zu sehen.
Der acht Jahre Jüngere, ein ebenso lebhafter wie charmanter Mann, ist seit kurzem mit Nanette von Malfatti verlobt, einer der beiden Töchter des Gutsherrn Jakob Friedrich von Malfatti, der den Sommer über samt Familie auf seinen Besitzungen in Walkersdorf bei Krems residiert und nur die Wintermonate in Wien verbringt.
Mit den Malfattis, die ursprünglich in der Toskana beheimatet sind, pflegt auch Beethoven Umgang: Dr. Johann Malfatti, der jüngere Bruder des Genannten, ein hochangesehener Mediziner, der später unter anderem Erzherzogin Beatrix von Este und Erzherzog Carl zu seinen Patienten zählen, den kränkelnden Herzog von Reichstadt betreuen, die Wiener Medizinische Gesellschaft gründen, als Autor eines »Entwurfs einer Pathogenie« hervortreten und während des Wiener Kongresses eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielen wird, ist seit 1808 auch Beethovens Leibarzt.
Ob es diese Verbindung ist oder aber Baron Gleichensteins bevorstehende Vermählung mit Nanette, was Beethoven auch privat den Zutritt zu den Malfattis eröffnet – gleichviel: Der Neununddreißigjährige macht zu Beginn des Jahres 1810 die Bekanntschaft von Nanettes Schwester Therese, erteilt der Talentierten wohl auch gelegentlich Klavierunterricht, und vor allem: Er verliebt sich in die 21 Jahre Jüngere. Von der Hofschauspielerin Antonie Adamberger als »eines der schönsten Mädchen von Wien« beschrieben, ist Therese ein kluges Persönchen von feurigem Temperament, eine brünette Erscheinung mit dunklen Augen und dunklem Teint, dem Charakter nach freilich auch »ein wenig flüchtig, alles im Leben leicht behandelnd«.
Als Gleichenstein im April 1810 ein Treffen mit seiner Braut Nanette, deren Schwester Therese und dem in letztere frisch verliebten Beethoven arrangiert, gibt dieser in einem Dankbillett an den Freund nicht nur seiner Vorfreude auf das gemeinsame Mahl im Praterlokal »Zum Wilden Mann« Ausdruck, sondern fügt ausdrücklich hinzu: »Dafür muß ich mich auch erst noch harnischen.« Beethoven, normalerweise sein Äußeres vernachlässigend, wirft sich also in Schale.
Noch ist es freilich nur die Musik, die den Meister mit seiner jugendlichen Schülerin verbindet: Die von ihr selbst begonnene Kopie des Mignon-Liedes wird von Beethoven vervollständigt und mit dem Begleittext versehen: »Die Verschönerungen der Fräulein Therese in diesem Lied hat der Autor gewagt, an das Tageslicht zu befördern.« Auch, daß er ihr eine eigene Komposition widmet (ebenjenes Klavierstück »Für Therese«, das später irrtümlich einer »Elise« zugeordnet werden wird), ist noch keineswegs als direkte Liebeserklärung anzusehen: »Albumblätter« wie dieses sind in jenen Tagen gang und gäbe. Der insgeheim Angebeteten offen seine Gefühle zu bekunden, fehlt es Beethoven an Mut. Da muß – wie so oft schon – wieder einmal Freund Gleichenstein einspringen.
Gänzlich untätig bleibt der Meister dennoch nicht: Beethoven erneuert seine Garderobe, schickt Gleichenstein einen ansehnlichen Geldbetrag, damit er ihm »Leinwand oder Bengalen für Hemden und wenigstens ein halbes Dutzend Halstücher« kaufe, bestellt bei einem der besten Schneider Wiens mehrere Anzüge, borgt sich von Freund Zmeskall, weil »der meinige gebrochen« ist, dessen Wandspiegel aus und schreibt seinem Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler nach Koblenz, er möge »die Reise nach Bonn machen«, um ihm, »was nur immer für Unkosten dabei sind«, den Taufschein zu beschaffen. Mit einem Wort: Beethoven trifft – wohl zum erstenmal in seinem Leben – Hochzeitsvorbereitungen.
Die Familie Malfatti ist unterdessen – wie alljährlich um diese Zeit – von ihrem Wiener Winterquartier wieder aufs Land hinaus gezogen; Briefe nach Walkersdorf sind also nun die einzige Verbindung zu der Angebeteten. Ende Mai 1810 schreibt er ihr aus Wien:
»Ich lebe sehr einsam und still. Obschon hier oder da mich Lichter aufwecken möchten, so ist doch eine unausfüllbare Lücke, seit Sie alle fort von hier sind, in mir entstanden, worüber selbst meine Kunst, die mir sonst so getreu ist, noch keinen Triumph hat erhalten können.«
Umso heftiger seine Hoffnung, Therese bald nachreisen und ihr im Kreise der Ihren seine Aufwartung machen zu können: »Wie froh bin ich, einmal in Gebüschen, Wäldern, unter Bäumen, Kräutern, Felsen wandeln zu können. Kein Mensch kann das Land so lieben wie ich – geben doch Wälder, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch wünscht.«
Daß er sich diese »Glückseligkeit«, auf die er sich »kindlich freut«, nicht vor Juni verschaffen kann, liegt daran, daß Beethoven erst noch die Uraufführung seiner EgmontMusik am Hoftheater abwarten muß. Auch liegt noch keinerlei Einladung aus Walkersdorf vor, die wohl nur – man ist sehr standesbewußt im Hause Malfatti – von Thereses Eltern ausgesprochen werden kann. Zur Überbrückung der Wartezeit schickt er der Verehrten Noten:
»Vergessen Sie doch ja nicht in Ansehung Ihrer Beschäftigungen das Klavier oder überhaupt die Musik im ganzen genommen. Sie haben so schönes Talent dazu.«
Gleichzeitig kündigt er an, ihr in Bälde »einige andere Kompositionen von mir« zu schicken. Auch empfiehlt er Therese die Lektüre von Goethes »Wilhelm Meister« und des »von Schlegel übersetzten Shakespeare«. Um ihr nur ja nicht zur Last zu fallen, schränkt er ein:
»Vielleicht sehen Sie mich an einem frühen Morgen auf eine halbe Stunde bei Ihnen – und wieder fort. Sie sehen, daß ich Ihnen die kürzeste Langeweile bereiten will.«
Natürlich ist sich Beethoven darüber im klaren, daß er zur Realisierung seiner Wünsche nicht nur auf Thereses Gunst, sondern vielleicht noch mehr auf die ihrer Eltern angewiesen ist:
»Empfehlen Sie mich dem Wohlwollen Ihres Vaters, Ihrer Mutter, obschon ich mit Recht noch keinen Anspruch drauf machen kann.«
Auch in der Schlußformel des Briefes klingen Zweifel an, wenn nicht gar ein Anflug von Resignation:
»Leben Sie nun wohl, verehrte Therese. Ich wünsche Ihnen alles, was im Leben gut und schön ist. Erinnern Sie sich meiner und gern. Seien Sie überzeugt, niemand kann Ihr Leben froher, glücklicher wissen wollen als ich – und selbst dann, wenn Sie gar keinen Anteil nehmen an Ihrem ergebensten Diener und Freunde …«
Gleichzeitig schaltet er ein weiteres Mal Freund Gleichenstein ein; ihm schreibt er:
»Hier die Sonate, die ich der Therese versprochen. Da ich sie heute nicht sehen kann, so übergib sie ihr. Empfehl mich ihnen allen. Mir ist so wohl bei ihnen allen; es ist, als könnten die Wunden, wodurch mir böse Menschen die Seele zerrissen haben, durch sie geheilt werden. Ich danke Dir, guter Gleichenstein, daß Du mich dorthin gebracht hast.«
Doch der »gute Gleichenstein« scheint mit seiner Mission, in Beethovens Namen bei den Malfattis um die Hand ihrer Tochter Therese anzuhalten, zu scheitern. Beethovens nächster Brief an ihn drückt die ganze Verzweiflung aus, die die offensichtlich barsche Zurückweisung des Brautwerbers bei ihm ausgelöst hat:
»Deine Nachricht stürzte mich aus den Regionen des Glücks wieder tief herab. Ich kann also nur wieder in meinem eigenen Busen einen Anlehnungspunkt suchen. Nein, nichts als Wunden hat die Freundschaft und ihr ähnliche Gefühle für mich. So sei es denn! Für Dich, armer Beethoven, gibt es kein Glück von außen. Du mußt Dir alles in Dir selbst erschaffen, nur in der idealen Welt findest Du Freunde.«
Die Enttäuschung geht so tief, daß sie sogar Beethovens Beziehung zu Gleichenstein vorübergehend belastet. Und muß es ihn nicht tatsächlich doppelt schmerzen, daß das Glück, das ihm selber versagt bleibt, umso ungetrübter dem Freund zuteil wird? Zwar zieht sich auch dessen Verlobungszeit länger hin als gewünscht, aber im Jahr darauf ist es dann doch so weit, daß Baron Ignaz von Gleichenstein endlich mit Thereses Schwester Nanette vor den Traualtar treten kann. Therese selber muß noch fünf Jahre warten, bis die Eltern in eine Eheschließung ihrer Erstgeborenen einwilligen: Sie heiratet 1816 den Hofrat Baron Johann Wilhelm von Drosdick. Ihren abgewiesenen Brautwerber Beethoven überlebt sie um 24 Jahre; am 27. April 1851 stirbt sie sechzigjährig in Wien.