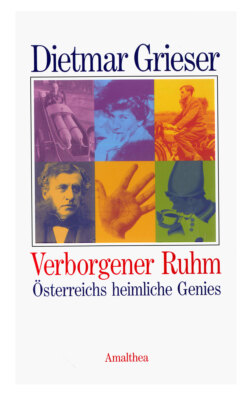Читать книгу Verborgener Ruhm - Dietmar Grieser - Страница 8
Geierwally wider Willen Die Malerin Anna Stainer-Knittel
ОглавлениеAm 22. Juni 1863 erscheint in der »Tiroler Volks- und Schützenzeitung« ein Bericht »aus dem Lechthale«; sein Wortlaut:
»Die vaterländische Künstlerin Anna Knittel von Untergiblen, deren Leistungen als Malerin bereits rühmend erwähnt worden sind, hat jüngst ein gefährliches Jagdabenteuer bestanden, ein Abenteuer, in welches sonst nur kühne Jäger sich einzulassen gewohnt sind. Am 11. Juni morgens holte nämlich dieselbe einen jungen Steinadler aus dem Horste einer wohl 90 Klafter hohen überragenden Felswand auf der Alpe Sax. Glücklich hatte sie des Adlers Nest erreicht und war schon mehrere Klafter an dem Seile, an welchem sie über die Felswand hinabgelassen worden war, in die Höhe gezogen, als sich ein ungeheures Felsstück, an das sie mit dem Fuße stieß, plötzlich ablöste und mit furchtbarem Getöse in den Abgrund stürzte. Glücklicherweise wurde die kühn in der Luft schwebende Adlerjägerin vom abgelösten Gestein nur am rechten Arme leicht verletzt und erreichte sonst wohlbehalten mit ihrer Beute den festen Boden. Jetzt ist sie wieder vollkommen hergestellt und lebt in künstlerischer Thätigkeit, von welcher wir demnächst die Vollendung eines trefflichen Stückes erwarten können.«
Das »treffliche Stück«, das die dreiundzwanzigjährige Volksmalerin aus dem Tiroler Oberland in Arbeit hat, kann ebensogut eine ländliche Szene wie ein Familienporträt oder eine jener Berglandschaften sein, für die sie seit einiger Zeit in ihrem Heimatort Elbigenalp bekannt ist. Auch im Jahr darauf verbringt Anna Knittel so manchen Tag vor ihrer Staffelei, und diesmal ist es sie selbst, die sie mit Pinsel und Palette in einem 174 mal 123 Zentimeter großen Ölbild festhält: In Erinnerung an ihr Bravourstück vom vergangenen Sommer zaubert Nanno, wie sie von ihrer Familie gerufen wird, ihr waghalsiges Abenteuer mit dem aus seinem Nest »entführten« Adlerjungen auf die Leinwand.
Unsere Künstlerin ist selig vor Glück, wenn sich für ihre Werke Käufer finden. Noch mehr als der Erlös freut sie nämlich die Anerkennung, die sich darin ausdrückt: Professionelles Malen ist zu dieser Zeit eine Domäne der Männer, die Frau hat ihren Platz am Küchenherd und im Kindbett. Daß Anna Knittel mit ihrer Kunst Anklang findet, ja sogar gute Geschäfte macht, erfüllt sie also mit Stolz. Dieses ihrer Ölgemälde, im Sommer 1864 entstanden, gibt sie allerdings nicht aus der Hand: Es bleibt ihr persönlichstes Eigentum. Und auch, als sie einige Jahre später, als jungverheiratete Frau nunmehr in Innsbruck ansässig, das »Adlerbild« im Schaufenster ihres Mannes, des Gipsfigurenformers und Andenkenhändlers Engelbert Stainer, ausstellt, denkt sie keinen Augenblick an Verkauf: Es soll nur als Blickfang dienen, soll Laufkunden in den Laden locken.
Eine, die solcherart auf die Kunst der nunmehrigen Anna Stainer-Knittel aufmerksam, ja vom Anblick der dramatischen Szene des von Frauenhand aus dem Felsnest geholten Jungadlers zutiefst aufgewühlt wird, daraufhin Erkundigungen nach dem realen Hintergrund des Motivs anstellt und schließlich aus dem Munde der Heldin selber von deren lebensgefährlicher Aktion erfährt, ist die Münchner Romanautorin Wilhelmine von Hillern. Die vier Jahre Ältere, die es als Touristin häufig nach Tirol zieht, weilt wieder einmal für ein paar Tage in Innsbruck; blitzschnell erkennt sie, daß in der Geschichte der Adlerjägerin Anna Stainer-Knittel ein Romanstoff von enormer Brisanz schlummert. Schon ihre Bücher »Doppelleben«, »Ein Arzt der Seele« und »Aus eigener Kraft« haben mehrere Auflagen erlebt; um wieviel mehr noch müßte da das schaurig-schöne Drama von der Bergmaid, die mit ihrem Mut selbst die kühnsten Mannskerle aussticht, bei ihren Leserinnen einschlagen!
Wilhelmine von Hillern, als Schriftstellerin an der Seite eines badischen Gerichtspräsidenten und Kammerherrn selber ein frühes Beispiel geglückter weiblicher Emanzipation, versteht sich auf ihr Metier: In dichterischer Freiheit macht sie aus dem Adler einen Geier und aus der Anna eine Wally, auch die näheren Lebensumstände des Prototyps verändert sie nach ihren Vorstellungen, und aus dem zu dieser Zeit noch touristisch unentdeckten Lechtal verlegt sie den Ort der Handlung ins bekanntere Ötztal. 1875 erscheint »Die Geier-Wally« erstmals als Fortsetzungsroman in der »Deutschen Rundschau«, die auch Größen wie Theodor Storm, Theodor Fontane und Gottfried Keller zu ihren Mitarbeitern zählt. Damit wird zugleich der Weg frei für die Buchfassung: Wilhelmine von Hillerns Heimatroman aus den österreichischen Bergen wird ein Langzeiterfolg, dem Übersetzungen in mehrere Fremdsprachen sowie eine von der Autorin selbst angefertigte Bühnenversion folgen, die ihrerseits bald zum Standardprogramm aller Tiroler Volksbühnen zählt.
Spätestens im Jänner 1892, als die »Geier-Wally« unter dem Namen »La Wally« auch die Opernbühne erobert, steht fest, daß sich die Geschichte der Lechtalerin Anna Stainer-Knit-tel zur weit über den Originalschauplatz Tirol hinaus verbreiteten Legende, ja zum Mythos verselbständigt hat: Der im Sommer 1888 von der Mailänder Zeitschrift »La Perseveranza« abgedruckte Fortsetzungsroman »La Wally dell’ Avvoltoio« hat den vierunddreißigjährigen, aus dem toskanischen Lucca stammenden Komponisten Alfredo Catalani auf die Idee gebracht, den brisanten Stoff zu vertonen. Luigi Illica, bald auch einer der geschätztesten Librettisten Giacomo Puccinis, schreibt das Textbuch, Bühnenausstatter und Kostümbildner reisen, um der Inszenierung ein Höchstmaß an »verismo« zu verleihen, zu einem Lokalaugenschein in die Tiroler Berge, und kein Geringerer als Arturo Toscanini studiert die Musik ein: Die Uraufführung am Opernhaus von Turin wird ein triumphaler Erfolg. Noch 1968, sechsundsiebzig Jahre nach der Entstehung des Werkes, nehmen Renata Tebaldi und Mario del Monaco »La Wally« auf Schallplatte auf, und auch die Wiederentdeckung der im deutschen Sprachraum lange vergessenen Catalani-Oper (bei den Bregenzer Festspielen des Jahres 1990) geht dem Publikum unter die Haut. Daß sie es dabei mit einer trotz aller künstlerischen Verfremdung »wahren« Geschichte zu tun haben, erfahren die Zuschauer, denen Wilhelmine von Hillerns Romanbestseller von 1875 kein Begriff mehr ist, erst aus dem Programmheft.
Nur ihre Eltern oder Großeltern würden sich vielleicht an zwei Kinofilme aus den Jahren 1921 bzw. 1940 erinnern, die beide – und ebenfalls mit durchschlagendem Erfolg – die Geierwally-Story nacherzählt haben: ersterer, noch ohne Sprechton, mit Henny Porten in der Hauptrolle, letzterer mit der einundzwanzigjährigen Heidemarie Hatheyer, für die die Verkörperung der Titelfigur der Durchbruch zur Starkarriere ist. Die gebürtige Villacherin, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf den renommiertesten deutschen und Schweizer Bühnen Furore machen, zeitweilig dem Ensemble des Wiener Burgtheaters angehören und eine der »Jedermann«-Buhlschaften der Salzburger Festspiele sein wird, legt sich bei den Dreharbeiten im Ötztal, bei denen Mitglieder der berühmten Tiroler Exlbühne sowie eine große Zahl von Laiendarstellern mitwirken, so sehr ins Zeug, daß sie sich nachher, um sich von den mehrmonatigen Strapazen bei Kälte, Schnee und Sturm zu erholen, in Sanatoriumspflege begeben muß.
Daß die Figur der Geierwally auch in Zukunft durch die Köpfe der Drehbuchautoren und Bühnenschriftsteller geistern wird, beweisen das Kino-Remake von 1956, für das Barbara Rütting vor die Kamera geholt wird, sowie zwei neuere Theaterfassungen, für die der Tiroler Felix Mitterer und der Steirer Reinhard P. Gruber verantwortlich zeichnen. Sogar die moderne Tourismuswerbung greift bei ihrem Bemühen, Tirol als »starkes Land« darzustellen, eines Tages auf das bewährte Motiv zurück.
Bei so vielfältiger Ausschlachtung des Geierwally-Themas ist es kein Wunder, daß sich die Kopien mehr und mehr vom Original entfernen, ja das eigentliche Urbild der Figur bald kaum noch zu erkennen ist. Anna Stainer-Knittel, die ein Alter von knapp 75 erreicht, also noch zu Lebzeiten – zumindest teilweise – Zeuge ihrer ausschweifenden medialen Nutzung wird, mag sich darüber ihre eigenen Gedanken gemacht haben, und vielleicht findet sich manches davon sogar in ihren Lebenserinnerungen wieder, die sie auf Drängen ihrer Familie handschriftlich niedergelegt hat. Eines jedenfalls steht fest: Das Abenteuer mit dem ausgehobenen Adlernest in der wenige Kilometer von ihrem Heimatort entfernten Saxenwand, das so viele Schriftsteller und Filmleute, ja sogar einen Opernkomponisten um den Schlaf gebracht hat, ist für sie selber nicht viel mehr als eine Episode. Anna Stainer-Knittel sieht sich am Ende ihrer Tage – sie stirbt am 28. Februar 1915 in dem Inntaler Industrieort Wattens – keineswegs als jene heroische Amazone, die dem starken Geschlecht vorexerziert, wie man die Jungtiere der bergbäuerlichen Schafherden davor schützt, von Raubvögeln »gerissen« zu werden, sondern einzig und allein als Kunstmalerin, die es mit ihren Landschaftsbildern, ihren Porträts und ihren Blumenstilleben zu einigem Erfolg gebracht, ja mit den Erlösen aus ihrer Kunst sogar wesentlich zum Lebensunterhalt ihrer mehrköpfigen Familie beigetragen hat.
Das Zeichnen »nach der Natur« ist schon in jüngsten Jahren eine von »Nannos« Lieblingsbeschäftigungen. Während ihre Geschwister der Mutter beim Kochen und Backen und dem Vater bei der Feldarbeit und beim Stallausmisten zur Hand gehen, zieht sich die am 28. Juli 1840 als Tochter des Lechtaler Büchsenmachers Joseph Anton Knittel Geborene schon als Schulmädchen mit Zeichenblock und Feder in die versteckten Winkel des Hauses zurück, um sich ganz dem »Bilderlmalen« hinzugeben. Immerhin sind die Eltern verständnisvoll genug, die Heranwachsende in die Zeichenschule des im Nachbarort wirkenden Lithographen Anton Falger zu schicken, und der ist es, der das außergewöhnliche Talent seines bald zur Lieblingsschülerin avancierenden Schützlings erkennt und Anna zwecks weiterer Vervollkommnung zu einem Studium an der Münchner Akademie der Bildenden Künste rät.
Das ist allerdings leichter gesagt als getan: Musentempel wie dieser sind um 1859 (dem Jahr, da Anna aus ihrem Tiroler Bergdorf in die bayerische Landeshauptstadt zieht) dem weiblichen Geschlecht noch verschlossen; der Neunzehnjährigen bleibt nichts anderes übrig, als in der »Vorschule« der Akademie noch einmal ganz von vorne anzufangen – und das »als einziges Frauenzimmer unter lauter Herren«. Da aber insbesondere ihre Porträtmalerei schon zu dieser Zeit einen Höchstgrad an Reife erreicht hat, ist Anna Knittel, als sie vier Jahre darauf in die Heimat zurückkehrt, eine gefragte Künstlerin, der es nicht an ehrenvollen Aufträgen mangelt: Das Ferdinandeum, die führende Kunstsammlung Tirols, kauft eines ihrer Selbstbildnisse an, und die Innsbrucker Schützengilde bestellt bei ihr großformatige Porträts von Erzherzog Karl Ludwig und Generalfeldmarschall Radetzky. In ihrer Münchner Zeit noch von der Hand in den Mund lebend, steht sie nunmehr auf eigenen Beinen, und als sie weitere vier Jahre später – gegen den Willen des Vaters – den Gipsformer Engelbert Stainer ehelicht, geht es der inzwischen Siebenundzwanzigjährigen keineswegs um Versorgung: Es ist eine Liebesheirat (und wird eine Liebesheirat bleiben bis ans Ende ihrer Tage).
Die Porträtfotos aus dieser Zeit zeigen eine selbstbewußte junge Frau, deren Kurzhaarschnitt einer ungeheuerlichen Provokation gleichkommt. Nur, als sie darangeht, an ihrem nunmehrigen Wohnsitz Innsbruck eine Zeichen- und Malschule ins Leben zu rufen, stößt Anna Stainer-Knittel an die Grenzen ihres emanzipatorischen Eifers: An ihren Kursen dürfen ausschließlich weibliche Schüler teilnehmen.
Ein weiteres Problem, das ihre künstlerische Bewegungsfreiheit einengt, rührt vom nunmehrigen Aufkommen der Photographie: Statt dem Porträtmaler Modell zu sitzen, gebietet es die Zeitmode, sich im Atelier des Photographen ablichten zu lassen. Auch für eine Könnerin wie Anna Stainer-Knittel werden die einschlägigen Aufträge also rarer und rarer. Der Ausweg, den sie aus der neuen Situation sucht und findet, erweist sich allerdings als glückliche Fügung: Sie sattelt auf Blumenmalerei um und gewinnt auf diesem Gebiet – Motto: »Ein Blumenstrauß, der nie verwelkt!« – nicht nur neue Kundschaft, sondern ungeahnte Popularität.
Einmal – es ist um die Jahreswende 1870/71 – kommt es allerdings doch noch zu einem spektakulären Porträtauftrag: Kaiser Franz Joseph will – auf dem Weg von Wien nach Meran, wo ein Kurzbesuch bei Kaiserin Elisabeth und Töchterchen Valerie ansteht – einen Zwischenaufenthalt in Innsbruck einlegen. Die Schützen und Jäger der Tiroler Landeshauptstadt rüsten zu einem Festabend für Seine Majestät, die Redoutensäle werden mit Tannengrün, Geweihen und Jagdgerät geschmückt. Jetzt braucht man nur noch ein repräsentatives Konterfei des hohen Gastes: Anna Stainer-Knittel wird aufgefordert, binnen weniger Tage ein lebensgroßes Porträt des Kaisers anzufertigen. Als Vorlage dient ihr ein Stich des Wiener Hofmalers Franz Schrotzberg. Das 240 mal 170 Zentimeter große Ölbild wird nicht nur angemessen honoriert, sondern allseits gewürdigt, und was für die kaisertreue Künstlerin vielleicht der höchste Lohn ist: Anna Stainer-Knittel, in ihr schönstes Trachtengewand gehüllt, wird Franz Joseph I. vorgestellt. Auch er spart nicht mit Lob für das wohlgelungene Werk und fragt die Dreißigjährige, ob sie denn öfter zu Pinsel und Palette greife. Ihre selbstbewußte Antwort: »Sehr wohl, Majestät. Malen ist mein Beruf.«
Andere, die dies längst erkannt haben, sorgen dafür, daß endlich auch das Ausland auf das Werk der Frau aus den Tiroler Bergen aufmerksam wird, und dafür bietet sich keine bessere Gelegenheit als die Wiener Weltausstellung von 1873: Das Bild »Rautenpflückende Lechtalerinnen« erhält nicht nur (übrigens in nächster Nachbarschaft von Makarts berühmtem Gemälde »Venedig huldigt Catarina Cornaro«) einen hervorragenden Platz im Wiener Künstlerhaus, sondern wird zum Spitzenpreis von 55 Gulden nach England verkauft. Um diesbezüglich keinen falschen Verdacht aufkommen zu lassen, sei in aller Klarheit festgestellt: Was beim Zustandekommen der genannten Transaktion den Ausschlag gibt, ist einzig und allein die Qualität des Bildes und keineswegs die Berühmtheit von Anna Stainer-Knittels Alter ego als »Adler-Bezwingerin«: Von einer »Geierwally« hat der aus London angereiste Käufer nie etwas gehört.