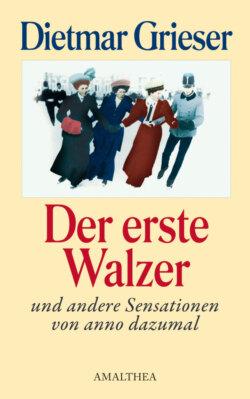Читать книгу Der erste Walzer - Dietmar Grieser - Страница 10
Bürgermeister von Habsburgs Gnaden
ОглавлениеDas Wort »Bürgermeister« taucht hierzulande erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 1340 auf. Vorher hält man sich strikt ans Lateinische, bezeichnet das Stadtoberhaupt von Wien als »magister civium«. Das aus dieser Zeit erhalten gebliebene Dokument ist mit dem 22. August 1282 datiert; der darin genannte Chunradus dictus Pullo – auf deutsch: Konrad Poll – wäre demnach der erste Amtsträger, der mit der Würde eines Wiener Bürgermeisters ausgestattet worden ist.
Viel ist es nicht, was wir über ihn wissen. Versuchen wir, das Wenige, das uns die Chroniken überliefern, zusammenzukratzen. Und verlieren wir dabei nicht aus dem Auge, daß das damalige Wien mit dem heutigen in keiner Weise vergleichbar ist. Die Stadt zählt nicht einmal 20 000 Einwohner; ihre Zentren bilden die Burg (wovon sich übrigens der Begriff »Bürgermeister« ableitet), die dem heiligen Ruprecht geweihte Hauptkirche sowie die Filialkirchen von St. Peter und Maria am Gestade, weiters ein Friedhof, ein Marktplatz und ein Donauhafen. Verteidigungsmauern umschließen den mittelalterlichen Stadtkern. Dem aufstrebenden Bürgertum wird es erstmals gestattet, zweistöckige Häuser zu errichten; in der Vorweihnachtszeit nimmt auch bereits ein Vorläufer der später so populären Christkindlmärkte Gestalt an.
Seit dem 26. August 1278, da Böhmenkönig Ottokar II. bei der Schlacht von Dürnkrut nicht nur seine Macht, sondern auch sein leibliches Leben eingebüßt hat, sind in den österreichischen Erblanden die Habsburger am Ruder: Rudolf I. bestellt seinen ältesten Sohn Albrecht zum Reichsverweser.
Ein Bürgermeister hat da nur wenig zu vermelden: Die städtische Autonomie hängt noch ganz von der Willkür des Landesherrn ab. Wer gegen die fürstlichen Gnaden allzu keck aufmuckt, muß mit Sanktionen rechnen: Zwei von Polls Nachfolgern auf dem Bürgermeistersessel, Konrad Vorlauf und Wolfgang Holzer, landen auf dem Schafott. Mit eigenen »Treubriefen« lassen sich die Habsburger die unumschränkte Loyalität der städtischen Ratsherren bescheinigen; auch Bürgermeister Poll kann nur so lange seines Amtes walten, wie er das Vertrauen der Obrigkeit genießt.
Das ist immerhin fast zwanzig Jahre lang der Fall – bis zu seinem irgendwann zwischen 1305 und 1307 eintretenden Tod (Genaueres wissen wir auch da nicht). Konrad Poll muß jedoch seine Arbeit zur allgemeinen Zufriedenheit verrichtet und sich einen guten Namen gemacht haben, sonst würden nicht auch sein Sohn Niklas und sein Enkel Berthold in späteren Jahren das Amt des Wiener Bürgermeisters bekleidet haben.
Die Polls sind Zuzügler, stammen aus Bayern, gelangen Mitte des 13. Jahrhunderts aus dem Regensburger in den Wiener Raum. Als angesehene Patrizier führen sie selbstverständlich ein eigenes Familienwappen; es zeigt – in Anspielung auf pullus, die lateinische Version ihres Namens – eine Henne. Dasselbe Motiv ziert auch ihr Siegel, mit dem alle einschlägigen Urkunden beglaubigt und alle für den Versand bestimmten Schriftstücke verschlossen werden.
Der Ort im Süden von Wien, an dem sich Vater Poll und die Seinen niederlassen, ist Vöslau, und hier kommt um 1240 Sohn Konrad zur Welt. Dreißig Jahre später wird nach Wien übersiedelt, Wohnhaus und Garten befinden sich am alten Fleischmarkt, zu ihren Besitzungen zählt außerdem ein Lehen in der Wachau. Konrad heiratet die Tochter eines wohlhabenden Handelsherrn aus dem Rheinland namens Seifried Leubel und erbt auf diesem Wege dessen zwischen Lugeck und Fleischmarkt gelegene Wiener Niederlassung (die in späterer Zeit den beziehungsvollen Namen Kölnerhof erhalten wird).
Konrad Poll erfüllt also alle Bedingungen für den Aufstieg zum Wiener Ratsherrn: Er gehört dem »Geldadel« an, verfügt über reichen Haus- und Grundbesitz, ist finanziell unabhängig. Das ist deshalb von Wichtigkeit, weil die Spitzenposten in der städtischen Verwaltung zu dieser Zeit nur geringfügig dotiert sind. Zwar stehen dem Bürgermeister und seinen Ratsherren eine Reihe von Privilegien zu, darunter das sogenannte »WeihnachtsKleinod« in Gestalt eines vergoldeten Trinkbechers, ein »Pfingstgewand« und ein alljährlich während der Fastenzeit ausgeschüttetes »Hausengeld«, doch handelt es sich bei alledem eher um symbolische Ehrenbezeugungen als um Unterhaltsleistungen. Auch für den Aufwand bei den Ratssitzungen muß der »magister civium« selber aufkommen: Da in den Aufzeichnungen aus jener Zeit nichts über Versammlungsorte zu lesen ist und der Bau des Alten Rathauses erst in die Amtsperiode seines Nachfolgers fällt, ist anzunehmen, daß Konrad Poll die turnusmäßigen Ratssitzungen in den eigenen vier Wänden abhält.
Zwei markante Ereignisse fallen in Polls Amtszeit. Da ist einmal die mit 12. Februar 1296 datierte Verleihung eines neuen Stadtrechtes, das die Beziehungen zwischen Wien und dem Landesfürsten regelt. An die Stelle des vormals dominierenden Stadtrichters tritt ein Kollegium freigewählter Stadträte – mit dem Bürgermeister an der Spitze. Allzu viel zu sagen haben die Herren allerdings nicht: Die städtische Autonomie bleibt im wesentlichen auf Marktaufsicht und Polizeiangelegenheiten beschränkt. Kein Wunder, daß die von Herzog Albrecht Geknebelten über die landesfürstliche Übermacht murren und mehr als einmal die »Schwaben« (wie das Schmähwort für die aus dem Alemannischen stammenden Habsburger lautet) zum Teufel wünschen.
Das zweite Ereignis, das mit dem Namen Konrad Poll verbunden ist, ist die Erweiterung der Stephanskirche. Der 1147 geweihte romanische Bau hat sich mit den Jahren als zu klein erwiesen, soll durch einen gotischen Zubau ausgedehnt werden. Um den dafür nötigen Platz zu schaffen, kauft man dem Stift Zwettl ein in dessen Besitz befindliches Grundstück ab; außerdem wird der dem Gotteshaus vorgelagerte Roßmarkt in die Gegend der heutigen Renngasse verlegt.
Bezüglich Bürgermeister Polls weiteren Wirkens tappen wir im Dunkeln: Die Quellen sind dürftig, und da sich auch kein Porträt von ihm erhalten hat, sind wir hinsichtlich seiner äußeren Erscheinung auf unsere Phantasie angewiesen. Nicht einmal sein genaues Sterbedatum steht fest. Nur aus dem Umstand, daß Irmgard Poll, seine zweite Frau, in einem Eintrag aus dem Jahr 1307 als Witwe bezeichnet wird, die zu Ehren des Verstorbenen eine Gedenkfeier im Stift Heiligenkreuz abhalten läßt, ist zu schließen, daß Wiens erster Bürgermeister jedenfalls ein Alter von höchstens 67 Jahren erreicht hat.
Seine Nachfolge als Stadtoberhaupt tritt der Tuchhändler Heinrich Chrannest an. Einem alten Handwerkergeschlecht entstammend, schafft auch er, der über etliche Liegenschaften, Gewandkeller und Fleischbänke Verfügende, den ehrenvollen Aufstieg zum Erbbürger; auf der Tuchlauben führt er ein großes Haus.
Vertieft man sich in die weitere Chronik aus der Frühgeschichte der Wiener Stadtverwaltung, trifft man noch mehrere Male auf den Namen Poll: Zwischen 1313 und 1326 übt sein Sohn Niklas, zwischen 1338 und 1339 sein Enkel Berthold das Amt des Stadtoberhauptes aus. Weitere Nachkommen bringen es zumindest bis zum Ratsherrn oder Stadtkämmerer; erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts verschwindet der Name Poll aus den Annalen, und dabei wird es bleiben: Das Wiener Telefonbuch von 2007 verzeichnet deren drei, und keiner dieser drei wäre so vermessen, für sich in Anspruch zu nehmen, ein Nachkomme des ersten Wiener Bürgermeisters zu sein. Der ist ein für allemal im Orkus der Geschichte untergegangen.