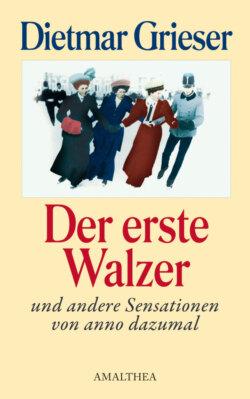Читать книгу Der erste Walzer - Dietmar Grieser - Страница 9
Das achtzehnte Kind
ОглавлениеIch bin seitens meiner Leserschaft verschiedentlich gerügt worden, daß ich es in meinem Buch »Die böhmische Großmutter« verabsäumt hätte, auch auf Karl Renner hinzuweisen. Der erste Staatskanzler der Republik Österreich stelle ja geradezu den Prototyp jenes Wieners dar, dessen Wurzeln im heutigen Tschechien liegen: Unter-Tannowitz, das nunmehrige Dolní Dujanovice, ist sein Geburtsort, und hier, acht Kilometer nördlich der südmährischen Kreisstadt Mikulov/Nikolsburg, hat er seine Kindheit verbracht und die Schule besucht.
Es ist wahr: Karl Renner ist mir bei meiner Spurensuche jenseits der österreichisch-tschechischen Staatsgrenze durch die Lappen gegangen. Ich will also Buße tun und das Versäumte nachholen, und da Renner nicht nur zu den Gründerfiguren der Ersten Republik zählt, sondern auch nach 1945 – und zwar sowohl als Regierungschef wie als Bundespräsident – Geschichte geschrieben hat, paßt er vorzüglich in das hier vorliegende Buch, das die diversen österreichischen »Erstlinge« zum Thema hat.
Ein Ausflug in die strittige Region, zwei Autostunden von Wien, lohnt sich allemal: Die Fahrt führt durch eine anmutige Landschaft aus Sonnenblumenfeldern und Weingärten; uralte Marterln und verwitterte Kellerstraßen säumen den Weg. Mikulov mit seinem hochaufragenden Schloß, seiner mächtigen Pestsäule, seinem von barocken Laubenhäusern umstandenen Marktplatz und den Überresten des Judenviertels ist ebenso eine Besichtigung wert wie die üppigen Parkanlagen des ehemaligen Liechtenstein-Schlosses Eisgrub/Lednice, das vor allem für seine historischen Gewächshäuser, für seine von Johann Bernhard Fischer von Erlach erbaute Reithalle und für sein 1797 in Erinnerung an die Türkenkriege errichtetes, 63 Meter hohes Minarett berühmt ist. Ferdinand Raimund hat den Ort in einer der Figuren seines Zaubermärchens »Der Bauer als Millionär«, dem kauzigen »Vetter aus Eisgrub«, verewigt, und Franz Grill-parzer hat dem über und über mit exotischen Pflanzen angefüllten Treibhaus mit dem Vierzeiler gehuldigt:
Regen läßt auf Glas sich hören,
scharfer Wind fällt schneidend ein;
ein Gewächshaus war mein Heim,
und mein Indien liegt in Mähren.
Mit solchen Reizen kann Karl Renners Geburtsort Unter-Tannowitz nicht aufwarten: Es ist ein Marktflecken, dem man noch immer die Mühe ansieht, sich von den Verwahrlosungen der KP-Ära zu erholen. Der Tourist, der nach altösterreichischer Nostalgik Ausschau hält, bleibt auf die Speisekarte des »Restau-race Praha« angewiesen, auf der er Gerichte wie »Rostbraten auf Wildschützenart«, »Omas wohlriechendes Kotelett« oder »Leckerbissen Karls IV.« findet. Zweisprachig auch das am ehemaligen Dorfanger errichtete Mahnmal »zum ewigen Gedenken an alle Gefangenen und Opfer des I. und II. Weltkrieges«; vertraute Heilige wie Florian und Nepomuk bewachen das den Dorfbach überquerende Brücklein; die die durchwegs namenlosen Straßen säumenden Häuser müssen mit den alten Katasternummern auskommen.
Was fast unverändert an seinem angestammten Platz steht, ist die Volksschule, in der der kleinwüchsige und unterernährte Keuschlersohn Karl Renner zwischen 1876 und 1881 seinen ersten Unterricht empfangen (und in der dritten Klasse – anläßlich der Vermählung von Kronprinz Rudolf – sein erstes Gedicht zu Papier gebracht) hat. Ansonsten: die auf einer kleinen Anhöhe stehende Pfarrkirche, die steinernen Überreste des alten Prangers, eine Weinhandlung, eine bescheidene Fremdenpension, ein moderner Supermarkt mit dem traditionellen Konsum-Emblem.
Das attraktivste Gebäude aus jüngster Zeit, mit seinen postmodernen Strukturen aus Spiegelglas und Stahlbeton kraß aus der Reihe tanzend, befindet sich in einer der Straßen am südlichen Ortsrand; die Aufschrift »Dum Dr. Karla Rennera« verrät, daß an dieser Stelle einst jenes Ganzlahnhaus Nr. 258 gestanden ist, in dem der berühmteste Sohn von Unter-Tannowitz seine ersten Lebensjahre verbracht hat. Es ist ein mit allen neuzeitlichen Einrichtungen – Vortragssaal, Tagungsräume, Bibliothek – ausgestattetes Veranstaltungszentrum, das dem Kulturaustausch zwischen Österreich und Tschechien dient, und damit dies vorrangig im Zeichen Karl Renners und der von ihm mitbegründeten Sozialdemokratie geschieht, ist in einem der Gänge eine Bronzebüste der Widmungsfigur aufgestellt, ja sogar ein aus Überbleibseln des Originalbaues – Mauerreste, ein Stückchen Ziegeldach, ein halber Türstock – gefertigtes Konstrukt in den modernen Baukörper eingefügt.
Die junge Frau, eine der wenigen Deutschsprechenden im Ort, die mich durch das 1990, also zum 120. Geburtstag Karl Renners errichtete Anwesen führt, schwankt in ihren Kommentaren zwischen Stolz und Enttäuschung: Das für das kleine Dolní Dujano-vice fast zu luxuriöse »Dum Dr. Karla Rennera« werde viel zu wenig genützt, stehe die meiste Zeit leer. Auch die beiden Bibliothekarinnen, die ich beim gemütlichen Kaffeeplausch antreffe, machen mir nicht den Eindruck übermäßiger Inanspruchnahme. Umso mehr freut es sie, mich mit der reichlich vorhandenen Renner-Literatur versorgen zu können; zur Schließung meiner diesbezüglichen Wissenslücken ziehe ich mich in eines der auch an diesem Tag leerstehenden Sitzungszimmer zurück.
Es hat seinen besonderen Reiz, sich in die Lebensgeschichte eines Menschen zu vertiefen, wenn man die dazugehörigen Örtlichkeiten dicht vor Augen hat. Hier also ist am 14. Dezember 1870 Karl Matthias Renner auf die Welt gekommen – als achtzehntes und letztes Kind seiner Eltern. Man muß es wieder und wieder lesen, um es für keinen Druckfehler zu halten: Achtzehn Mal kommt Mutter Renner nieder. Noch als halbes Kind ist die als einfältig und lammfromm Beschriebene mit dem Kleinbauern Matthäus Renner verheiratet worden; auch während ihrer unablässigen Schwangerschaften muß sie bei der Arbeit in Stall und Feld mit anpacken. Ihr Los wird noch schwerer, seitdem es mit dem Hof bergab geht: Vater Renner, nicht der Geschickteste im Wirtschaften, muß einen Acker nach dem anderen abstoßen, die Familie muß mit dem Existenzminimum auskommen.
Daß der kleine Karl, schon in jüngsten Jahren seinen Geschwistern in punkto Auffassungsgabe und Lerneifer weit voraus, trotz der drückenden Not im Elternhaus aufs Gymnasium geschickt wird, grenzt an ein Wunder. Er besteht die Aufnahmsprüfung, kommt bei einer Familie in der acht Kilometer entfernten Kreisstadt Nikolsburg in Kost. Doch schon bald geht den Eltern das Mietgeld für die Unterkunft ihres Jüngsten aus: Zweimal täglich und bei jedem Wetter muß der Bub den anderthalbstündigen Schulweg zu Fuß zurücklegen.
Ebendieser Schulweg ist es, der den Heranwachsenden eines Tages – es ist im Frühjahr 1883 – zum ersten Mal mit sozialistischem Gedankengut in Berührung bringt: Der ahnungslose Bauernbub macht unterwegs die Bekanntschaft eines arbeitslosen Handwerksburschen, der sich auf Stellungssuche befindet. Es ist ein Buchbindergeselle aus Schlesien, der, von Ort zu Ort wandernd, jetzt in Südmähren sein Glück versucht. Er begnügt sich nicht damit, seinem Gegenüber sein bitteres Los zu schildern, sondern macht ihm auch den Kopf heiß mit flammenden Reden gegen die ausbeuterischen Kapitalisten, und als es einige Zeit später noch zu der Begegnung mit einem sächsischen Schlossergehilfen kommt, der, gleichfalls auf der Walz, den Vierzehnjährigen mit den Parolen der sich nach und nach formierenden Arbeiterbewegung konfrontiert, beginnt im jungen Karl Renner jenes Bewußtsein zu keimen, das ihn in späteren Jahren zum leidenschaftlichen Vorkämpfer für die Besserstellung des Proletariats machen wird.
Noch auf dem Gymnasium in Nikolsburg setzt er die ersten Schritte für diesen seinen künftigen Lebensweg: Eben noch ein eifriger Ministrant und Chorsänger, beginnt er sich von der katholischen Kirche abzuwenden und vertieft sich in andere Religionen, liest Bücher über den Buddhismus, verschlingt die Werke sozialkritischer Autoren wie Henrik Ibsen, Emile Zola und Gerhart Hauptmann, setzt sich mit Nietzsche auseinander, erhebt Lessings »Nathan« zu seinem Credo.
Nicht nur, um sich das dringend nötige Taschengeld zu verdienen, sondern auch aus Solidarität mit dem Hungerleiderdasein der allenthalben anzutreffenden Taglöhner hilft er da und dort in Werkstätten aus und macht sich bei der Erntearbeit nützlich; gleichzeitig legt er, um sein intellektuelles Rüstzeug zu mehren, den gewohnten ländlichen Dialekt ab und bemüht sich, Hochdeutsch zu sprechen – und dies umso mehr, als er nun auch zu schreiben beginnt, Lyrik zunächst, doch bald auch die ersten »Memoranden« zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft.
Der eigentliche Wendepunkt in der geistigen Entwicklung des jungen Karl Renner tritt im Mai 1885 ein, als es im Elternhaus zur Katastrophe kommt: Der Besitz in Unter-Tannowitz muß versteigert werden, Vater und Mutter bleibt nur noch der Umzug ins Armenhaus. Zornbebend lehnt sich der Fünfzehnjährige gegen dieses Unrecht auf: Er gelobt, niemals wieder in seinen Geburtsort zurückzukehren.
Als Karl Renner nach der Matura, die er mit Auszeichnung besteht, nach Wien übersiedelt und – nach Ableistung seines Militärdienstes als Einjährig-Freiwilliger – sein Universitätsstudium aufnimmt, ist sein künftiger Berufsweg bereits klar vorgezeichnet: Ob als Hilfskraft in der Parlamentsbibliothek, als Mitarbeiter der Genossenschaftsbewegung, als Reichsratsabgeordneter oder als Verfasser staatspolitischer Schriften, fortan wird er nur noch einerSache dienen: der Stärkung der Sozialdemokratie.
Mit dem Zusammenbruch der Monarchie im November 1918 sieht sich Dr. jur. Karl Renner am Ziel: Er wird am 15. März 1919 zum Staatskanzler der Ersten Republik gewählt, führt noch im selben Jahr die deutschösterreichische Delegation zu den Friedensverhandlungen nach Saint-Germain, arbeitet an der provisorischen Verfassung, an der neuen Wahlordnung und an der aktuellen Gesetzgebung mit. Das »Spiel« wiederholt sich nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches im Frühjahr 1945: Wieder ist Karl Renner der Mann der ersten Stunde, übernimmt in der provisorischen Dreiparteienregierung die Kanzlerfunktion und ist zwischen 1945 und 1950 auch der erste Bundespräsident der wiedererstandenen Republik Österreich.