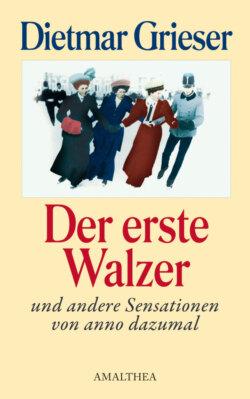Читать книгу Der erste Walzer - Dietmar Grieser - Страница 8
Bomben auf Venedig
ОглавлениеEr ist knapp 65, als ihn Kaiser Franz I. nach Mailand beordert und ihm das Kommando über die österreichischen Truppen in Oberitalien überträgt. Andere treten in diesem Alter in den Ruhestand – für Johann Josef Wenzel Graf Radetzky ist es der Auftakt für weitere 26 Jahre im Dienste Seiner Majestät.
Es sind keine leichten Jahre: Seitdem auf dem Wiener Kongreß die Unabhängigkeit der Italiener aufgehoben und das Königreich Lombardei-Venetien Österreich einverleibt worden ist, schwelt von Mailand bis Venedig der Haß auf Wien, und er konzentriert sich vor allem auf den Mann, der in den annektierten Gebieten für Ruhe und Ordnung sorgen soll. »Italien ist für mich nur ein geographischer Begriff!« hat Metternich verkündet, und Feldmarschall Radetzky obliegt es, mit seinem 109 000 Mann starken Heer den immer wieder aufflammenden Widerstand gegen die österreichische Hegemonie zu brechen.
1848/49 sind die eigentlichen Jahre der Bewährung für den inzwischen zweiundachtzigjährigen Radetzky: Es gelingt ihm, sowohl die Sardinier wie die Piemontesen zu bezwingen. Ob Santa Lucia, Curtatone, Vicenza oder Custozza – sämtliche großen Schlachten entscheidet der greise Heeresführer für sich. »In deinem Lager ist Österreich!« jubelt ihm Grillparzer zu, und Johann Strauß Vater huldigt ihm mit dem Radetzkymarsch.
Wo sich’s zuletzt nochmals kräftig spießt, ist Venedig: Seit März 1848 hält nun schon der Aufstand gegen die österreichischen »Eindringlinge« an, und »Nonno« Radetzky (wie die Italiener den Verhaßten mit ihrer Vokabel für »Großvater« verhöhnen) antwortet mit Belagerung. Der Einsatz ist gigantisch: 635 Geschütze bieten die k.k. Truppen auf, um den Widerstand zu brechen, 20 000 Granaten und 57 000 Hohlkugeln werden abgeschossen, 8000 Zentner Pulver aus 243 000 Schrotbüchsen. Die Feldakten verzeichnen den Verlust von fast 8000 Soldaten: Wer nicht im offenen Kampf fällt, stirbt am Lagunenfieber. Zwischen Oktober 1848 und August 1849 sind es 62 300 Kranke oder Verwundete, die in die Spitäler von Venedig und Umgebung eingeliefert werden.
In dieser verzweifelten Situation, die es gebietet, jedes erdenkliche Mittel zur Niederschlagung des Aufruhrs einzusetzen, erproben die Österreicher zum ersten Mal in der Geschichte des Militärwesens etwas, was man in späteren Jahren »Luftkrieg« nennen wird: Sie werfen über der belagerten Stadt Bomben ab. Franz Uchatius heißt der 37 Jahre alte, aus dem niederösterreichischen Theresienfeld stammende Artillerieoffizier, der da am 2. Juli 1849 in Venedig zum ersten Mal den Versuch unternimmt, »mittels unbemannter Luftballons Hohlgeschosse auszuwerfen«. Absolvent des Instituts für Chemie und Physik am Wiener Polytechnikum, hat der erfindungsreiche Waffentechniker eine Zeit lang in einer Geschützfabrik gearbeitet und auch bei der Planung des Wiener Arsenals mitgewirkt; jetzt verbeißt er sich in die Konstruktion von Büchsen, die mit einer Ladung von 600 Bleikugeln gefüllt sind und von Heißluftballons aus 3500 Klafter Höhe abgeworfen werden sollen.
Der erste Versuch, noch von Land aus unternommen, schlägt fehl; beim zweiten wechselt man aufs Wasser und läßt die Ballons vom Dampfschiff »Vulcan« aufsteigen. Doch die heikle Prozedur scheitert abermals. War es beim ersten Probelauf die ungünstige Luftströmung, die einen zielgenauen Abwurf der »Bomben« erschwerte, so ist es beim zweiten eine nicht einkalkulierte »Nebenwirkung«: Das Feuer bringt nicht nur die Ballonladungen zur Explosion, sondern auch die Ballons selbst. Zwar treffen die Geschosse ihr Ziel (den Lido das eine, den Giardino publico das zweite), doch die Fluggeräte gehen in Flammen auf und stürzen samt den mit Kohlensäure gefüllten Abschußöfen zu Boden.
In den Frontberichten, die im Jahr darauf unter dem Titel »Kriegsbegebenheiten bei der kaiserlich österreichischen Armee in Italien vor Venedig« im Verlag der k.k. Hof- und Staatsdruckerei in Buchform erscheinen, findet das blamable Experiment fast nur als Fußnote Erwähnung; kleinlaut redet man sich auf »die damalige stürmische Witterung« und auf »die dringend notwendige anderweitige Verwendung des Dampfers ›Vulcan‹« aus. Verschämt schließt der Bericht über Österreichs kläglichen Einstieg in den »Luftkrieg« mit den Worten: »So konnte man sich von dieser Erfindung keine nutzbare Anwendung versprechen.« Die Rückgewinnung Venedigs muß also mit herkömmlichen militärischen Mitteln erkämpft werden. Doch bevor Radetzky den Befehl zur Belagerung der von den Aufständischen kontrollierten Stadt erteilt, versucht er es noch einmal im Guten. Mit einem leidenschaftlichen Appell soll das Ruder herumgerissen werden: »Bewohner Venedigs, ich will mit Euch als Vater reden. Es ist nun ein volles Jahr unter Aufruhr und anarchistischer Erhebung verflossen, und was sind die düsteren Folgen davon? Der öffentliche Schatz ist erschöpft, das Vermögen der Privaten verloren, Eure blühende Stadt in die äußerste Not versetzt.«
Doch die von den Revolutionären eingesetzte Stadtregierung stellt sich taub, will von Unterwerfung, von der Übergabe der Befestigungen, der Flotte und der Waffen nichts wissen. »Zu sehr«, so wird Radetzky später in seinen »Erinnerungen« festhalten, »waren sie in ihren Träumen von der alten Herrlichkeit der Republik befangen.«
So müssen also die Waffen entscheiden. Am 22. August 1849 ist das Ziel erreicht: Venedig kapituliert, die österreichischen Truppen ziehen in die Lagunenstadt ein, der Podestà (Bürgermeister) muß schweren Herzens dem mit der schwierigen Operation betrauten General Haynau die Goldenen Schlüssel der »Serenissima« ausfolgen.
Tenor der bitter-grimmigen Bilanz, mit der die österreichischen Kriegsberichterstatter das Kapitel Venedig abschließen: Wie leicht hättet Ihr Euch dies alles ersparen können! Im Wortlaut: »Dies waren die traurigen Folgen eines bewaffneten Aufstandes, welcher mit Undank gegen die wohlmeinendsten Zugeständnisse eines gütigen Monarchen begann, durch Fanatismus, Unverstand und Bosheit fortgesetzt wurde und eine im schönsten Wiederaufblühen begriffene Stadt in kurzer Zeit wieder an den Abgrund des Verderbens brachte.«
Keine Vokabel ist den Schreibern des Wiener Pressehauptquartiers zu drastisch, um Verantwortungslosigkeit und Schuld des Gegners anzuprangern:
»Ein schauderhaftes Bild menschlicher Verirrung, das als warnendes Beispiel dafür dienen möge, wie tief eine Stadt herabsinken kann, die den Weg der Loyalität und Treue verläßt und sich zum Spielballe der Leidenschaften einiger von Ehrgeiz und Gewinnsucht verblendeter Menschen hingibt.«
Und wie erlebt Radetzky selber, der von seinem Mailänder Hauptquartier aus die Geschicke der österreichischen Truppen lenkt, seinen hart errungenen Sieg? Triumphgeheul ist seine Sache nicht. Jede Verhängung des Standrechtes, jede Hinrichtung gegnerischer Offiziere und Soldaten stürzt den greisen Feldmarschall in schwerste Gewissenskonflikte. Gegen den Willen seiner eigenen Offiziere läßt er jugendliche Demonstranten laufen, und auch einer Reihe italienischer Geistlicher, die sich mit Feuerüberfällen auf österreichische Patrouillen hervorgetan haben, schenkt er das Leben, indem er sich mit ihrer Strafversetzung in entlegenere Gemeinden begnügt.
Ja, er hat es nicht leicht auf seinem Posten als Generalgouverneur von Lombardo-Venetien: Anarchistische Elemente bewerfen Radetzkys Soldaten, wo immer sich diese blicken lassen, mit Pflastersteinen und Ziegelbrocken; andere streuen, um den Widerstand gegen die »nordischen Barbaren« anzufeuern, das Gerücht aus, die Österreicher stächen ihren Gefangenen die Augen aus; und eine besonders fanatische Dame der Mailänder Gesellschaft, die zu einem Galadiner geladen ist, läßt sich, als ihr einer der Lakaien das Menü servieren will, zu dem Ausruf hinreißen: »Danke, ich habe keinen Appetit – es sei denn, man kredenzt mir das gebratene Herz eines Österreichers.«
Geradezu groteske Formen nimmt der Haß auf die Radetzky-Truppen an, als im Frühjahr 1848 in Mailand der sogenannte »Zigarrenrummel« losbricht. Da die noch von Kaiser Josef II. als Staatsmonopol ins Leben gerufene k.k. Tabakregie einen bedeutenden Einnahmeposten im Staatshaushalt darstellt, ist das Rauchen in diesen Tagen äußerster finanzieller Bedrängnis zur patriotischen Pflicht geworden. Um den österreichischen Fiskus zu schwächen, rufen umgekehrt die Anführer des »Risorgimento« alle Italiener zum Raucherstreik auf. Scharen jugendlicher Patrioten ziehen durch die Stadt und schlagen jedem, den sie mit einer brennenden Zigarre oder Zigarette antreffen, den Glimmstengel aus der Hand. Die Folge: Die Straßen von Mailand sind mit Tschicks übersät, und kaum jemand traut sich noch in eine k.k. Tabaktrafik.
Aber auch die Gegenreaktion bleibt nicht aus: Die plötzlich unverkäuflich gewordenen Lagerbestände der Tabakregie wandern in die Militärverpflegungsmagazine und werden gratis an die Soldaten verteilt – mit dem Befehl, sich in den Straßen von Mailand nie anders als rauchend blicken zu lassen. Wie Kappenrosette und Seitengewehr gehört also von Stund an auch die demonstrativ zur Schau gestellte Virginia zur vorschriftsmäßigen Adjustierung jedes anständigen österreichischen Soldaten …
Wie es Feldmarschall Radetzky selber damit hält, ist nicht überliefert. Auch in seinen letzten Lebensjahren – einundneunzigjährig stirbt er am 5. Jänner 1858 in der Villa Reale in Mailand – wird der alte Recke als außerordentlich genügsam geschildert. Kammerdiener Karl Ferschel, der ihm den Haushalt führt, hat nur dafür Sorge zu tragen, daß in ausreichender Menge die Leibspeise Tirolerknödel auf den Tisch kommt, und von Tochter »Fritzi«, der er laufend Straßburger Pasteten, erlesene Kompotte und prämierte toskanische Weine an ihren Wohnsitz Ödenburg schicken läßt, erbittet er sich als Gegengabe lediglich frischen Liptauer.
Den ihm vom Kaiser zuerkannten Ruhesitz auf Schloß Unterthurn bei Laibach kann er nicht mehr genießen, und auch von den 200 000 Gulden, mit denen ihm der Fiskus den Dank für seine 72 Dienstjahre abstattet, bleibt ihm persönlich kein Groschen: Radetzkys miserabel wirtschaftende Ehefrau hat hinter seinem Rücken derart gigantische Schulden angehäuft, daß er das Angebot des Wiener Hofes, als erster und einziger NichtHabsburger in der Kaisergruft beigesetzt zu werden, ausschlagen und seine sterblichen Überreste dem millionenschweren Kriegslieferanten Pargfrieder testamentarisch vermachen muß, der sich mit der Errichtung eines »Heldenberges« auf seinem niederösterreichischen Besitz Schloß Wetzdorf einen Lebenstraum erfüllt. Kaiser Franz Joseph – als der letzte der insgesamt fünf Monarchen, denen Johann Joseph Wenzel von Radetzky im Laufe seines langen Lebens gedient hat – begleitet den Sarg seines Paladins bis in die Gruft – eine Auszeichnung, die vor ihm keinem zweiten Feldherrn zuteil geworden ist.