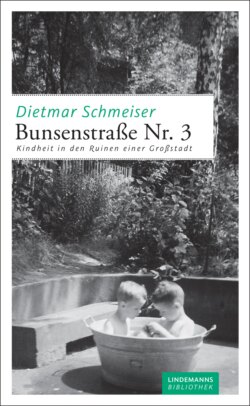Читать книгу Bunsenstraße Nr. 3 - Dietmar Schmeiser - Страница 12
ОглавлениеUnseres Herzens Wonne liegt
in praesepio.
Nein, in der Bunsenstraße lag in Kriegszeiten kein Jesu parvule in einer Krippe. Bruchstückhaft erinnere ich mich an die Christfeste jener Zeit. 1941 und dann alle folgenden Jahre ohne Vater. Dennoch reich beschenkt: 1941 mit einem Pferdewagen von Steiff und einer Eisenbahn von Märklin, die, hatte man das Uhrwerk aufgezogen, tapfer eine Acht fuhr. Neben Gepäck- und Personenwagen besaß sie noch einen Niederbordwagen, auf den ein Panzer geschraubt war. Sicher zur Verstärkung von Vaters Einheit. In Vaters Kriegstagebuch zum 23. November 1941 hingegen ist zu lesen: „Doch wie gerne würde ich die Weihnachtsfreude der Buben erleben; wie sie sich über die Eisenbahn freuen, wie könnte ich mit ihnen spielen. Wie habe ich die Meinen gern!“
Bei genauem Betrachten des Weihnachtsbildes von 1942 können in unseren Händen auch Plastelin-Soldaten entdeckt werden, die im Laufe des Krieges sich zu einer ganzen Kompanie erweitern sollten. Fast hätte ich es vergessen. Natürlich war ein großer Christbaum im Speisezimmer aufgestellt, mit silbernem Lametta und allerhand bunten Kugeln behangen. Bunte Kugeln, das habe ich damals mitbekommen, waren in der Verwandtschaft nicht geschätzt. An den Weihnachtsbaum gehören silberne. Bunte Kugeln, das war vielleicht heidnischer Zierrat.
Die gerade verwitwete Oma und Onkel Walter waren zu Besuch. Der Onkel sollte auch Fotos für unseren Vater im Felde machen. Zu diesem Zweck wurde das Zimmer verdunkelt, der Verschluss der Kamera geöffnet und ein an einem Stecken befestigtes Tütchen, aus dem eine Zündschnur herauslugte, angesteckt. Es tat gleich darauf für den Bruchteil einer Sekunde einen grellen Blitz. Dann war es wieder stockdunkel, und Onkel Walter hatte an der Kamera herumzufummeln, um jetzt den Verschluss zu schließen. Was dabei herauskam, war ein erschrockenes Bibi, wie ich meinen Bruder nannte.
Was in der Busenstraße fehlte, war eine Krippe. Im Elternhaus meiner Mutter gab es ein große, die wir nach den Feiertagen gern bewunderten.
Dennoch, wir kleinen Kinder vermissten sie nicht sonderlich. Erst als ich dann ins Gymnasium kam, Ministrant geworden war und die Gruppenstunden der katholischen Jugend beim Bund Neudeutschland regelmäßig besuchte, bemerkte ich das Defizit. Krippenfiguren zu kaufen, seien sie aus Gips oder gar holzgeschnitzt, daran war überhaupt nicht zu denken. Mutter war in den Nachkriegsjahren froh, wenn sie im Tauschhandel oder, weiß Gott woher, für uns Weihnachtsgeschenke besorgen konnte.
Wieder einmal sollte ich die Erfahrung machen, dass man Defizite am besten kompensiert, indem man selbst aktiv wird. Zu jener Zeit besuchte ich im Gymnasium das „freiwillige Werken“. Mit teilweise primitiven Mitteln und geringen Werkstoffen hatte sich unser Kunstlehrer über die Runden zu retten. Nachdem ein Schnitzmesser, das übrigens noch heute in meinem Werkzeugkasten zu finden ist, auf eigene Kosten angeschafft war, galt es aus Holz Spateln zu schnitzen, die später bei Tonarbeiten behilflich sein sollten. Das war eine lange und zeitraubende Arbeit. Ich freute mich auf den Ton, der nur in kleinen Mengen in einem feuchten Metallkasten sich befand. Wir durften uns alsbald an kleinen Figuren versuchen, die leider, wenn sie fertig waren, wieder in die Kiste mussten. Andere Schüler brauchten auch Ton. In wenigen Fällen durfte man so ein Stück trocknen lassen und mit nach Hause nehmen. An ein Brennenlassen unserer Werke, war nicht zu denken, wenn auch immer wieder uns Hoffnung gemacht wurde.
Es war die Adventszeit gekommen, wir hatten eine junge neue Lehrerin im Werkunterricht bekommen. Die schien mir nicht so eng und sparsam wie ihr Vorgänger, der auch so einen merkwürdigen Dialekt hatte. Der war nicht von hier. Statt dünn sagte er dünne, so gar nicht karlsruherisch.
Der neuen Lehrerin trug ich meinen Wunsch vor, eine Krippe aus Ton formen zu wollen. Das war ein großes Projekt und wie berichtet, obwohl Mutter einen Obolus für die Materialkosten aufbringen musste, blieb die Tonzuteilung beschränkt. So begann ich, eine Madonna mit Kind zu formen, in der Hoffnung, dass diese gebrannt werden könne, was allerdings in der Schule damals nicht möglich war. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Meiner jungen Lehrerin hat das wohl gefallen. Sie gab mir den einen oder anderen Ratschlag. Was mich dann verwirrte, war ihr Hinweis, dass die Brüste der Mütter dicker seien, wenn diese kleine Kinder hätten. Ich folgte ihrem Rat und half mit etwas weiterem Ton nach.
So gerne hätte ich es gehabt, wäre meine Madonna gebrannt worden. Und dabei nicht nur einen Schrühbrand, sondern auch einen Glasurbrand bekommen hätte. Schließlich braucht eine Madonna einen blauen Mantel.
Es war zu jener Zeit nicht möglich. Meine Madonna wurde nur getrocknet. Dennoch bekam sie einen blauen Mantel. Ich griff zu meinen Deckfarben. Als alles bunt war, überstrich ich die Farben mit einer Lasur, die ich in unserer Schulwerkstatt vorfand. Die Madonna sah aus wie nach einem Glasurbrand, und die Farbe hat bis heute gehalten. Eine Ersatzlösung aus der Not geboren. Dieses mein Madonnenbild sollte der Anfang einer eigenen Weihnachtskrippe werden.
Zunächst aber stand oder besser saß meine Muttergottes mit ihrem Kinde einsam unter dem Weihnachtsbaum von 1950. Ich erinnere mich, meine Mutter hat sich gefreut.
Und es wurde wieder Advent. Es sollte wieder eine Überraschung an Weihnachten geben. So bin ich mit meinem Bruder übereingekommen, dass wir gemeinsam uns einem Krippenbau widmen wollten. Da Mutter und Oma, die meist zu Weihnachten uns besuchte, überrascht werden sollten, musste dies heimlich geschehen, was nicht leicht war. Mutter war selten außer Haus. Die beste Gelegenheit war, wenn sie ins Theater ging. Tante Anna hatte ihr ein Abonnement fürs Staatstheater geschenkt. Die Termine waren uns bekannt. Kaum war Mutter außer Haus, begann in der Küche ein geschäftiges Treiben. Unter dem Balkon hatten wir heimlich das Material versteckt, aus dem unsre Krippenlandschaft gebaut werden sollte. Die Möglichkeiten waren bescheiden. Unser Bauwerk musste sich danach ausrichten. Wir hatten ein Bodenbrett und Sackleinen, aus der wir eine Höhle formen wollten. Hierzu sollte das Leinen mit heißem Knochenleim getränkt und beim Erkalten geformt werden. Auf unserer Bodenplatte befestigten wir einige Stützen, über die das Sackleinen gezogen wurde. Aus der Drogerie in der Uhlandstraße hatte ich für unser Taschengeld eine Platte Knochenleim gekauft, die im Wasser aufquellen sollte und erhitzt werden musste. Dass hierfür kein mütterliches Kochgerät infrage kam, war klar. Eine alte Konservenbüchse, auf die Gasflamme gestellt, tat es auch. Nach zwei bis drei Theaterbesuchen unsrer Mutter waren wir recht gut vorangekommen. Unser schwierigstes Problem bei unserer heimlichen Arbeit war der entsetzliche Gestank, den heißer Knochenleim verbreitet. Wir kannten etwa die Zeit, zu der der Theaterwagen an der Haltestelle Hübschstraße ankam. Zuvor musste nicht nur unser Bauwerk unter dem Balkon wieder verschwunden, sondern auch Küchentür und Fenster zum Lüften aufgerissen sein. Die kalte Winterluft hat dafür gesorgt, dass unsere so sensible Mutter von unserem Treiben nie etwas gemerkt hat.
Entstanden war eine Felsenhöhle, in deren Verlängerung sich ein Vordach anschloss. Das war aus Zweigen geschnitten, die unsere zahlreichen Fliederbüsche und Bäume hatten opfern müssen. Die Muttergottes sollte nicht einsam mit ihrem Kinde unter dem Dach sitzen, da gehörte der heilige Joseph, Hirten und möglichst eine Vertretung der Heiligen Drei Könige dazu, vom Viehzeug ganz abgesehen. In der Schule konnte ich mir weiteren Ton besorgen, und so machte ich mich ans Werk, diese Figuren zu schaffen. Das geschah natürlich wieder in aller Heimlichkeit, wieder in der oben geschilderten Methode. So richtig zufrieden war ich mit meiner Arbeit nicht. Das schnelle und heimliche Treiben hat man meinen Figuren angemerkt. Mein Versuch, mit zwei kleinen Glühbirnchen aus einer Taschenlampe dem Ganzen etwas Glanz zu geben, verhielt sich auch in Grenzen. Dennoch, unsere Krippe war ein besinnlicher Ort.
Anders verhielt es sich zu jener Zeit in unserer Heimatkirche. Ein Leuchten wie die Sonne matris in gremio fand sich in regis curia; sprich in unserem vom Bombenhagel sich wieder schrittweise erholenden „Bonifaz“. Zur Weihnachtszeit hatte der Messner dort eine große Krippe aufgebaut. Das heilige Geschehen war eindrucksvoll und wurde von sehr vielen bestaunt. Überhaupt waren die Kirchen nach dem Kriege brechend voll. Drei Kapläne unter der Leitung des Geistlichen Rates Dr. Dold hielten an den Sonntagen sechs Messen. In den Weihnachtsmessen standen die Menschen dicht gedrängt bis zur Kommunionbank. Was war geschehen, dass sich unsere Kirche so füllte? Es lag sicher nicht allein an den vielen Flüchtlingen, mit denen wir unsere Wohnungen teilen mussten. Auch die in ihre Stadtwohnung zurückgekehrten konnten das Bild nicht erklären. War es die Dankbarkeit derjenigen, die der Krieg verschont hatte? Oder wollten plötzlich sich alle wieder als gute Christen zeigen, die niemals etwas mit den Nazis oder der Wehrmacht zu tun hatten? Da war es vielleicht schon einmal gut, sich beim Stadtpfarrer Dold sehen zu lassen, der von den Nazis eingesperrt und von Reinhold Frank verteidigt worden war. Oder war es die Furcht, die unter der Bevölkerung grassierte, in amerikanische Internierungslager gesperrt zu werden, wo man gedemütigt und gefoltert wurde, wie im damaligen Bestseller von Salomon zu lesen war? Ich konnte in meinem Alter das alles nicht beurteilen. Die Ansichten der Erwachsenen flogen mir so um den Kopf. Ich sah nur die vielen Menschen in der Kirche, die mich hingegen gar nicht bedrängen konnten. Ich hatte meinen Platz – als Ministrant am Altar. Und als Sankt Bonifatius wieder aufgebaut war, war an Weihnachten Platz für sechzig Altardiener in dulci jubilo.