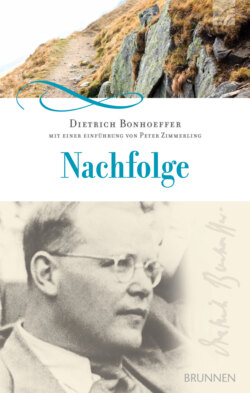Читать книгу Nachfolge - Dietrich Bonhoeffer - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Bedeutung für heute
ОглавлениеImmer wieder ist in der Vergangenheit zum Teil heftige Kritik an der „Nachfolge“ geübt worden: Hier werde Luthers Lehre von der Rechtfertigung allein aus Gnaden in gefährliche Nähe zu einer neuen Werkgerechtigkeit gebracht.52 Die „Nachfolge“ bleibe mit ihrer Betonung des Gegensatzes von Kirche und Welt weit hinter Bonhoeffers späterer „Ethik“ zurück, in der er zu einer Theologie vorangeschritten sei, die die Verantwortung für den Nächsten – egal ob innerhalb oder außerhalb der Kirche – in den Vordergrund rücke.53 Ja, Bonhoeffer selbst habe sich später von der „Nachfolge“ distanziert. Auch die eigene Familie hat den Finkenwalder Bonhoeffer als „Intermezzo“ verstanden.54
Seit einigen Jahren lässt sich jedoch eine Rehabilitierung des „kirchlichen“ Bonhoeffer beobachten.55 Bonhoeffers letztes Wort zur „Nachfolge“ findet sich in einem Brief an Eberhard Bethge, den er am 21.7.1944 schrieb, einen Tag nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler: „Ich dachte, ich könnte glauben lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen versuchte. Als das Ende dieses Weges schrieb ich wohl die ‚Nachfolge‘. Heute sehe ich die Gefahren dieses Buches, zu dem ich allerdings nach wie vor stehe, deutlich. Später erfuhr ich und ich erfahre es bis zur Stunde, daß man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt.“56 Mit anderen Worten: Zum Inhalt der „Nachfolge“ steht Bonhoeffer weiterhin, nur der Ort der Nachfolge hat sich für ihn verändert: Es ist nicht mehr ein kommunitärer Lebensrahmen, sondern die Gemeinschaft der Widerstandskämpfer gegen Hitler. Ich bin geneigt zu sagen: Ein solcher Lebensrahmen wird nicht nur für Christen, sondern grundsätzlich für alle Menschen die Ausnahme sein. Dafür gilt analog, was Bonhoeffer im Hinblick auf das Martyrium in der „Nachfolge“ geschrieben hat: „Christus würdigt das Leben nur weniger seiner Nachfolger der engsten Gemeinschaft seines Leidens, des Martyriums.“57 Von daher behält das Buch als Entfaltung der theologischen Grundlagen der Nachfolge Jesu Christi seine ungebrochene Bedeutung. Die Situation des Dritten Reiches ist paradigmatisch für jede Nachfolge-Situation. Sie stellt sich als Brennglas dar, durch das ich dem Wesen der Nachfolge Jesu Christi überhaupt deutlicher auf die Spur zu kommen vermag.
Theologie und Kirche sind heute weithin konzentriert auf die Frage nach der Vermittelbarkeit des Evangeliums.58 Zauberwort und Ausschlusskriterium ist die notwendige „Anschlussfähigkeit“ theologischer Überlegungen. Im Zentrum steht dabei die Analyse der Situation des Menschen in persönlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Darüber tritt die Besinnung auf die zu verkündigenden Inhalte des Evangeliums in auffälliger Weise zurück. Es drängt sich der Eindruck auf, als würden diese als selbstverständlich bekannt und gegeben vorausgesetzt. Der empirisch vorfindlichen Kirche kommt als Bezugshorizont höchstens eine Nebenrolle zu. Die gelegentlich zu beobachtende sog. „Doppelstrategie“ – Besinnung auf die Grundlagen und Öffnung nach außen – stellt häufig ein hilflos anmutendes Hin- und Herlavieren dar. Angesichts dieser Situation eröffnet der radikal kirchliche Ansatz Bonhoeffers in der „Nachfolge“ nicht nur einer Kirche, die durch staatliche Verfolgung marginalisiert ist, einen Weg in die Zukunft. Auch eine Kirche, die durch Mitgliederschwund, Selbstsäkularisierung (Wolfgang Huber) und gesellschaftlichen Pluralismus zunehmend in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit gedrängt wird, kann durch die Besinnung auf das theologisch Wesentliche ein neuer Anfang ermöglicht werden.
Dass sich der Protestantismus gegenwärtig in einer schwierigen Umbruchsituation befindet, ist übereinstimmende Ansicht vieler. Unterschiedlich sehen dagegen die vorgetragenen Lösungsansätze aus. Der bekannte amerikanische Soziologe Peter L. Berger spricht von West- und Mitteleuropa als dem „Katastrophengebiet für die Kirchen“.59 Dabei ist jede Krise doppelgesichtig: Sie birgt nicht nur Gefahren, sondern gleichermaßen auch Chancen in sich. Sie eröffnet einen Raum, in dem Neues wachsen kann, weil die alten Strukturen sich als nicht mehr tragfähig erweisen. Bonhoeffer war bereit, Neues zu denken und das Erkannte in die Praxis umzusetzen, wobei er allerdings von bestimmten undiskutierbaren Fundamenten ausging. Dazu gehörte wesentlich die Konzentration seines Glaubens auf Jesus Christus und die Kirche. In der „Nachfolge“ überwindet er die falsche Dominanz von Individualismus, Subjektivismus und Innerlichkeit des neuprotestantischen Glaubensverständnisses. Gegenwärtige spirituelle Pluralisierungs- und kirchliche Verselbstständigungs-prozesse drohen den Protestantismus in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit zu führen. Bonhoeffers Insistieren auf der empirisch-vorfindlichen Kirche als gegenwärtiger Gestalt der Gemeinde Jesu Christi bewahrt vor der unendlichen – vergeblichen – Suche nach der perfekten Gemeinde. Zur Gestalt der christlichen Gemeinde gehört ihre unaufhebbare Unfertigkeit. Diese Erkenntnis kann für Menschen, die unter den Mängeln der Kirche leiden, eine große Entlastung darstellen. Sie schiebt überdies der weiteren Zersplitterung des Protestantismus einen Riegel vor.
Der organisatorischen Erneuerung der Kirche muss die Erneuerung ihrer Spiritualität vorausgehen. Das Nachdenken über neue Strukturen in der Kirche hat unter eschatologischem Vorbehalt zu erfolgen. Erneuerung der Kirche gibt es nur „ubi et quando visum est deo“ – „wo und wann es Gott gefällt“ (Bekenntnis von Augsburg 1530, Artikel 5). Die Erneuerung der Kirche ist nur auf dem Weg der Erneuerung ihrer Theologie und Frömmigkeit zu haben. Angesichts der seit einiger Zeit zu beobachtenden „Wiederkehr der Religion“ erweist sich die Konzentration von Bonhoeffers Theologie auf Jesus Christus als hilfreiches Kriterium religiöser Neuaufbrüche. Sie verhindert, dass anstelle des Glaubens an den für mich gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus eine nebulöse, christlich angereicherte und verbrämte Erlebnisreligion tritt. Daneben ist die Orientierung von Bonhoeffers Theologie an Jesus Christus als kritisches Moment gegenüber einer häufig zu beobachtenden christologischen Unterbestimmtheit volkskirchlichen Handelns, z. B. ihrer Verkündigung und Seelsorge wichtig.
Teile von Theologie und Kirche haben die Orientierung an Jesus Christus aufgegeben. Sie sind überzeugt, dass diese das interreligiöse Gespräch unmöglich macht und in einer multireligiösen Gesellschaft zu gesellschaftlichem Unfrieden führt. Die Gottessohnschaft Jesu ist jedoch das unaufgebbare Zentrum des christlichen Glaubens (1Joh 4,2). An ihr hängt die Erlösung allein aus Gnaden. An ihr hängt auch die Gewissheit des Heils und des ewigen Lebens. Analoges gilt im Hinblick auf die Kirche Jesu Christi. Sie steht nicht zur Diskussion, weil in ihr allein das Reich Gottes zeichenhaft erfahrbar ist. Sie allein erlaubt eine Vorwegerfahrung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes lässt sich nicht in der Gesellschaft insgesamt verwirklichen. Die Geschichte zeigt, dass das immer nur zu Gesinnungsterror führen wird.
Es scheint gegenwärtig keine fertigen Lösungen zu geben, wie eine zukunftsfähige Kirche aussehen sollte. Deshalb gilt es, die Improvisation als Kategorie kirchlichen Handelns neu zu entdecken. Bonhoeffers Theologie ist fragmentarisch geblieben. Er hat, auch in der „Nachfolge“, kein theologisches System entwickelt, sondern hat seine Überlegungen angesichts neuer Herausforderungen ständig weiterentwickelt. Gerade das Fragmentarische jedoch macht seine Gedanken heute so anregend: Es eröffnet die Chance zum eigenen Weiterdenken und erlaubt eigenes Experimentieren. Zudem entspricht das Fragmentarische der beschleunigten Zeit in der Postmoderne. Fertige Lösungen wären im Moment ihrer Fertigstellung bereits wieder veraltet.
Eine weitere Einführung von Peter Zimmerling in das Leben und Werk Dietrich Bonhoeffers finden Sie im Internet:
• Stationen auf dem Weg zur Freiheit:
Dietrich Bonhoeffers Leben
www.brunnen-verlag.de/ peter-zimmerling-dietrich-bonhoeffers-leben
• Stationen auf dem Weg zur Freiheit:
Dietrich Bonhoeffers Werk
www.brunnen-verlag.de/ peter-zimmerling-dietrich-bonhoeffers-werk
1Vorformen der folgenden Überlegungen habe ich erstmals veröffentlicht in: Peter Zimmerling, Bonhoeffer als Praktischer Theologe, Göttingen 2006, 29–31.
2„Den tiefsten Eindruck einer lebendigen Gemeinde empfing Bonhoeffer in der Abessinian Baptist Church seines Freundes Frank Fisher im nahen Harlem, in deren Sonntagsschule und Gottesdiensten er ein halbes Jahr intensiv mitarbeitete“ (so Hans Christoph von Hase, in: Dietrich Bonhoeffer, Barcelona, Berlin, Amerika (1928–1931), hg. von Reinhart Staats/H.C. von Hase, DBW, Bd. 10, München 1991, 595).
3A.a.O., 274; Hervorhebungen von P.Z.
4Vgl. Dietrich Bonhoeffer, London (1933–1935), hg. von Hans Goedeking u. a., DBW, Bd. 13, Gütersloh 1994, 272f; Dietrich Bonhoeffer, Illegale Theologenausbildung: Finkenwalde (1935–1937), hg. von Otto Dudzus/Jürgen Henkys, DBW, Bd. 14, Gütersloh 1996, 112ff.144ff.
5Brief vom 27.1.1936, zit. nach DBW, Bd. 14, 113.
6DBW, Bd. 13, 272.
7Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hg. von Christian Gremmels u.a., DBW, Bd. 8, Gütersloh 1998, 397.
8Vgl. z. B. DBW, Bd. 14, 486. Carl Friedrich von Weizsäcker interpretiert richtig: „So geschieht sein Durchbruch zur Bibel nicht an dem hochintellektuellen Text des Römerbriefs [wie bei Karl Barth], sondern in der unerträglich-gnädigen Einfachheit der Bergpredigt“ (C.F. Weizsäcker, Gedanken eines Nichttheologen zur theologischen Entwicklung Dietrich Bonhoeffers, in: Genf ’76. Ein Bonhoeffer-Symposion, bearb. von Hans Pfeifer (Internationales Bonhoeffer-Forum, Bd. 1), München 1976, 41).
9DBW, Bd. 13, 273.
10A.a.O.
11Paul Scheurlen (Hg.), Vom wahren Herzenstrost. Martin Luthers Trostbriefe, Stuttgart 1930, 59.
12Dietrich Bonhoeffer. Theologe, Christ, Zeitgenosse. Eine Biographie, Gütersloh8 2004, 246ff.
13DBW, Bd. 13, 128f (Hervorhebung im Text).
14Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, hg. von Martin Kuske/Ilse Tödt, DBW, Bd. 4, Gütersloh 21994, 304.
15A.a.O., Anm. 17.
16Vgl. dazu im Einzelnen a.a.O., 8ff (Vorwort der Herausgeber mit Belegen).
17DBW, Bd. 14, 97f.
18Vgl. hier und im Folgenden DBW, Bd. 4, 8ff (Vorwort der Herausgeber).
19Nachbemerkung Bonhoeffers zur Bergpredigtauslegung 1935, zit. nach DBW, Bd. 4, 191, Anm. 28.
20Gegen Sabine Bobert-Stützel, Dietrich Bonhoeffers Pastoraltheologie, Gütersloh 1995, die die Gewichte genau andersherum verteilt.
21Vgl. dazu Bethge, Bonhoeffer, bes. 563ff.611ff.652ff.673wff.
22Darauf weist Christian Möller hin in: ders., „Wie geht es in der Seelsorge weiter? Erwägungen zum gegenwärtigen und zukünftigen Weg der Seelsorge“, in: Theologische Literaturzeitung 113, 1988, bes. 411.415.
23Vgl. hier und im Folgenden DBW, Bd. 4, 10ff (mit Belegen).
24Vgl. dazu im Einzelnen a.a.O., 14, Anm. 31.
25DBW, Bd. 13, 171.
26S. 61, vgl. DBW, Bd. 4, 52.
27S. 40, vgl. DBW, Bd. 4, 29.
28S. 42, vgl. DBW, Bd. 4, 31.
29S. 80f, vgl. DBW, Bd. 4, 71f.
30S. 60, vgl. DBW, Bd. 4, 51.
31S. 87, vgl. DBW, Bd. 4, 78.
32S. 93, vgl. DBW, Bd. 4, 84.
33S. 152, vgl. DBW, Bd. 4, 148.
34S. 188, vgl. DBW, Bd. 4, 182.
35S. 187, vgl. DBW, Bd. 4, 181.
36S. 219, vgl. DBW, Bd. 4, 215.
37S. 236, vgl. DBW, Bd. 4, 233.
38S. 276, vgl. DBW, Bd. 4, 276.
39S. 304, vgl. DBW, Bd. 4, 303.
40A.a.O.
41S. 96, vgl. DBW, Bd. 4, 88; Hervorhebung im Text.
42S. 96, vgl. DBW, Bd. 4, 88f.
43S. 95, vgl. DBW, Bd. 4, 87.
44S. 99, vgl. DBW, Bd. 4, 91.
45A.a.O.
46S. 102f., vgl. DBW, Bd. 4, 95.
47S. 301, vgl. DBW, Bd. 4, 300.
48Nachweise bei Ernst Feil, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers. Hermeneutik, Christologie, Weltverständnis, München 3[1980], 165.208.
49S. 301, vgl. DBW, Bd. 4, 300.
50S. 302, vgl. DBW, Bd. 4, 301.
51S. 302, vgl. DBW, Bd. 4, 301.
52Gerhard Krause, Art. „Bonhoeffer, Dietrich“, in: TRE, Bd. 7, Berlin/New York 1981, 55–66.
53Feil, Theologie.
54Eberhard Bethge, Bekennen und Widerstehen. Aufsätze, Reden, Gespräche, München 1984, 203f.
55S. Schmitz, Nachfolge; DBW, Bd. 4, 321–332 (Nachwort der Herausgeber); Zimmerling, Bonhoeffer als Praktischer Theologe.
56DBW, Bd. 8, 542.
57S. 303, vgl. DBW, Bd. 4, 302.
58Vgl. hier und im Folgenden Zimmerling, Bonhoeffer als Praktischer Theologe, 52–55.
59P. L. Berger, „An die Stelle der Gewissheit sind Meinungen getreten“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.5.1998, 14.