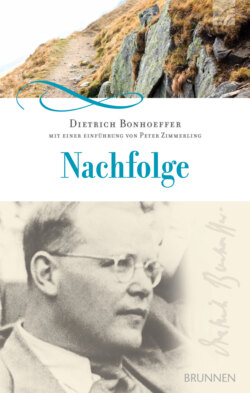Читать книгу Nachfolge - Dietrich Bonhoeffer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Entstehung und Hintergrund 1.1 Voraussetzung: Bonhoeffer – ein „Bergpredigt-Christ“
ОглавлениеNach Abschluss der Habilitation war Bonhoeffer zu jung, um in der Altpreußischen Union zum Pfarrer ordiniert zu werden.1 Darum schloss er 1930/31 ein Studienjahr am Union Theological Seminary in New York als Stipendiat an. In dieser Zeit wurden wesentliche Voraussetzungen für das spätere Buch „Nachfolge“ gelegt. Bonhoeffer fand hier – vor dem Dritten Reich und vor dem Kirchenkampf – zu einem persönlichen Christusglauben, der unmittelbar mit einem neuen Verständnis der Bergpredigt verbunden war. Ausgelöst wurde seine Hinwendung zu Jesus Christus durch Gottesdienst- und Gemeinschaftserfahrungen in einer schwarzen Gemeinde Harlems.2 Dabei scheint das Moment der Verfremdung eine wesentliche Rolle gespielt zu haben: „Man konnte hier wirklich noch von Sünde und Gnade und von der Liebe zu Gott und der Letzten Hoffnung christlich reden und hören, wenn auch in andrer Form als wir es gewohnt sind.“3
Zwar gibt es keine unmittelbaren Zeugnisse dieses spirituellen Umbruchs, der mit einschneidenden theologischen Erkenntnissen Hand in Hand ging. Bonhoeffer hat aber später ihm nahe stehenden Menschen brieflich davon erzählt.4 Im Rückblick auf diese Zeit schrieb er an eine Freundin: „Damals war ich furchtbar allein und mir selbst überlassen. Das war sehr schlimm. Dann kam etwas anderes, etwas, was mein Leben bis heute verändert hat und herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Das ist auch wieder sehr schlimm zu sagen. Ich hatte schon oft gepredigt, ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet und geschrieben – und ich war noch kein Christ geworden, sondern ganz wild und ungebändigt mein eigener Herr. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst, für eine wahnsinnige Eitelkeit gemacht. Ich bitte Gott, dass das nie wieder so kommt. Ich hatte auch nie oder doch sehr wenig gebetet. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh an mir selbst. Daraus hat mich die Bibel befreit und insbesondere die Bergpredigt. Seitdem ist alles ganz anders geworden. […] Das war eine große Befreiung. Da wurde mir klar, dass das Leben eines Dieners Jesu Christi der Kirche gehören muss […]“5. Schon ein Jahr früher, im Januar 1935, hatte Bonhoeffer an seinen Bruder Karl-Friedrich geschrieben: „Lieber Karl-Friedrich, ich glaube zu wissen, daß ich eigentlich erst innerlich klar und wirklich aufrichtig sein würde, wenn ich mit der Bergpredigt wirklich anfinge Ernst zu machen. […]6 Auch in „Widerstand und Ergebung“ hat er noch einmal auf den Umbruch in Amerika Bezug genommen. „Ich habe mich, glaube ich, nie sehr geändert, höchstens in der Zeit meiner ersten Auslandseindrücke […]“7.
Bonhoeffers Hinwendung zu einem persönlichen Christusglauben beinhaltete zwei theologische Neuentdeckungen: zum einen eine neue Sicht der Bibel als persönlicher Anrede Gottes, als „Liebesbrief Gottes“,8 zum anderen – wie er in dem bereits zitierten Brief an den Bruder schreibt – „die Kompromisslosigkeit eines Lebens nach der Bergpredigt in der Nachfolge Christi“9, die sich für ihn im Engagement für „Friede[n] und die soziale Gerechtigkeit, oder eigentlich Christus“ konkretisierte.10 Wenn Luther als „Weihnachts-Christ“ bezeichnet werden kann – das Kind in der Krippe von Bethlehem ist für Luther der klarste Spiegel der väterlichen Liebe zum Menschen11 –, ist Bonhoeffer fortan ein „Bergpredigt-Christ“. Ab diesem Zeitpunkt muss seine ganze Theologie und Biografie bis hin zu „Widerstand und Ergebung“ als Bemühung um die möglichst wörtliche Befolgung der Bergpredigt verstanden werden – bis dahin eine Domäne katholischer Spiritualität, wenn man einmal von täuferischen und radikalpietistischen Erscheinungen absieht. Für den damaligen Mainstream-Protestantismus Europas ein völliges Novum! Hier hat Bonhoeffers Vorliebe für ethische Fragestellungen ihren Grund, auch sein Einsatz dafür, dass die Kirche in ethischen Entscheidungssituationen das konkrete Gebot verkündigen soll.
Zurück in Europa begann Bonhoeffer über die Bedeutung der Bergpredigt für Theologie und Glaube nachzudenken. Flankiert wurde dieses Nachdenken von einer geistlichen Lebensführung.12 Er ging von nun an regelmäßig zum Gottesdienst und meditierte täglich einen Abschnitt aus der Bibel, ganz ohne exegetische oder gemeindepraktische Nebenabsichten, einfach um darin Gottes Wort an ihn persönlich zu vernehmen. Seit Anfang der 1930er-Jahre hielt er überdies danach Ausschau, wo er ein Leben in der Nachfolge zusammen mit Gleichgesinnten verwirklichen konnte. Gleichzeitig bot er für seine Berliner Studierenden regelmäßig Wochenendfahrten in die Mark Brandenburg an, bei denen ein geistlicher Tagesrhythmus mit Meditationszeiten und Tagzeitengebeten eingeübt wurde. Hier wurden die Grundlagen für die spätere Lebensordnung des Finkenwalder Predigerseminars gelegt und damit die theoretischen Überlegungen zur „Nachfolge“ erstmals praktisch erprobt.
Während seines Londoner Auslandspfarramts von 1933–1935 scheint sich die Beschäftigung mit der Bergpredigt weiter intensiviert zu haben. Am 28.4.1934 schrieb Bonhoeffer an seinen Schweizer Pfarrersfreund Erwin Sutz: „Der Nat. Soz. [Nationalsozialismus] hat das Ende der Kirche in Deutschland mit sich gebracht […]. Und obwohl ich mit vollen Kräften in der kirchlichen Opposition mitarbeite, ist es mir doch ganz klar, daß diese Opposition nur ein ganz vorläufiges Durchgangsstadium zu einer ganz anderen Opposition ist, […] der eigentliche Kampf, zu dem es vielleicht erst später kommt, muß einfach ein glaubendes Erleiden sein […]. Wissen Sie, ich glaube – vielleicht wundern Sie sich darüber – daß die ganze Sache an der Bergpredigt zur Entscheidung kommt. […] es geht immer um das Halten des Gebotes und gegen das Ausweichen. Nachfolge Christi – was das ist, möchte ich wissen – es ist nicht erschöpft in unserem Begriff des Glaubens.“13 Wie dieses „glaubende Erleiden“, wie dieses „Halten des Gebotes“ gegenüber dem „Ausweichen“ aussieht, beschreibt Bonhoeffer in der „Nachfolge“.
Die im Brief an Sutz erkennbar werdende Prägung der Spiritualität Bonhoeffers deutet darauf hin, dass für seine Überlegungen zur „Nachfolge“ die „Imitatio Christi“ des Thomas à Kempis grundlegend war. Das wird an einer Fülle von Aussagen der „Imitatio“ erkennbar: Jesus soll die erste Stelle im Herzen einnehmen, nie ein Mensch (2. Buch, Kap. 8). Was würde aus dem Menschen werden, wenn er nicht das große Licht Jesu hätte, dem er nachfolgen kann? (3. Buch, Kap. 18). Der alte Mensch kann in diesem Leben nie vollständig unter die Herrschaft des Geistes Gottes gebracht werden (3. Buch, Kap. 20). Nur in der Nachfolge Jesu Christi ist die Wahrheit zu erkennen (3. Buch, Kap. 56). Nachfolger Jesu sind Diener des Kreuzes (3. Buch, Kap. 56). Christus spricht: „Denn deshalb werden so wenige erleuchtet und innerlich frei, weil sie sich nicht gänzlich opfern. Mein Wort bleibt in seiner ganzen Kraft: Wer nicht alles opfert, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn du also mein Jünger sein willst, so opfere dich mir ganz, mit all deiner Liebe“ (4. Buch, Kap. 8).
Die „Imitatio“ begleitete Bonhoeffer seit seiner Habilitation bis in die Tegeler Gefängniszelle. Mindestens 15 Jahre lang beschäftigte er sich immer wieder mit ihr. Dabei ist auffällig, dass fast alle Bezugnahmen mit Zustimmung erfolgen. Laut kritischem Apparat der „Dietrich Bonhoeffer Werke“ geht Bonhoeffer in der gesamten „Nachfolge“ allerdings nicht ein einziges Mal auf die „Imitatio Christi“ ein, obwohl er sie im zeitlich bald darauf entstandenen „Gemeinsamen Leben“ häufig zitiert, er sich also mit der Spiritualität und Theologie Thomas à Kempis gerade in dieser Zeit verstärkt auseinandergesetzt haben muss. Ich gehe davon aus, dass der Versuch, die inhaltlich-theologische Bedeutung der „Imitatio Christi“ für Bonhoeffers „Nachfolge“ formalistisch durch die Suche nach wörtlichen Übereinstimmungen zu erfassen, nicht ausreicht. Dafür spricht z. B. folgende Beobachtung: Der letzte Satz der „Nachfolge“ Bonhoeffers lautet: „Der Nachfolger Jesu ist der Nachahmer Gottes. ‚So seid nun Gottes Nachahmer als die lieben Kinder‘ (Eph 5,1).“14 „Luther übersetzt μιμεται in Eph 5,1 mit Nachfolger; Bonhoeffers (auffallenderweise – am Schluss seines von Nachfolge handelnden Buches) abweichende Übersetzung erinnert an den Begriff imitatio (‚Nachahmung‘).“ Zunächst ist Nachahmung nur die genauere Übersetzung von μιμεται (Luther übersetzt hier freier mit Nachfolger). Gleichzeitig ist jedoch die Beobachtung nicht von der Hand zu weisen, dass eine solche Änderung des Luthertextes, vor allem am Schluss der „Nachfolge“, auffällig ist. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass die „Imitatio Christi“ inhaltlich wesentlich mehr Einfluss auf die „Nachfolge“ hatte, als dies der kritische Apparat vermuten lässt.
Erste Teile, zumindest Vorformen des späteren Buches „Nachfolge“, hat Bonhoeffer spätestens seit Ende 1933 in London erarbeitet und niedergeschrieben.15