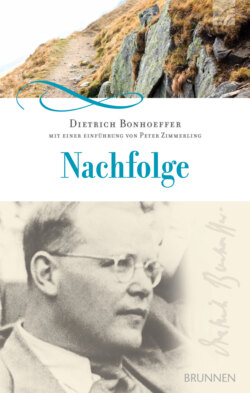Читать книгу Nachfolge - Dietrich Bonhoeffer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Das Predigerseminar der Bekennenden Kirche in Finkenwalde bei Stettin als Ort theoretischer Reflexion und gelebter Praxis der Nachfolge
ОглавлениеNicht in Berlin, Rom oder New York, sondern in Pommern hat Dietrich Bonhoeffer nach eigenen Aussagen die erfüllteste Zeit seines Lebens verbracht. „Der Sommer 1935 ist für mich […] die beruflich und menschlich ausgefüllteste Zeit bisher gewesen“, schreibt er in einem Brief an die Mitglieder des ersten Finkenwalder Vikarskurses.16 Warum besitzt Finkenwalde in der Biografie Bonhoeffers eine derart herausragende Bedeutung? Wie wir sahen, war seit seinem Studienaufenthalt in Amerika die Nachfolge Jesu Christi, wie sie die Bergpredigt fordert, zur Mitte und zum Motor seines theologischen Nachdenkens wie seines persönlichen Lebens und Glaubens geworden. Als die Leitung der Bekennenden Kirche ihn 1935 zum Direktor eines ihrer Predigerseminare berief, sagte er nicht zuletzt deshalb zu, weil sich ihm hier einerseits die Möglichkeit zur lehrmäßigen Weitergabe der Gedanken zur Nachfolge an die nachwachsende Theologengeneration und andererseits ein Experimentierfeld zur praktischen Umsetzung seiner Überlegungen bot. Bonhoeffer lehrte in Finkenwalde fünf Halbjahreskurse lang zum Thema „Nachfolge“.17 Er scheint dazu seine Vorarbeiten zur Bergpredigt aus der Londoner Zeit verwendet zu haben. Parallel dazu hielt er an der Berliner Universität im Wintersemester 1935/36 eine einstündige Vorlesung zum gleichen Thema – die letzte Lehrveranstaltung, bevor ihm die Lehrbefugnis wegen seiner Tätigkeit als Direktor eines Predigerseminars der Bekennenden Kirche entzogen wurde.
Was Finkenwalde gegenüber den anderen Predigerseminaren der Bekennenden Kirche besonders machte, war die Zentralstellung der Vorlesungen zur Nachfolge. Entsprechend neu und provozierend waren für die Finkenwalder Seminaristen Bonhoeffers Gedanken. Eine Aussage wie die folgende hatten sie in der traditionellen Theologie und Verkündigung noch nicht gehört: „Also Bergpredigt kein Wort, mit dem man hantieren könnte […]. Sondern tragfähig nur, wo gehorcht. Kein freies Wort zur Verwertung, nicht zum Mitnehmen und Bedenken, sondern entscheidendes Wort, zwingendes.“18 Zusammen mit dem theologischen Nachdenken über die Frage, was Nachfolge heißt, erfolgte ihre Umsetzung im gemeinsamen geistlichen Leben. In Finkenwalde sollte jeder Vikar persönlich ein Leben in der Nachfolge entsprechend den Geboten der Bergpredigt einüben.
Ihre Zuspitzung erfuhr dieses Experiment durch den Kirchenkampf.19 Auf der Bekenntnissynode von Barmen war im Frühjahr 1934 die im Wesentlichen von Karl Barth verfasste Theologische Erklärung von den Vertretern der Bekennenden Kirche verabschiedet worden, im Herbst desselben Jahres wurde in Berlin-Dahlem die kirchliche Notordnung der Bekennenden Kirche verabschiedet. Die Finkenwalder Vikare waren wie Bonhoeffer selbst bereit, mit ganzem Einsatz für die Beschlüsse beider Synoden einzustehen. Dazu gehörten Gestapo-Verhöre und Gefängnisaufenthalte, denen die meisten Finkenwalder Vikare im Laufe ihres Dienstes ausgesetzt waren – sowohl vor als auch nach der Finkenwalder Zeit.20 Dies bildet die dunkle Folie, vor deren Hintergrund die Arbeit in den Predigerseminaren erst die richtige Kontur gewinnt. Die Herausgeber der Bonhoeffer-Gesamtausgabe haben zu Recht den Titel „Illegale Theologenausbildung“ für Bonhoeffers Tätigkeit sowohl in Finkenwalde als auch in den sich anschließenden Sammelvikariaten gewählt. Wer nach Finkenwalde kam oder später in die Sammelvikariate eintrat, wusste, was ihn kirchenpolitisch erwartete. Die Vikare hatten das Studium und ein Lehrvikariat in einer Gemeinde unter der Anleitung eines normalerweise zur Bekennenden Kirche gehörenden Pfarrers hinter sich. In Finkenwalde sollten sie zum letzten Mal ein halbes Jahr konzentriert wissenschaftlich, d. h. praktisch-theologisch arbeiten, um sich auf das Pfarramt vorzubereiten. Aufgrund der Illegalität der Predigerseminare der Bekennenden Kirche mussten die Vikare damit rechnen, nach dieser Zeit weder festes Gehalt noch feste Anstellung noch ein Pfarrhaus zu bekommen. Trotzdem sind insgesamt 184 Vikare durch Finkenwalde und die Sammelvikariate gegangen. Sie alle waren jung und bereit, frei vom Ballast traditioneller kirchlicher Institutionen für die Erneuerung der Kirche zu arbeiten.
Unter allen Umständen wollte Bonhoeffer die Privatisierung der Frömmigkeit, den Rückzug in die Innerlichkeit auf Kosten des Engagements für den bedrohten Nächsten verhindern, einen Vorgang, den er auch in den Reihen der Bekennenden Kirche beobachtete. Vor diesem Hintergrund gelesen, wird die „Nachfolge“ plötzlich auch politisch hochbrisant. Das Buch stellt den Versuch dar, die Bergpredigt als konkrete Richtschnur für das Handeln der Bekennenden Kirche auszulegen – und zwar für Theologen und Laien gleichermaßen.21 Dass Bonhoeffer mit solchen Überlegungen auf die Dauer nicht nur in einen unüberbrückbaren Gegensatz zum deutschchristlichen Kirchenregiment, sondern auch zum Dritten Reich insgesamt geriet, erstaunt nicht.
Die Nachfolge im Gehorsam gegenüber den konkreten Weisungen der Bergpredigt sollte in Finkenwalde zur Inthronisation des Wortes Gottes führen. Ziel war, zum Vertrauen auf die Selbstwirksamkeit des Wortes Gottes anzuleiten. Heute, in einer insgesamt autoritätskritischen, demokratisch verfassten Gesellschaft, mutet die Betonung des Gehorsams gegenüber dem Wort Gottes autoritär an. Vor dem Hintergrund einer totalitären Ideologie kam jedoch das Befreiungspotenzial des Wortes Gottes in ganz anderer Weise zur Geltung.22 Es befreite von jeder Form von Manipulation. Die Orientierung des Glaubens am biblischen Jesus Christus beinhaltete einen Gegenentwurf zum Führerkult des Dritten Reiches. Im Glauben an Jesus verloren alle anderen Mächte ihren Herrschaftsanspruch über den Menschen.
Bonhoeffer begann seine Finkenwalder Vorlesungen zum Thema Nachfolge nach dem Ende des Sommerkurses 1936 zu einem Buchmanuskript umzuarbeiten.23 Als die Gebäude des Predigerseminars im September 1937 von der Gestapo versiegelt wurden, befand sich das Manuskript bereits beim Verlag. Es erschien im Advent 1937 in erster und 1940 in zweiter Auflage, die dritte Auflage konnte erst nach dem Krieg 1950 gedruckt werden. Bis zur Ausgabe in „Dietrich Bonhoeffer Werke“ erlebte die „Nachfolge“ 16 Auflagen. Längst ist das Buch in alle Weltsprachen übersetzt worden.24