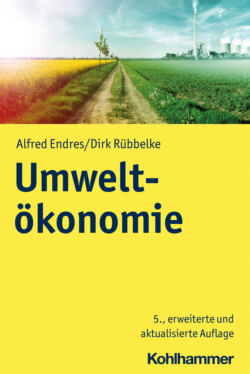Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Abweichungen zwischen Gleichgewicht und Optimum durch externe Effekte: Das Problem des »Marktversagens«
ОглавлениеNatürlich stellt das oben kurz skizzierte ökonomische Modell eine radikale Vereinfachung der in der Realität herrschenden Verhältnisse dar. Berücksichtigt man seine außerordentliche Schlichtheit, so muss es zwar wohl erstaunen, dass es doch mit diesem Modell in Ansätzen gelingt, wichtige Triebkräfte des wirtschaftlichen Handelns bzw. die Natur wirtschaftlicher Institutionen (z. B. Gewinn-, Nutzenstreben, Konkurrenz, Durchsetzung von Präferenz und Kaufkraft auf dem Markt usw.) in Ansätzen darzustellen. Andererseits kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, dass es für eine unmittelbare wirtschafts- bzw. umweltpolitische Anwendung viel zu grob strukturiert ist.
So ist es z. B. offensichtlich, dass in der Realität auch einzelne Anbieter bisweilen erheblichen Einfluss auf den Preis des von ihnen hergestellten Produktes haben. Dies ist für die Optimalität des Marktgleichgewichts sehr folgenschwer. Im Extremfall des Monopols realisiert der Anbieter ein Gleichgewicht, bei dem die Grenzkosten unter dem Marktpreis liegen. Im Gleichgewicht sind daher marginale Zahlungsbereitschaft und Grenzkosten nicht aneinander angeglichen, d. h. die sozial optimale Produktionsmenge wird verfehlt. In ähnlicher Weise wird die Optimalität des Marktgleichgewichts durch staatliche Interventionen, z. B. Zölle oder Produktsteuern, gestört, die einen Keil zwischen den von den Konsumenten gezahlten und den von den Produzenten empfangenen Preis treiben. Auch hier wird ein Ausgleich der marginalen Zahlungsbereitschaften mit den Grenzkosten nicht erreicht. Eine Fehlallokation ist die Folge. Ein weiterer im wirklichen Leben (und in etwas komplexeren ökonomischen Modellen) wichtiger Aspekt, der oben ausgeblendet wurde, liegt darin, dass die Akteure nicht über ausreichende Informationen verfügen, um sich in der oben erklärten Weise zu verhalten. Insbesondere kann die Information (z. B. hinsichtlich der Qualität eines Produktes) zwischen Anbieter und Nachfrager asymmetrisch verteilt sein. Ist der Nachfrager nicht in der Lage, alle relevanten Produkteigenschaften vor dem Kauf zu beobachten, können sich Fehlallokationen ergeben. Die einschlägige ökonomische Theorie geht zurück auf die 1970 erschienene Arbeit über The Market for »Lemons«: Quality Uncertainty and the Market Mechanism von G. Akerlof.33 Der Autor wurde im Jahre 2001 für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Informationsökonomik mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft ausgezeichnet. Im Kontext unserer mit der Theorie externer Effekte befassten Erörterung verzichten wir auf eine ausführliche Darstellung und begnügen uns mit der folgenden Kurzfassung.
Seitenblick 2: 34 Ökonomische Theorie der asymmetrischen Information – Kurzfassung
Keine Frage: Die Liste der in der Realität vorzufindenden Unterschiede zu dem oben skizzierten idealtypischen Modell ist lang. Sie ist Teil der Folklore mikroökonomischer Lehrbücher. Allerdings ist nicht in jedem Erörterungszusammenhang jeder Eintrag in dieser Liste von Interesse. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass die ökonomische Modellbildung gerade nicht das Ziel verfolgt, die Realität wie ein Foto abzubilden. Wir wollen uns daher im Folgenden auf die für die Analyse von Umweltproblemen relevanteste Abweichung zwischen Realität und Modell konzentrieren:35 In der obigen idealtypischen Darstellung war (implizit) unterstellt, dass von der Produktion des Gutes x lediglich die Produzenten und die Nachfrager (ferner auch die marktlichen Anbieter der zur Produktion erforderlichen Produktionsfaktoren) betroffen sind.
Jegliche Nutzen- oder Kostenwirkung, die mit dem Gut x einhergeht, ist in diesem Modell über Märkte vermittelt: Die Nutzen aus dem Konsum des Gutes x fallen ausschließlich bei den Konsumenten an, die für den Kauf dieses Gutes auf dem Markt für das Gut bezahlen. Die Kosten für die Produktion fallen ausschließlich bei den produzierenden Firmen an, die für ihren Aufwand über den Markterlös kompensiert werden. Sie setzen zur Produktion lediglich Produktionsfaktoren ein, die auf Faktormärkten gekauft werden. In dem oben kurz skizzierten Modell für das Gut x existieren keine Beziehungen, die nicht Marktbeziehungen sind. Dieser Umstand muss angesichts der in der Realität herrschenden Verhältnisse als drastische Vereinfachung gelten. Wir bezeichnen in der Ökonomie über Märkte vermittelte Interdependenzen zwischen Individuen als »interne Effekte«.
Ein »externer Effekt« besteht dagegen darin, dass die Nutzensituation (bei Firmen: Gewinnsituation) eines Individuums unmittelbar, d. h. ohne Vermittlung durch den Marktmechanismus, von einer Aktivität abhängt, die von einem anderen Individuum kontrolliert wird. Legt man diese Definition zugrunde, so wird man unmittelbar feststellen, dass die Lebenswelt jedes Einzelnen ein dichtes Gestrüpp externer Effekte enthält. Nicht alle diese Effekte sind in unserem Zusammenhang relevant und es besteht keineswegs Konsens in der Gesellschaft darüber, um welche es sich dabei handelt. Ein konsensfähiges Beispiel für einen externen Effekt dürfte in der Staubemission einer Firma bestehen.36
Aus einer monetären Bewertung der externen Effekte gehen die externen Kosten hervor.37 Die insgesamt durch die Produktion verursachten Kosten, die »sozialen Kosten«, ergeben sich als Summe aus privaten und externen Kosten.
Zur Erläuterung der Auswirkungen eines externen Effekts auf die Optimalität eines Konkurrenzgleichgewichts kehren wir wieder zu unserem obigen Beispiel der Produktion des Gutes x zurück. Nehmen wir zur Vereinfachung an, es existiere ein dritter Haushalt38, m, der durch die Rußemission (wie auch immer definierte) Schäden erleidet. Es sei möglich, die Höhe der Schäden in Abhängigkeit von der Emissionsmenge in Geldeinheiten anzugeben. Die Auswirkung dieser Modellerweiterung auf die Optimalität des Marktgleichgewichts und damit auf den wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf lässt sich durch eine Konfrontation der oben schon erörterten Interessen der Firmen i und j sowie der Haushalte k und l einerseits und des Haushalts m andererseits darstellen. Um die Darstellung nicht unnötig unübersichtlich werden zu lassen, fassen wir die oben besprochenen Interessen von i, j, k und l zusammen, indem wir die Angebotskurve und die Nachfragekurve für das Gut x aus Abbildung 1 saldieren. Die Nachfragekurve gibt, wie oben ausgeführt, den Bruttonutzen der Produktion des Gutes x an. Die Angebotskurve gibt, wie ebenfalls oben aufgeführt, die Kosten dieser Produktion an, soweit sie durch den Verbrauch vermarkteter Produktionsfaktoren entstehen. Daher repräsentiert die Differenz der beiden Kurven die marginalen Nettonutzen der Produktion bei ausschließlicher Berücksichtigung der über den Markt koordinierten Beteiligten (i, j, k, l). In Abbildung 1 sinkt die saldierte Kurve N - A im Punkt optimaler Produktion (x*) auf null ab, über dem die Angebotskurve die Nachfragekurve schneidet. Anstatt diese Kurve in konventioneller Weise von null ausgehend in Richtung zunehmender Produktionsmengen abzulesen, können wir sie auch umgekehrt, d. h. vonx* in Richtung 0 betrachten. Dann gibt uns die Kurve an, wie hoch der Nettonutzen ist, auf den die Gesellschaft, soweit sie am Markt für x repräsentiert ist, verzichtet, wenn die Produktion von x eingeschränkt wird. Diese Nutzenverzichte sind nichts anderes als die Opportunitätsgrenzkosten einer Verminderung des Produktionsniveaus. Unterstellen wir, dass der externe Effekt (hier die Rußemissionen der Produzenten) strikt proportional zur Produktionsmenge ist39, so können wir die saldierte Kurve als Grenzvermeidungskostenkurve der Rußemission bezeichnen. Die Grenzvermeidungskostenkurve, GVK, ist in der Abbildung 2 eingetragen.40 Außerdem enthält die Abbildung die beim Haushalt m anfallenden Grenzschäden, GS, in Abhängigkeit vom Produktions-(Emissions-)Niveau.41
Damit ist die Bühne für die Aufführung des Programms »Internalisierung externer Effekte« bereitet. Darunter versteht man die Anlastung der externen Kosten beim Verursacher. Gelingt die Internalisierung, so berücksichtigt dieser bei seinen Allokationsentscheidungen nicht nur die privaten, sondern auch die externen – insgesamt also die sozialen – Kosten. Damit ist private und gesellschaftliche Rationalität harmonisiert. Zur näheren Erläuterung dieser Zusammenhänge kann zunächst in vollständiger Analogie zu den obigen Ausführungen zum Marktgleichgewicht und zum in der Ökonomie
Abb. 2
üblichen Optimalitätskriterium das optimale Niveau der Emissionen bestimmt werden.42
Die den externen Effekt verursachende Aktivität muss nach der oben dargestellten Logik auf dasjenige Niveau begrenzt werden, für das der Nettonutzen der Begrenzung maximal ist. Dieser Nettonutzen ergibt sich aus dem Bruttonutzen abzüglich der Kosten der Begrenzung. Betrachten wir die Rückführung der emissionsverursachenden Aktivität x von der Ausgangslage x* auf eine geringfügig darunter liegende Menge x*− ε. Der Bruttonutzen der Reduktion der Aktivität um ε liegt in den damit vermiedenen Schäden. In der Grafik wird dieser Effekt durch das Integral (die Fläche) unter der Grenzschadenskurve in den Integrationsgrenzen x*− ε bis x* symbolisiert (vgl. die Fläche x*− ε, x*, A, B). Die Kosten, die der Gesellschaft durch diese Reduktion aufgebürdet werden, sind dagegen als Integral unter der GVK-Kurve in denselben Grenzen abzulesen (vgl. die Fläche x*− ε, x*, C). Geben die in die Grafik eingetragenen Kurven die Verhältnisse aus unserem Beispiel korrekt wieder, so liegt der Bruttonutzen einer Reduktion des externen Effekts (gemessen als Vermeidung des Schadens) um ε Einheiten deutlich über den Kosten der Reduktion.
Das sozial optimale Reduktionsniveau ist erreicht, wenn die Menge von x* auf x** zurückgeführt wird. Hier ist die Differenz zwischen den Nutzen und Kosten der Reduktion maximal. Mit anderen Worten: Die Grenznutzen entsprechen den Grenzkosten. In der Grafik ist die optimale Emissions-(Produktions-)Menge durch den Schnittpunkt der GVK- mit der GS-Kurve charakterisiert. Wir erkennen hier deutlich die Analogie zwischen dem umweltökonomischen Konzept der optimalen Emissionsmenge und dem traditionellen mikroökonomischen Konzept der optimalen Produktionsmenge. Beide Optima sind charakterisiert durch den Ausgleich marginaler Wertgrößen, die sich jeweils als Grenznutzen und Grenzkosten der zu optimierenden Größe interpretieren lassen.43
Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass es sich bei der hier vorgetragenen Umweltökonomie um eine strikte Anwendung der traditionellen Mikroökonomie (mit all ihren Stärken und Schwächen) handelt. Allerdings fällt die Bewertung des Marktmechanismus nach diesem einheitlichen Optimalitätskonzept im Fall des Vorhandenseins externer Effekte diametral entgegengesetzt zum idealtypischen Modell vollständiger Konkurrenz aus. Während bei letzterem dem Marktmechanismus Optimalität bescheinigt wird, fallen Marktgleichgewicht (x*) und Optimum (x**) bei Anwesenheit externer Effekte auseinander. Weicht das Allokationsergebnis eines Mechanismus vom Optimum ab, so sprechen wir in der Ökonomie vom »Versagen« dieses Mechanismus. Handelt es sich bei dem betreffenden Allokationsmechanismus wie im hier erörterten Fall um das Marktsystem, so sprechen wir von »Marktversagen«.44
Natürlich birgt diese Terminologie bei umgangssprachlichem Verständnis die Gefahr der Fehlinterpretation. Versagt ein Mechanismus, so könnte man meinen, muss man ihn schleunigst durch einen anderen ersetzen. Dabei sollte man allerdings Vorsicht walten lassen. Es könnte sich ja herausstellen (und so ist es denn auch), dass kein realer Allokationsmechanismus das anspruchsvolle Optimalitätskriterium der sozialen Nettonutzenmaximierung erfüllt. Lehnte man alle Konzepte ab, die das Kriterium nicht erfüllen, so bliebe keines übrig. In der Literatur wird daher dem »Marktversagen« gern das »Staatsversagen« zur Seite gestellt. Jüngst ist häufig auch von (oh Schreck!) »Wissenschaftsversagen« die Rede.
Wir müssen daher für die praktische Wirtschafts- bzw. Umweltpolitik damit leben, dass wir nur unter unvollkommenen Allokationsmechanismen wählen bzw. diese kombinieren können. Das Optimalitätskonzept dient dabei lediglich (immerhin!) als (gelegentlich defekter) Kompass, an dem wir ablesen können, in welcher Richtung reale Allokationsmechanismen und deren Kombinationen verändert werden müssen.