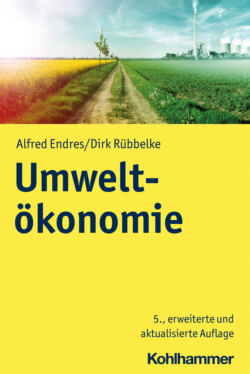Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Das Prinzip der Konsumentensouveränität
ОглавлениеBei der oben kurz erfolgten Erörterung des ökonomischen Optimalitätskonzepts spielten Wertgrößen (nämlich Produktionskosten, Umweltschäden und Nutzen aus Güterkonsum) die konstituierende Rolle. Zentral für das Wertkonzept, das dort zugrunde liegt, ist die Vorstellung, dass der positive oder negative Wert, den ein Gut oder Ungut für einen Entscheidungsträger selbst hat, allein von diesem Entscheidungsträger selbst beurteilt werden kann. Der im ökonomischen Modell veranschlagte Nutzen eines Gutes für einen Konsumenten besteht in der Nutzenempfindung dieses Konsumenten. Die Nutzenvorstellungen (Präferenzen) des Entscheidungsträgers werden in der Ökonomie (jedenfalls im überwiegenden Teil der Literatur51) als gegeben vorausgesetzt. Der Prozess der Genese von Präferenzen, insbesondere deren Determiniertheit durch gesellschaftliche Interaktionen und Lernprozesse, wird vom Hauptstrom der ökonomischen Literatur nicht analysiert, obwohl er zweifellos für die Realität von großer Bedeutung ist. Außerdem verdient der Umstand Beachtung, dass die hier zugrunde liegende Mainstream-Ökonomie vereinfachend unterstellt, dass sich die Präferenzen der Individuen ausschließlich auf die Ergebnisse des Allokationsprozesses (also insbesondere die Güterversorgung) beziehen. Gegenüber der Art und Weise, wie das Allokationsergebnis zustande kommt, sind die Individuen annahmegemäß gleichgültig.52 Diese (und andere) Einschränkungen bedeuten nicht, dass die traditionelle ökonomische Theorie für die Erklärung menschlichen Verhaltens wertlos ist, aber doch, dass sie einen wesentlichen Aspekt der Dynamik menschlicher Gesellschaften nicht erklärt und daher nur eine (wenn auch eine sehr wichtige) Stimme im polyphonen Konzert humanwissenschaftlicher Erklärungsansätze übernehmen kann.
Für die positive oder negative Nutzenbewertung eines Gutes oder Ungutes durch einen Konsumenten ist die Wahrnehmung des Entscheidungsträgers wesentlich. Diese ist notwendig selektiv. Allerdings muss davor gewarnt werden, das Prinzip der Konsumentensouveränität unter Hinweis auf die mangelnde Informiertheit der Konsumenten über die Eigenschaften von Produkten und die negativen Auswirkungen von Umweltbelastungen abzulehnen. Hier droht sonst die Gefahr autoritärer Lösungsvorschläge.
Informationsmängel können zu Einschränkungen der Rationalität in der Entscheidungsfindung führen. Der Mangel kann etwa auf dem Fehlen an Zeit für die Beschaffung notwendiger Informationen beruhen. Herbert Simon, der 1978 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, führte den Ausdruck der »bounded rationality« ein.53
In einer demokratischen Gesellschaft sollten die Wertungen der einzelnen Individuen auch dann eine zentrale Rolle spielen, wenn diese nicht voll informiert sind. Abgesehen davon, dass die Missbrauchsgefahr bei einer Expertokratie erheblich wäre, muss auch der Informationsgrad der Experten skeptisch beurteilt werden. Diese überblicken meist lediglich einen Teilaspekt des komplizierten und interdependenten Problems der Umwelt- bzw. Wirtschaftspolitik. Sie können daher wesentliche Zutaten zu dem komplexen gesellschaftlichen Kommunikationsprozess liefern, diesen aber keinesfalls ersetzen.
Bezüglich der Rolle der Ökonomie bei der Behandlung von Problemen des Informationsgrades der Konsumenten muss betont werden, dass hier erhebliche Fortschritte zu verzeichnen sind. Zunehmend wird die »Informationsökonomie«, nach der die Informiertheit von Entscheidungsträgern nicht mehr als exogen vorgegeben behandelt wird, in den »Organismus« der ökonomischen Theorie integriert. Hier wird der Prozess der Informationsproduktion und -verarbeitung selbst als ökonomisches Problem angesehen, über das Aussagen bezüglich der Optimalität von Gleichgewichten möglich sind.54